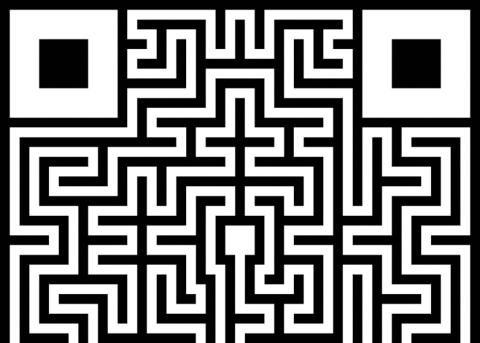Grundrechte: Stresstest knapp bestanden
Auch ein Jahr nach Ausbruch der Coronakrise bleiben grundlegende Freiheiten stark eingeschränkt. In welchen Bereichen droht sich der Ausnahmezustand zu verstetigen, wo hingegen ist Alarmismus fehl am Platz? Eine Zwischenbilanz.

Glaubt man Heribert Prantl, steht es zurzeit schlecht um unsere Demokratie. Und Prantl muss es ja wissen, schliesslich ist er nicht irgendwer, sondern Deutschlands wandelndes Grundgesetz, sein liberales Gewissen. «Not und Gebot» heisst das neue Buch des Autors und Juristen, das vergangene Woche erschienen ist. Das Szenario, das er darin entwirft, ist alarmierend.
«Noch nie in der Geschichte ist das Leben der Menschen ausserhalb von Gefängnissen so strikt reguliert worden wie in der Corona-Zeit. Jede einzelne der vielen Verbots- und Kontrollregeln hätte in anderen Zeiten zu Aufständen geführt. In der Corona-Zeit wurden sie überwiegend akzeptiert, begrüsst», so Prantl. So sehr hätten wir alle uns an den Ausnahmezustand gewöhnt, dass wir die Einschränkungen grundlegender Freiheiten nicht mehr richtig wahrnähmen, geschweige denn hinterfragten. Grundrechte in Quarantäne, ein Virus als Gesetzgeber.
Das abgemeldete Parlament
Prantl schreibt über Deutschland, wo die Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19 in Teilen rigoroser als in der Schweiz waren, wo Gerichte Ausgangssperren, Beherbergungsverbote und Eingrenzungen als unverhältnismässig kippten. «Es gab wohl noch nie in so kurzer Zeit so viele im Einzelfall unverhältnismässige Grundrechtseingriffe. Verordnungen, aus der Not des Augenblicks geboren, haben Gesetze nicht mehr vollzogen, sondern ersetzt.» Ähnlich harte Einschränkungen kennen auch viele andere europäische Staaten.
Doch auch in der Schweiz wurde gerade zu Beginn der Pandemie vieles möglich, was vorher undenkbar schien. Am 25. Februar 2020, vor exakt einem Jahr also, registrierten die Behörden im Tessin den ersten Schweizer Coronafall bei einer Person, die sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Wenige Wochen später brach das Parlament seine Session ab, die Gerichte verabschiedeten sich in die Ferien; man mobilisierte die Armee, ohne zu wissen, wofür, riegelte Pärke und Promenaden ab und beschnitt das Recht auf Protest, man schickte Überwachungsdrohnen los und erstellte Bewegungsprofile. In den drei Monaten der «ausserordentlichen Lage» war die Macht der Exekutive beinahe allumfassend.
Seither haben sich in der Schweiz über eine halbe Million Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, beinahe 10 000 sind an Covid-19 gestorben. Aber sind auch bei uns die Grundrechte auf der Strecke geblieben? Und wie steht es um die Gewaltenteilung und die demokratische Mitbestimmung? Die gute Nachricht vorweg: Auch wenn einige Bereiche durchaus Anlass zur Sorge geben, ganz so alarmierend, wie Heribert Prantl die Situation für Deutschland beschreibt, scheint die Lage nicht zu sein.
Videoanruf beim Basler Verfassungsrechtler Markus Schefer. Der Bundesrat berücksichtige grundrechtliche Fragen heute stärker als früher, konstatiert er. Zwar habe die Exekutive am Anfang unterschätzt, wie wichtig etwa die Versammlungsfreiheit für eine Demokratie sei – «eine Kundgebung hat einen anderen Stellenwert als eine Party». Inzwischen aber seien etwa religiöse und politische Treffen von der Fünferregel ausgenommen. «Es gab aus meiner Sicht keine Massnahme, bei der ich dachte: ‹Das ist eine Frechheit›», so Schefer. Er habe nicht den Eindruck, dass der Bundesrat fahrlässig agiere, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern.
Sorgen bereitet dem Experten aber die Entwicklung der Legislative: «Das Parlament hat den Tritt nicht wiedergefunden.» Mitte März, kurz bevor die Schweiz in den ersten Lockdown ging, brachen die Büros von National- und Ständerat die laufende Session ab. In der viel zitierten Stunde der Exekutive beschloss der Gesetzgeber, es gebe Wichtigeres, als diese Exekutive zu kontrollieren. Schefer sagt: «Seither hat das Parlament keinen ordentlichen Willensbildungsprozess zustande gebracht, der ihm erlaubt hätte, wirksam mitzureden.»
Schaden für die politische Kultur
Statt im Parlament um umfassende Lösungen zu ringen, hätten die Fraktionen bloss einzelne Punkte und Anliegen herausgepickt – wie etwa vergangene Woche, als die bürgerliche Mehrheit in der nationalrätlichen Gesundheitskommission wider jede Vernunft auf eine komplette Öffnung drängte und dies sogar ins Gesetz schreiben will. Man hätte aber von Anfang an etwa eine Delegation aus KommissionsvertreterInnen einsetzen können, die von Verwaltung und Taskforce regelmässig informiert worden wäre, um sich selbstständig eine Meinung zu bilden.
Gefehlt habe aber auch das Diskursive, beklagt Schefer. «Durch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den wichtigen Fragen, einen Blick aufs grosse Ganze, hätte das Parlament auch die Diskussion in der Bevölkerung unterstützt.» Abgesehen von den Pressekonferenzen von Bundesrat und Verwaltung seien die Menschen auf sich allein gestellt.
Anders sieht die Rolle des Parlaments SP-Urgestein Paul Rechsteiner. Der St. Galler Ständerat und Rechtsanwalt gehörte zu den Ersten, die die Verabschiedung des Parlaments im März kritisierten. «Das war ein Tiefpunkt, eine historische Fehlleistung», sagt er heute. Später seien die Defizite allerdings Schritt um Schritt behoben worden, und mit dem Covid-19-Gesetz habe man auch die Gewaltenteilung wiederhergestellt. Gerade wirtschaftspolitische Massnahmen wie die Härtefallregelung seien aus dem Parlament gekommen, merkt er an. «Dabei war es eine positive Kraft.»
Insgesamt sei die persönliche Freiheit verhältnismässig gewahrt worden, findet auch Rechsteiner. Zwar habe es eine Reihe von Fehlern gegeben, etwa im Umgang mit Schulkindern, bei denen ohne Präsenzunterricht Defizite zurückblieben, und mit den Älteren, deren soziale Kontakte man eingeschränkt habe. Den Schweizer Weg sieht er allerdings «bis jetzt einigermassen auf Kurs», gerade auch im europäischen Vergleich.
Empfindlich getroffen hat die Coronakrise auch die demokratischen Prozesse. Dass etwa das Unterschriftensammeln in einer Pandemie schwierig ist, hat das erst in letzter Minute zustande gekommene Antiterrorreferendum demonstriert. Und Demonstrationen sind inzwischen zwar nicht mehr verboten, doch erschweren die strengen Schutzkonzepte die Meinungsbildung auf der Strasse erheblich. Das musste auch die Klimabewegung erfahren, deren Anliegen in den vergangenen Monaten in den Hintergrund gerieten.
Dass man sich weniger austauschen könne, habe zu «einer gewissen Verhärtung der Fronten» beigetragen, beobachtet Schefer. «Meine Befürchtung ist, dass von der Zuspitzung der Gegensätze etwas bleibt, die politische Kultur dauerhaft Schaden nimmt, man nicht mehr miteinander redet.» Daher rühre auch sein Bedürfnis, dass das Parlament vorlebe, wie man in einer solchen Situation miteinander umgehen soll.
So weit, so gut, das Unbehagen aber bleibt. Was, wenn man bei der nächsten Krise auf die Bewältigung der Coronapandemie verweist, um wieder Notrecht einzuführen, wie Heribert Prantl fürchtet? «Angst ruft danach, dass etwas getan wird. Nein, nicht nur etwas, sondern alles: Repression, Prävention, alles miteinander und so viel wie möglich. Angst macht süchtig nach allem, was die Angst zu lindern verspricht», schreibt er.
«Am Anfang herrschte eine dystopische Vorstellung, die Angst vor totaler Überwachung und Kontrolle», erinnert sich Manuela Hugentobler, die Geschäftsführerin des Verbands Demokratische JuristInnen Schweiz. Zwar hätte sich dieses Szenario nicht bewahrheitet; gewisse Dinge könnten sich aber auf die Zukunft auswirken. Als Beispiel nennt Hugentobler die Contact-Tracing-App. «Auch wenn diese heute den Datenschutz garantiert, kann es sein, dass sie die Akzeptanz staatlicher Überwachung normalisiert.» Und Staatsrechtler Schefer meint: «Das Contact Tracing etwa wird so schnell nicht weggehen, zumindest solange das Virus da ist.» Gerade in solchen Bereichen brauche es eine solide Rechtsgrundlage für die nächsten Jahre.
Gestärkt aus der Krise
Manuela Hugentobler weist noch auf einen anderen Punkt hin. «Wer vorher schon schlecht geschützt war, wessen Grundrechte ohnehin eingeschränkt waren, ist auch jetzt schlechter dran», ist sie überzeugt. So hätten die allgemeinen Einreisebeschränkungen etwa auch das Grundrecht auf Asyl tangiert. Zudem habe man die Menschen in Bundesasylzentren und Notunterkünften nicht ausreichend vor dem Virus geschützt.
Trotz der empfindlichen Einschränkungen, die gewohnte demokratische Prozesse über den Haufen werfen und um deren Verhältnismässigkeit immer neu gestritten werden muss, hat Staatsrechtler Schefer keine Angst davor, dass sich der Ausnahmezustand verstetigt, wir uns an ihn gewöhnen könnten. «Im Gegenteil werden sich viele stärker der Bedeutung von Grundrechten bewusst», glaubt er. Immerhin merkten im Gegensatz zu anderen Krisen diesmal alle, dass es auch sie trifft. Schefer verweist auf den internationalen Schutz der Menschenrechte. Dieser sei nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, der grössten Krise des 20. Jahrhunderts.
Und weil alle (mehr oder weniger) von der Pandemie eingeschränkt seien, würden Gleichheitsfragen umso breiter diskutiert, ob bei den wirtschaftlichen Massnahmen oder möglichen Einschränkungen für Nichtgeimpfte, so Schefer. Auch in den kommenden Monaten wird ein genauer Blick auf die allgemeine Lage der Grundrechte unabdingbar bleiben.
Heribert Prantl: «Not und Gebot. Grundrechte in Quarantäne». C. H. Beck Verlag. München 2021. 200 Seiten. 29 Franken.