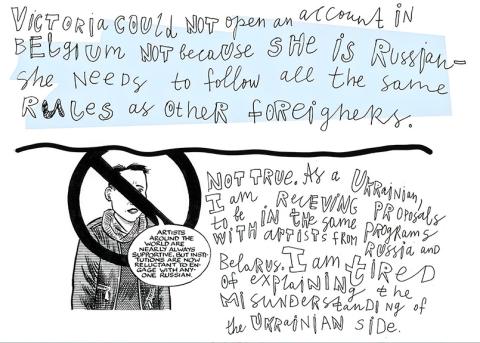Nino Haratischwili: «Die Sowjetunion ist ein Kadaver, der nie begraben wurde»
Die deutsch-georgische Autorin über ihre Jugend in Georgien, warum sich Literatur mit Krieg beschäftigen soll und warum das Stalin-Museum nicht abgerissen werden sollte.

WOZ: Frau Haratischwili, eines der zentralen Themen Ihrer literarischen und theatralischen Werke ist der Krieg. Wieso erzählen Sie so viel vom Krieg?
Nino Haratischwili: Ich würde mich am liebsten gar nicht mit Krieg beschäftigen. Aber leider ist er sehr präsent. Ich bin selbst davon geprägt – meine ganze Kindheit in Georgien in den neunziger Jahren war beherrscht vom Bürgerkrieg. 2008 hat Russland Krieg gegen Georgien geführt und heute gegen die Ukraine. Die Nachwirkungen dieser Kriege sind im Alltag spürbar. Nicht nur für mich, sondern für uns alle.
Was bedeutet Krieg für Sie persönlich?
Es ist nicht das Schlachtfeld, das mich in meiner Literatur fasziniert, sondern es sind die Nachwirkungen, die über mehrere Generationen hinweg als Erbe Bestand haben. Krieg bedeutet nicht nur Kalaschnikows und Panzer. Krieg ist Lebensmittelknappheit, Arbeitslosigkeit, absolute Instabilität, die ein Land und seine Menschen lange Zeit prägt. Auch meine Kindheit in Georgien: Ich wurde eingeschult, und ein paar Wochen später wurde mein Schuldirektor auf offener Strasse ermordet. Raubüberfall. Man durfte sich nicht am Fenster aufhalten, weil dort die Kugeln flogen. Wir mussten Holz oder Kerosin in die Schule bringen, damit der Ofen uns ein bisschen wärmen konnte. Die kollektive Erinnerung an die neunziger Jahre ist: Kälte, Dunkelheit und Gefahr.
Oft geht es in Ihren Romanen und Theaterstücken um die Frage, wann und warum, unter welchen Umständen Menschen zu Täter:innen werden.
Im Krieg ist man plötzlich in der Lage, Dinge zu tun, die man in Friedenszeiten nicht für möglich gehalten hätte. Ich weiss selbst nicht, wozu ich fähig wäre, wenn meine Kinder bedroht würden. Hoffentlich werde ich das nie herausfinden müssen. Unter bestimmten Umständen hat jeder Mensch die Fähigkeit, zum Täter oder zur Täterin zu werden. Und diese Perspektive interessiert mich.
Nehmen wir als Beispiel Ihren Roman «Die Katze und der General» von 2018, in dem Sie vom ersten Tschetschenienkrieg im Jahr 1994 erzählen.
Der General gibt den Befehl, ein Dorf zu stürmen. Seine Soldaten entführen ein Mädchen, foltern und vergewaltigen es. Einige Soldaten weigern sich mitzumachen und werden von anderen Soldaten gefoltert und gezwungen, sich an den Gewalttaten zu beteiligen. Gleichzeitig gibt es Soldaten, die auf Befehl sofort aktiv werden, obwohl ihnen bewusst ist, dass sie Unrecht tun. Doch der Mensch hat immer freie Wahl.
Können Sie das etwas ausführen?
In Russland wird es sicher einige geben, die sich aus Perspektivlosigkeit für die Front melden. Aber es gibt viele Anhänger Putins, die den Krieg gegen die Ukraine als Chance für sich sehen und entweder aus ideologischer Überzeugung oder reiner Profitgier handeln.
Viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion lehnen es derzeit ab, Russisch zu sprechen. Welches Verhältnis haben Sie zur russischen Sprache?
Meine Grossmutter war russischsprachig, und meine erste Lesesprache war Russisch. Ich liebe diese Sprache. Doch meine Einstellung zum Russischen hat sich vor allem durch den Krieg in der Ukraine geändert: Russisch ist heute nicht mehr die Sprache von Puschkin und Dostojewski, die Sprache der Weltliteratur, die ich bis heute sehr liebe, sondern sie ist ein Politikum geworden. Ich war immer der Meinung, dass man Sprache und Politik trennen sollte, doch das hat sich geändert. Seit dem Krieg gegen die Ukraine sind Tausende Russ:innen nach Georgien geflohen – was per se absurd ist, denn die Wunden des Krieges von 2008 sind in der georgischen Gesellschaft noch immer offen. Vor eineinhalb Jahren habe ich in Tbilissi für ein Theater gearbeitet und habe in der Umgebung immer wieder Russisch gehört.
Was hat Sie dabei am meisten irritiert?
Ich war zum Beispiel in einem Café, wo man nur auf Russisch bestellen konnte, das machte mich gleich aggressiv. Warum muss ich in meinem Land auf Russisch bestellen? Weil das ganze Café voller Russ:innen ist? Was sind das für Menschen? Warum sind sie überhaupt geflohen, sind sie wirklich Kremlgegner:innen? Sind sie nur hier, weil es im Moment in Georgien für sie sicher ist? Wie können sie mit den Geflüchteten aus der Ukraine auskommen? Dann fange ich an zu denken und gerate in ein philosophisches Dilemma. Es geht dann ja nicht mehr nur darum, einen Cappuccino auf Russisch zu bestellen.
Was kann die Literatur leisten in der Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden?
Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich mit meiner Literatur den Krieg aufhalten und die Menschen verändern kann. Diese Macht hat die Kunst leider nicht. Aber was wir als Kulturschaffende tun können, ist, tatsächlich das Bewusstsein der Menschen zu schärfen und positive gesellschaftliche Veränderungen in Gang zu setzen, wenn wir darüber reden, was Krieg und Gewalt mit ihnen machen. Und eine gewisse Empathie unter den Menschen hervorrufen, ihnen den Rücken stärken und Informationen in die Hand geben – das kann Kunst leisten.
Sie sind eine Meisterin der Beschreibung von Grausamkeiten. Viele Menschen sind jedoch kriegsmüde. Sie haben genug von den täglichen Nachrichten, die sie aus dem Krieg gegen die Ukraine oder dem Krieg im Nahen Osten erreichen. Braucht es tatsächlich Literatur und Theaterstücke, die sich auch noch mit dem Krieg beschäftigen?
Ich bekomme immer wieder Feedback von Leser:innen, die sagen: «Das wusste ich vor der Lektüre des Buches nicht.» Wenn man zwei Monate lang ein Buch liest und in die Geschichte eintaucht, mit den Figuren im Bett und am Esstisch lebt, dann beschäftigt man sich tiefschürfender mit dem Thema, als wenn man in den Medien täglich Bilder sieht und über die Zahl der Toten liest. Das bleibt abstrakt und zufällig.
Im Theater wiederum sitzt man mit Hunderten von Menschen zusammen. Das schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Hinzu kommen die Schauspieler:innen, die einem beim Aufnehmen des Textes helfen: Durch ihre Körpersprache oder die Art, wie sie den Text sprechen, wird die Bedeutung des gesprochenen Wortes verstärkt. Ausserdem spielt die Musik im Theater oft eine grosse Rolle für die emotionale Wahrnehmung.
Sie haben über ein Dutzend Theaterstücke verfasst. Oft wählen Sie Stoffe aus der griechischen Mythologie, um aktuelle Situationen zu beleuchten. Warum?
Ein Mythos ist nie abgeschlossen. In meinem aktuellen Stück, «Penthesilea. Ein Requiem», erzähle ich die Geschichte von Troja, die vor Tausenden von Jahren geschehen sein soll. Es ist eine universelle Geschichte, eine ewig währende Geschichte. Ob sie im Zweiten Weltkrieg, in Butscha in der Ukraine oder im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina passiert, sie wiederholt sich, und die Menschen ziehen immer wieder Parallelen.
Sie geben in diesem Stück den Frauen die Schuld an der Misere, was aus feministischer Sicht hinterfragt werden kann …
Ich habe schon erwartet, dass die Kritik auf Antifeminismus zielt. Denn ich habe in diesem Stück nicht deutlich gemacht, dass die Frauen die Opfer und die Männer die Täter sind. Es gibt keine Trennung zwischen bösen Männern und guten Frauen. Zu behaupten, dass dies so sei, ist wiederum eine sehr platte Vorstellung von Feminismus. Mein Ausgangspunkt war, dass Frauen genauso schlimm sein können, wenn sie aus einer totalitären Ideologie, Macht oder sozialen Struktur kommen und dieses Prinzip leben.
Können Sie das konkretisieren?
Dass Frauen sowie auch Männer Opfer und Täter:innen innerhalb einer patriarchalen Struktur sein können, ist eine Systemfrage. Bei der Inszenierung meines Stücks war es mir wichtig, dass die Frauen und die Männer auf der Bühne physisch oder mental gleich stark auftreten. Penthesilea als Königin tritt als totale Ideologin und sehr aggressiv auf, Achill befindet sich in einer Krise, in der er sein ganzes Leben infrage stellt. Seine Figur ist ironisiert und gebrochen. Penthesilea hat das Sagen und ist fest davon überzeugt, dass die einzige richtige Entscheidung darin besteht, den Feind zu töten.
Oft bedienen sich die weiblichen Hauptfiguren in Ihren Stücken einer vulgären Sprache, einer Sprache, die gerne als männlich konnotiert wird. Welche Beweggründe stehen hinter dieser Wahl?
In «Penthesilea» argumentiert die Protagonistin anders als ich. Sie sagt, die Männer hätten die Welt erfunden, und sie will deren Sprache und deren Regeln besser beherrschen, damit sie die Männer vernichten kann. Für mich steht diese Vulgarität allgemein für eine Kriegs- und Gewaltsprache.
Im Stück «Herbst der Untertanen» wiederum geht es darum, wer unter den Frauen das Sagen hat. Die saloppe Sprache mit Flüchen und Schimpfwörtern wird von den Frauen benutzt, um sich gegenseitig fertigzumachen. Sprache ist in diesem Stück eine Waffe, die der Unterdrückung und der Manipulation dient.
In Ihrem Roman «Das achte Leben (Für Brilka)» aus dem Jahr 2014 erzählen Sie die Geschichte der Familie Jaschi über sechs Generationen, beginnend im zaristischen Russland. Es folgen die Oktoberrevolution, die beiden Weltkriege, der Stalinismus und die Zeit bis zur Jahrhundertwende. Was hat Sie zu diesem epischen Werk veranlasst?
Erst in Deutschland habe ich gemerkt, dass ich mehr über den Nationalsozialismus weiss als über den Sozialismus. Ich habe erst für mich selbst recherchiert und dabei sehr viel improvisiert. Ich hatte keinen konkreten Plan, sondern bin einfach den Spuren gefolgt. In St. Petersburg habe ich vor allem Zeitungen aus den 1920er bis 1940er Jahren studiert, dadurch habe ich verstanden, wie Propaganda damals funktionierte. In Moskau und Belgrad bin ich in den Archiven auf Informationen über Foltermethoden in der Sowjetunion gestossen. Meine Recherchen dauerten etwa vier Jahre. Damals, zu Beginn der nuller Jahre, konnte man in Russland noch die Menschenrechtsorganisation Memorial und das Sacharow-Zentrum aufsuchen und Informationen einholen. In Tbilissi schliesslich habe ich das gefunden, was die Menschen mit der Sowjetunion verbindet: Kleidung, Gerüche, Geschmack.
Weder in Westeuropa noch im postsowjetischen Raum wurde das Thema Stalinismus aufgearbeitet. Ihr Roman schliesst teilweise diese Lücke. Warum ist das Thema für die Zukunft so wichtig?
Auf einer Seite können Werke über den Stalinismus als Archiv für zukünftige Generationen dienen, um die Komplexität vergangener Ereignisse zu verstehen. Was allerdings noch wichtiger ist: Was heute in Russland passiert und die Rolle von Wladimir Putin dabei – das ist eine Fortsetzung des Stalinismus. Es heisst nur anders. Einzig auf kapitalistischer Ebene sind andere Möglichkeiten entstanden, unter anderem durch die Aufteilung des Staatseigentums in private Hände. Aber im Grunde bleibt das symptomatische System präsent – mit autoritärem Regime, imperialistischer Ideologie, Unterdrückung, absoluter Geschichtsfälschung, und das Lenin-Mausoleum am Roten Platz in Moskau ist auch noch da. Anders gesagt: Die Sowjetunion ist ein Kadaver, der nie begraben wurde.
Wie ist es in Georgien?
In Georgien, einem der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, gibt es so viele Überbleibsel davon. Es gibt Putinismus auf Staatsebene, einen korrupten Clan von Richter:innen, die gesamte Justiz ist verrottet.
Georgien ist seit Dezember 2023 Beitrittskandidat der Europäischen Union. Und viele Menschen wünschen sich eine Zugehörigkeit zur EU. Kann diese Annäherung gelingen?
Es gibt tatsächlich Fortschritte. Die Situation in Georgien ist nicht mit jener in Russland zu vergleichen. In Georgien leben die jungen Leute nicht mehr hinter dem Eisernen Vorhang. Sie sehen und interpretieren die Welt anders, sie teilen die europäischen Werte, allein durch das Internet und den Austausch mit Europa, sei es in Sachen Menschenrechte oder Korruptionsbekämpfung. Doch es gibt noch viel zu tun auf dem Weg in die EU: So ist zum Beispiel das Bildungssystem in Georgien totalitär und sowjetisch geprägt und gehört in dieser Form ebenso abgeschafft wie das Justizsystem. Man lernt nicht das Denken.
Dazu können Sie eine persönliche Geschichte erzählen.
Meine Abschlussprüfung im Jahr 2000 an der Schule in Tbilissi bestand darin, ausformulierte Texte mit bestimmten Zitaten über das Frauenbild des berühmten georgischen Schriftstellers Schota Rustaweli vorzutragen. Ich habe mich geweigert und meine eigene Interpretation der literarischen Figuren präsentiert. Ich bekam eine Verwarnung und eine schlechte Note.
In der georgischen Stadt Gori, der Geburtsstadt Stalins, steht heute noch das Stalin-Museum. Es ist nicht nur ein beliebter Ort für Tourist:innen, es ist auch ein Ort des Stolzes. Was halten Sie davon?
Man ist in Georgien total opportunistisch. Ob Stalin ein Massenmörder war, interessiert die Georgier:innen weniger, als dass er eine Weltfigur georgischer Abstammung war. Ich bin grundsätzlich gegen den Abriss, man soll dieses Museum nicht dem Erdboden gleichmachen und so tun, als hätte es das nie gegeben. Das Problem ist, dass nur eine winzige Tafel über den stalinistischen Terror informiert – der Rest dient einem Kult, der aufhören muss. Natürlich darf dort keine Statue von Stalin mehr stehen, aber es muss ein Museum bleiben. Sowohl das Geburtshaus als auch das furchtbare Museumsgebäude aus den fünfziger Jahren müssen als Zeugnisse der Zeitgeschichte bestehen bleiben und Raum für eine kritische Auseinandersetzung bieten.
Welche neuen Themen beschäftigen Sie, über die Sie in Zukunft schreiben werden?
Ich möchte einen Roman über Migration schreiben. Die Protagonist:innen gehen mir schon seit längerem durch den Kopf. Aber ich bin noch nicht zum Schreiben gekommen. Ein Teil wird natürlich von Georgien handeln, von georgischen Migrant:innen, die zum Teil illegal in Europa arbeiten. Aber ich werde auch verschiedene Aspekte und Schicksale der Migrationsgeschichte untersuchen. Als georgisch-deutsche Schriftstellerin bewege ich mich zwischen verschiedenen kulturellen Welten. Auch davon werde ich erzählen.
Ihre Bücher beinhalten oft schwere Themen. Weinen Sie manchmal beim Schreiben?
Oft weine ich vor Erleichterung, wenn ich ein Buch geschafft habe. Ich kann selbst nicht glauben, dass ich das Schreiben überlebt habe – auf der einen Seite gibt es eine Traurigkeit, auf der anderen Seite die Freude. Und dann kommen die Tränen.
Preisgekrönte Autorin : Meisterin der Details
Nino Haratischwili wurde 1983 in der georgischen Hauptstadt Tbilissi in der damaligen Sowjetunion geboren und ist dort aufgewachsen. Von 1995 bis 1997 lebte sie in Deutschland, weil ihre Mutter mit ihr vor dem Bürgerkrieg in Georgien geflohen war. Dann kehrte sie zurück nach Georgien. Nach ihrem Studium der Regie an der Staatlichen Schule für Film und Theater in Tbilissi zog sie 2003 nach Hamburg, später nach Berlin, wo sie heute mit ihren zwei kleinen Töchtern lebt.
Mit ihrem Romandebüt «Juja» (2010) stand Haratischwili auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ihr Familienepos «Das achte Leben (Für Brilka)» wurde in 25 Sprachen übersetzt und avancierte zum weltweiten Bestseller. Nun machen die Amazon Studios eine Fernsehserie daraus, das Drehbuch schreibt Sarah Lambert («The Messenger», «Lambs of God»).
Haratischwili ist als Autorin bekannt, die dicke Bücher schreibt – bis zu 1300 Seiten stark. Sie ist eine Meisterin darin, kleinste Details zu beschreiben und die Leser:innen so nah an die Geschichte zu bringen, dass man sich direkt an den Schauplatz der historischen Ereignisse versetzt fühlt. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Anna-Seghers-Literaturpreis, dem Bertolt-Brecht-Preis und dem Schiller-Gedächtnispreis. Ihr jüngster Roman, «Das mangelnde Licht», spielt zur Zeit des Zerfalls der Sowjetunion und erschien kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022.
Ende Februar 2024 hatte ihr Stück «Penthesilea. Ein Requiem» am Deutschen Theater in Berlin Premiere, bei dem sie auch Regie geführt hat.