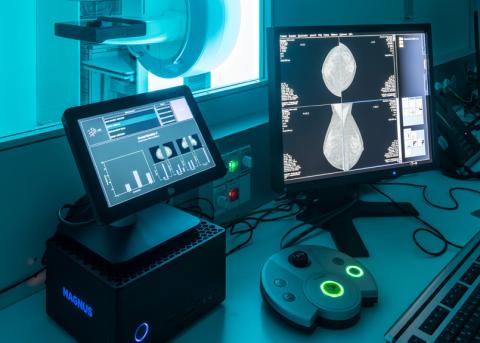Kost und Logis: Menschen in Weiss
Karin Hoffsten über die Patientin als Kundin
Seit sich die Marketingbranche des Medizinalsektors bemächtigt hat, büsst der halbgottähnliche Ärztestand einiges an mythischer Macht ein. Denn während PatientInnen schon vom Wortsinn her Duldende sind, kehrt mit ihrer Verwandlung zu Kunde und Kundin natürlich eine andere Rollenerwartung ein: König und Königin wollen entsprechend behandelt werden. Das Problem ist nur, dass die Marketingabteilung häufig anderes im Sinn hat als die ProtagonistInnen vor Ort.
In einer Facharztpraxis erhielt ich kürzlich ein detailreiches zweiseitiges Merkblatt mit Erläuterungen, die aber mit dem, was mir zuvor der Arzt erklärt hatte, eindeutig nichts zu tun hatten. Als ich auf dem Merkblatt zudem die Personalien einer gänzlich anderen Patientin fand, wurde ich sehr nervös. Doch, doch, sagte man mir auf mein Nachfragen hin, das sei dann schon richtig. Da habe man bloss eine Nummer verwechselt. Bloss eine Nummer? Aha.
Ein anderes Mal sollte mir in der Röntgenabteilung eines Spitals ein Kontrastmittel gespritzt werden. Hier fand sich auf dem entsprechenden Merkblatt über einer Schemazeichnung des Schultergelenks der freundliche Hinweis: «Auf dem untenstehenden Bild wird Ihnen der Radiologe auf Wunsch die Einstichstelle zeigen.» Auf dem Schragen liegend, bat ich darum. Die Assistentin wie auch der Radiologe selbst zeigten sich äusserst erstaunt: Welche Zeichnung? Das Blatt hätten sie noch nie gesehen, und danach habe auch noch nie – wirklich nie! – irgendjemand gefragt. «Ich steche halt ins Gelenk», sagte der Radiologe, «was wollen Sie denn da sehen?»
Für eine Ultraschalluntersuchung musste ich auf die Fachärztin warten. Die freundliche Assistentin bat mich, schon mal die Jeans zu öffnen, anschliessend lag ich zwanzig Minuten mit nacktem Bauch herum.
Als ich die Ärztin nach der Untersuchung vorsichtig darauf ansprach, meinte die: «Also dafür hab ich bei meiner Patientenzahl keine Zeit, wenn ich noch warten muss, bis die alle ausgezogen sind. Dass ich jetzt mit Ihnen überhaupt ein Nachgespräch führe, ist auch keine Selbstverständlichkeit.» Meinen Vorschlag, nackte Bäuche während des Wartens vielleicht mit einem Tuch bedecken zu lassen, nahm sie aber dankend als einer Überlegung wert entgegen.
Zum Glück bin ich grundsätzlich bei guter Gesundheit. Medizinischem Personal begegne ich nach wie vor als gewöhnliche Bürgerin, und die meisten Menschen, auf die ich im Gesundheitssektor treffe, sind liebenswürdig und zuvorkommend, obwohl viele unter Stress und Spardruck leiden.
Doch bei der Vorstellung, einmal wirklich krank und hilflos zu sein und dann die falsche Frage zu stellen, wird mir ziemlich mulmig. Als schwacher Trost bleibt mir nur, dass ich dann wohl auch zu krank und elend sein werde, um langatmige Informationsblätter zu lesen. Ich bin ja offenbar sowieso die Einzige, die das tut.
Karin Hoffsten hofft, noch lange munter und arztfrei in Zürich leben und arbeiten zu können.