Eine Weihnachtsgeschichte: Die gute Tochter

Es war Mittag, und Lou wusste, dass sie Weihnachten verschlafen hatte. Schuld waren Saskia und der kleine Hass. Und vielleicht auch noch der Blumenkohl von Lous Vater. Sie war gestern als Letzte aus dem Büro gegangen, hatte die Kerzen ausgeblasen, Erdnuss- und Mandarinenschalen in den Müll geschmissen, die leeren Flaschen ordentlich in eine Reihe gestellt, das Licht gelöscht. Ausser ihr waren nur noch zwei Kollegen da gewesen, die anderen waren alle schon bei ihren Familien oder Ski fahren, sie hätten schon am Mittag Schluss machen dürfen, aber alle drei hatten einen einsamen Abend vor sich, und so hatten sie zusammen ein paar Biere getrunken und Kerzen angezündet und waren rührselig geworden.
Heute wurde sie von ihren Eltern zum Mittagessen erwartet. Oder wäre erwartet worden. Genau jetzt. Von ihren alten Eltern in deren altem Haus, dessen Geruch sie nicht mehr ertrug. Ein Geruch nach feuchtem Keller, Hund und alter Haut. Früher hatte es bei den Eltern gut gerochen, nach frischer Wäsche und Brotteig, nach Hobelspänen, an denen ein leiser Harzgeruch haftete, und alle paar Samstage nach gemähtem Rasen und Benzin. Nicht an Weihnachten natürlich; die Weihnachtstage rochen nach Tanne, Keksen, Fondue und Geschenkpapier, das im Ofen verbrannte. Doch auch der Weihnachtsgeruch war vorbei, ihr Vater kaufte kein Tännchen mehr auf dem kleinen Markt vor dem Schulhaus, und ihre Mutter holte die Schachteln mit Baumschmuck nicht mehr vom Estrich.
Die Eltern hatten jetzt die Zeit, die sie sich immer gewünscht hatten, und sie hatten beschlossen, nichts damit anzufangen. Sie unternahmen keine Weltreisen und renovierten auch nicht das Haus, es wurde mit ihnen alt und zunehmend gebrechlich, die Wände und Lampenschirme waren vergilbt, Spinnweben und Staub breiteten sich aus wie kleine Nebel, die Fenster waren trüb. Wenn die Eltern nebeneinander auf dem Sofa sassen, den neuen, aber immerzu müden Hund zu ihren Füssen, dann verschmolzen sie mit dem Raum, der seit Jahren nicht mehr richtig hell wurde. Ihre Eltern waren schon immer alt gewesen, die ältesten Eltern in Lous Klasse, sie hatten ein gemeinsames Leben vor Lou gehabt und hatten wieder eines, seit sie ausgezogen war. Sie waren glücklich. Sie lasen Bücher, über die sie sich unterhalten konnten, lasen sie einander sogar vor; in keinem ihrer Beziehungsversuche hätte Lou sich das vorstellen können, ein Buch laut vorzulesen oder beim Vorlesen zuzuhören, etwa im Bett, das war für sie viel zu intim. Die Eltern schauten auch Filme und diskutierten stundenlang darüber. Und sie kochten füreinander. Eine Woche lang kochte Mutter, eine Woche lang kochte Vater, jetzt, zu Weihnachten, war Vater dran, und vielleicht hatte Lou Weihnachten ja deshalb verschlafen wollen. Vaters Augen wurden immer schlechter, und bei einem Besuch im Sommer hatte er einen faden, mit Blattläusen gesprenkelten Blumenkohl aufgetischt. Mutter hatte ihr ins Ohr geflüstert, dass sie bitte nichts sagen und den Blumenkohl einfach essen solle, erstens seien Blattläuse nicht ungesund, und zweitens wolle sie nicht, dass Vater das Kochen wieder aufgebe. Die Blattläuse waren wie alle toten Blattläuse schwarz geworden, Lou versuchte, sich einzureden, es handle sich um Mohn.
Nach dem Büro hatte sie sich auf den Heimweg gemacht. War zu Fuss durch die Stadt gegangen. Sah die Bäume, die in ihren Lichterkettenkokons die Eingänge von Hotels und Banken schmückten, sah hysterische Stadthündchen, die unter den Bäumen Wettpissen veranstalteten. Sah die beleuchteten Sterne, Kugeln und Eiszapfen, die über den Strassen hingen, fragte sich, was die Stadthündchen wohl dachten, wenn sie zufälligerweise ihren Blick von den Hintern anderer Hunde und in Richtung Himmel hoben. Fragte sich, ob der Himmel für Hunde überhaupt eine Bedeutung hatte. Und wie so kleine Tiere eigentlich Menschen wahrnahmen. Ob sie ein Menschenauge als Auge identifizierten und sich bedroht fühlten, wenn sich ein Wesen, dessen Kopf fast so gross war wie sie selbst, zu ihnen herabbeugte. Sie konnte diese Bonsaihunde nicht ernst nehmen. Zum Glück war der müde neue Hund ihrer Eltern grösser. Im Bahnhof ging sie in den Weinladen, den letzten, der noch geöffnet hatte, und suchte nach einem Champagner, sie brachte immer am 25. einen Champagner mit, Mutter würde ihn erst ins Eisfach legen, danach tranken sie ihn gemeinsam und entspannten sich, die Eltern tranken ein Glas, Lou den Rest, das Haus erschien ihr dann wieder heller.
Lou bot ihren Eltern immer wieder ihre Hilfe und die ihrer Putzfrau an, erkundigte sich jede Woche nach Gesundheit und Hund, aber die Eltern wollten alles genau so, wie es war. «Und wenn eins von euch schwer krank wird?», fragte sie, «und wenn eins von euch mal allein ist? Wäre es dann nicht einfacher, wenn die Dinge in Ordnung wären?» – «Sind sie doch», entgegnete Mutter, «alles ist gut. Erstens sterben wir noch lange nicht. Und sollte dein Vater einmal gehen müssen, geh ich auch. Und umgekehrt. Die Dinge sind uns dann denkbar gleichgültig. Du machst damit, was du willst.» Lou wusste, dass alte Menschen das konnten, dieses willentliche Sterben, dieses Aufgeben. Aber sie glaubte nicht daran. «Ihr liebt euch immer noch sehr, oder? Ihr seid gut miteinander», sagte sie. «Glaub mir», sagte Mutter und tippte mit dem Zeigefinger gegen die Stirn ihrer Tochter, «deine Vorstellung von Liebe reicht dafür gar nicht aus!» – «Ach, echt nicht?» – «Wenn ich deinen Vater anschaue, dann sehe ich alles, das ganze Leben, das wir zusammen verbracht haben, den Anfang, der war wie ein ausgedehnter Frühling, das Warten auf dich, die Überforderung, das Glück, die Angst, den Alltag, wie du nach einem grossen Regen neben Vater die Schnecken im Garten eingesammelt hast, wie weh ihm dein Schmerz tat, wenn der Zahnarzt deine Spange nachzog, wie ihr zusammen Schach spieltet, wie erleichtert wir waren, dass du das Gymnasium ohne Drogen überstanden hattest.
Aber vor allem sehe ich meinen Mann und mich, wie wir nie daran gezweifelt haben, dass wir unseren Weg bis zuletzt gehen wollen. An jedem Tag von jedem Jahr, das wir zusammen verbringen dürfen.» Nein, das kannte sie nicht. Es machte sie glücklich für die Eltern und traurig für sich selbst. Sie fragte sich, was sie eigentlich über ihre Eltern wusste. Einmal träumte sie, ihre Mutter habe eine kleine Wohnung in der Stadt und wechselnde Liebhaber und sei ihrer Tochter überhaupt in allem sehr ähnlich.
Lou hatte also eine Flasche Champagner gekauft. Die mit dem Etikett, das Mutter so gut gefiel. Dann betrat sie, ohne zu überlegen, ihre Lieblingsbar. Und stiess dort auf Saskia, die sie lange nicht gesehen hatte. Saskia sah gut aus. Viel zu gut, um Heiligabend allein zu verbringen. Als Lou sie zum letzten Mal gesehen hatte, war vieles an ihr unentschieden gewesen, jetzt stand eine klare, kühle Frau vor ihr. Haarfarbe eisblond, Augenfarbe blau. Die Farben erinnerten an einen Engel, der Rest nicht. Der Rest bestand aus Wangenknochen, einem langen Mantel, Stiefeln. «Du hier? Wie kommts?», fragte Lou und umarmte sie. Saskia roch auch gut. Und fasste sich gut an.
Sie hatte Saskia vor vielen Jahren kennengelernt. Damals arbeiteten sie in konkurrierenden Unternehmen und begegneten sich auf einer Tagung. Ihre Hotelzimmer lagen auf dem gleichen Flur. Schon damals hatte Lou gelegentlich Dinge verschlafen, aber Saskia nie; Lou fragte sie, ob sie ihr eine versäumte Podiumsdiskussion zusammenfassen könne. «Klar», sagte Saskia, «klopf später bei mir.»
Lou hatte sich nichts dabei gedacht und an Saskias Tür geklopft, und dann stand sie da mit feuchtem Haar, das damals dunkler war, und hatte ein Handtuch um sich geschlungen. «Komm rein», sagte sie, und Lou sagte nichts und folgte ihr und sah ihr dabei zu, wie sie im Bad das Handtuch abwarf, sich kurz vor dem Spiegel drehte und in einen übergrossen weissen Bademantel schlüpfte. Lou bewunderte sie dafür, sie kannte so was nur von Frauen in Filmen, aber sie wusste, dass sie keine Lust auf Saskia hatte. Sie stand auf Frauen, die wie das Mädchen aus dem Film vom Bahnhof Zoo aussahen und schmale Handgelenke hatten. Saskia war viel zu gesund. Sie setzte sich Lou gegenüber, erzählte ihr die wichtigsten Punkte des Podiums und schlug dabei ein paar Male die Beine übereinander, auch das kannte Lou nur aus Filmen. Beide erwähnten Saskias vergebliches Angebot nie. Doch als Lou sie jetzt in der Bar sah, roch und spürte, war sie sich sicher, einen Fehler gemacht zu haben. Vielleicht wäre Saskia eine für eine Nacht gewesen. Vielleicht auch eine für länger.
«Ich fahr morgen früh nach Rom, ich lass Weihnachten aus», sagte Saskia. «Solltest du nicht bei deiner Familie sein? So wie ich, die gute Tochter?», fragte Lou. – «Meine Brüder übernehmen das», gab Saskia zurück, «die haben auch die passenden Enkelkinder zu bieten. Apropos gutes Kind: Meinst du, Jesus war eines?» Lou musste lachen. «Der? Wurde bereits pränatal als hochbegabt eingestuft, wusste als Kind alles besser, wurde früh zum Sektenführer, war vom Staat gesucht und wurde mit dem Tod bestraft. Keine Eltern, die halbwegs bei Sinnen sind, möchten sich heute einen Jesus aufbürden! All die Greta Thunbergs reichen völlig!» – «Greta ist gut», sagte Saskia, «aber ich weiss, was du meinst. Waren wir eigentlich auch so fordernd damals? So rechtschaffen? Waren wir nicht! Fuck Christmas.» – «Fuck Christmas», sagte Lou. Sie tranken, redeten und lachten viel; verstohlen betrachtete Lou sich und Saskia im Spiegel über der Bar, zwei im gleichen Alter, dachte sie, aber ihre gute Zeit war schon fast um, während sie für Saskia soeben angebrochen war. So lief das im Leben.
«Und nun», sagte Saskia, «füttern wir den kleinen Hass.» Der kleine Hass hiess Lana Lau, lebte in Hongkong, hatte ein Gesicht, eine Ausbildung und zu allem eine Meinung. Der kleine Hass war ein Avatar, den Saskia mit einem Freund entwickelt hatte. Er entwertete Dinge und Menschen und vernichtete seine eigenen digitalen Spuren innerhalb von Mikrosekunden. Lana Lau trollte sich auf Facebook, Instagram, Tripadvisor und unzähligen weiteren Foren. Saskia suchte nach ein paar öffentlich zugänglichen Profilen, setzte grün kotzende Emojis unter vegane Weihnachtscupcakes, eine skandinavische Kerzenmanufaktur und einen sichtlich verjüngten TV-Moderator, hinterliess Totenköpfe, explodierende Einhornschädel, Bomben, Messer, Pistolen, Blutstropfen, Särge und aggressive Kommentare. Hasste, was andere herzten und hypten. «Beste Psychohygiene!», sagte sie, «es kann auf der Welt gar nicht so viel Wertschätzung geben, wie den Leuten immer abverlangt wird.» – «Genau», sagte Lou und dachte an all die Jahre ihres Lebens, in denen so was nie nötig gewesen war. Und an die Jahrzehnte im Leben ihrer Eltern, in denen kein Mensch nach dem Verlassen eines Restaurants oder einer öffentlichen Toilette dazu gezwungen worden war, seine Erfahrung zu bewerten. Niemand hatte nach der Zuckerwatte unmittelbarer Bestätigung verlangt. «Elende Heuchelei», sagte Saskia, «die nur dazu gut ist, den Menschen im Kapitalismus geschmeidiger zu machen.»
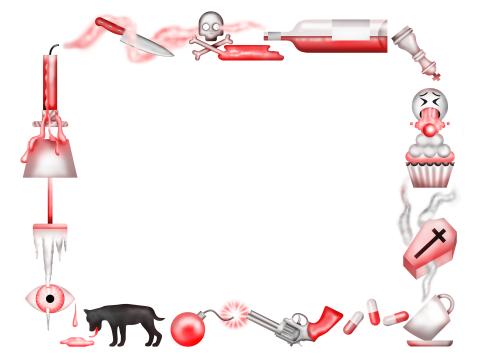
Lou war viel zu betrunken, um Saskia darauf hinzuweisen, wie lächerlich es war, wenn die überbezahlte Mitarbeiterin einer Techfirma den Rest ihres Gewissens in ein paar böse Emojis investierte. Ich sollte heim, dachte Lou, ich muss bald zu den Eltern, aber Lana Lau war lustig, und die Möglichkeit von Saskia war wie jede Möglichkeit verlockend. Schliesslich war Weihnachten, da hatte man sich etwas Schönes doch verdient. Irgendwann drehte der Kellner die Musik ab und machte das Licht aus, irgendwann standen sie vor der Tür, die Fenster der umliegenden Häuser waren dunkel, die Weihnachtsbäume schlafen jetzt, dachte Lou. Die Eiszapfen, Sterne und Kugeln über der Strasse streuten ihren Lichterschnee über Saskia. Alles vor Lou verschmolz zu einem weichen, warmen Strahlen, und dankbar verlor sie den Durchblick.
Jetzt lag sie zu Hause in ihrem Bett, drehte vorsichtig den schmerzenden Kopf, doch es gab nicht die geringste Spur, die ihr Alleinsein widerlegt hätte. Saskia war nicht mitgekommen. Sie musste sich bereits auf dem Weg nach Rom befinden. Lou suchte nach ihrem Handy, sie wollte sich bei den Eltern entschuldigen, sie würden verstehen, Lou könnte sie an einem der nächsten Tage zum Kaffee besuchen oder auch gar nicht, die beiden waren sich schliesslich selbst genug, und Weihnachten war für sie nur noch irgendein Tag. Da sah sie, dass ihre Mutter sie vor drei Stunden von ihrem Handy aus angerufen hatte. Sie wusste genau, dass ihre Mutter das Handy zu Hause nicht benutzte. Wo war sie?
Sie rief zurück, hörte den Klingelton, dann ein Knistern, als würde ein Geschenk geöffnet, «Frohe Weihnachten!», sagte sie ins Knistern hinein; wenn sie sich Mühe gab, eine kalte Dusche nahm, Kaffee und ein paar Tabletten schluckte, könnte sie es noch schaffen und in etwas mehr als einer Stunde bei ihren Eltern sein. Bei Mutter, Vater, Hund und Haus. «Mama?», fragte sie und glaubte zu hören, wie ihre Mutter versuchte, ihre Stimme einem grossen Weinen zu entreissen. Einem Weinen, das Tage dauern könnte oder Monate und dann samt seiner Quelle versiegen würde. «Mama?», sagte sie wieder, «hörst du mich?» Die Verbindung brach ab. Gewiss täuschte sie sich. Mutter stand nicht mit einem gebrochenen Fuss allein im Wald. Mutter sass nicht in einem Spital und wartete auf den Bescheid der Ärzte, die ihr sagen würden, dass Vater mit einem Fuss im Grab stand. Wahrscheinlich war Mutter vor drei Stunden mit dem Hund spazieren gegangen, um nicht von Vaters Kochkünsten gestört zu werden, und irgendwas in ihrer Tasche hatte versehentlich den Anruf ausgelöst. Und jetzt war sie immer noch unterwegs, und der Empfang war schlecht. Oder die Eltern wollten ihr mitteilen, dass sie nicht zu kommen brauche, dass sie sich spontan für eine Fahrt in die Berge entschieden hätten. So musste es sein. Die Dinge waren in Ordnung. Ihre Mutter war noch nicht einsam. Ihr Vater auch nicht. Nur das Kind.
Die Autorin
Simone Meier (51) lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Zürich. Begonnen hat sie 1996 bei der WOZ, heute ist sie Kultur- und Gesellschaftsredaktorin beim Onlineportal «Watson». Ihre Romane «Fleisch» (2017), «Kuss» (2019) und «Reiz» (2021) über das Lieben und Leben von Menschen in einer Stadt wie Zürich sind bei Kein & Aber erschienen.

