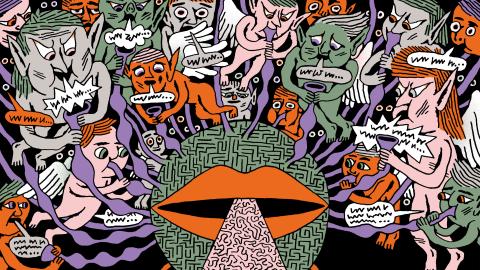Stromfresser KI
Wie misst man den Fußabdruck von ChatGPT?
Eine ChatGPT-Anfrage verbraucht, heißt es, 2,9 Wattstunden Energie. Das ist etwa so viel Strom, wie eine Mikrowelle in 12 Sekunden verbraucht, und zehnmal so viel wie eine Google-Suche. Diese Zahlen werden in den Medien immer wieder genannt. Man konnte aber auch lesen, dass ChatGPT nur sechsmal1 oder viermal2 so viel verbrauche wie eine Google-Suche. Oder auch: ungefähr genauso viel.3 Welche Zahl stimmt nun?
Klar ist eigentlich nur eines: ChatGPT verbraucht viel Energie. Für seine Antworten muss der Dienst Elemente aus gigantischen Datenbanken kombinieren und benötigt dafür eine entsprechend große Recheninfrastruktur. Es ist jedoch äußerst schwierig, den Energiebedarf jeder einzelnen Nutzung genau zu quantifizieren. Der Stromverbrauch für eine bestimmte Anfrage hängt von einer Vielzahl von Variablen ab: dem verwendeten KI-Modell, der Komplexität der Anfrage und dem Rechenzentrum, bei dem die Anfrage ankommt.
Der dadurch verursachte Ausstoß von CO2 unterscheidet sich je nach Stromquelle und variiert nicht nur von Ort zu Ort, sondern auch von Tageszeit zu Tageszeit. Viele dieser Faktoren sind auch gar nicht genau zu ermitteln: OpenAI, das Unternehmen, das ChatGPT betreibt, gibt weder die Anzahl der Parameter seiner neuesten Modelle bekannt, noch in welchen Rechenzentren es die Anfragen seiner Nutzer:innen bearbeitet, noch welche Energiequellen zur Versorgung seiner Infrastruktur verwendet werden.4
Wie viel Energie eine ChatGPT-Anfrage tatsächlich verbraucht, bleibt also im Dunkel. Und die Schöpfer des Chatbots können ziemlich sicher sein, dass da niemand Licht reinbringen wird.
Das Geheimnis, das OpenAI umgibt, ist kein Einzelfall. Alle wichtigen Akteure im Bereich der künstlichen Intelligenz verschanzen sich hinter einem Verweis auf Betriebsgeheimnisse, um so wenig Informationen wie möglich über die energetischen und im weiteren Sinne ökologischen Auswirkungen ihrer Technologien preiszugeben.
Noch 2022 veröffentlichte Google einen Artikel, dem zufolge zwischen 2019 und 2021 das maschinelle Lernen 10 bis 15 Prozent seines gesamten Energieverbrauchs ausmachte.5 Nach der Veröffentlichung von ChatGPT Ende November desselben Jahres schränkten die Unternehmen der Branche jedoch die Herausgabe von Information an die Öffentlichkeit und an unabhängige Forscher drastisch ein.
Das gilt auch für den Halbleiterriesen Nvidia. Es ist unmöglich, den CO2-Fußabdruck seiner Prozessoren zu erfahren oder wie schnell die Chips durch neue ersetzt werden müssen. Und dies, obwohl sie zu Zigtausenden in den großen Rechenzentren verwendet werden, die den Siegeszug der KI ermöglicht haben.
Die Techgiganten mussten immerhin zugeben, dass sie ihre angekündigten Klimaziele wahrscheinlich nicht einhalten können. Laut dem letzten Umweltbericht von Microsoft haben sich dessen „reale“ Treibhausgasemissionen – also die durch das Unternehmen verursachten Emissionen ohne Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen – zwischen 2020 und 2024 mehr als verdoppelt.6
Die digitale Industrie kann daher bislang nicht auf fossile Energieträger wie Kohle und Erdgas verzichten. In den USA befinden sich viele Rechenzentren in Virginia, West Virginia und Pennsylvania, also in Bundesstaaten, in denen erneuerbare Energien kaum zur Verfügung stehen. Dass Technologieunternehmen verstärkt in Atomkraft investieren, weist darauf hin, dass der Energiebedarf in Zukunft weiter steigen wird. So soll etwa das alte AKW Three Mile Island wieder in Betrieb genommen werden, nachdem ein neuer Betreiber einen Stromliefervertrag mit Microsoft abgeschlossen hat. Das Unternehmen will die gesamte Stromproduktion eines der Reaktoren für seine KI-Infrastruktur nutzen.7
Die Branchenriesen versuchen nicht nur ihren ökologischen Fußabdruck zu verschleiern. Sie verfolgen noch eine zweite Strategie: Manager wie Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) und Eric Schmidt (ehemals Google) behaupten, KI werde langfristig die Probleme der globalen Erwärmung lösen.8 Am Ende seien die Treibhausgasemissionen, die durch die aktuellen KI-Aktivitäten verursachten werden, ein guter Deal für den Planeten.
In Wahrheit gibt es große Unterschiede zwischen solchen Formen der künstlichen Intelligenz, die gewisse Vorteile für die Umwelt bringen können – etwa bei der Berechnung von Klimamodellen oder der Optimierung bestimmter Prozesse –, und solchen, deren Entwicklung zur Explosion des Energieverbrauchs in diesem Sektor führt. Zu behaupten, dass ein allgemeines generatives KI-Tool wie ChatGPT zur Bekämpfung der globalen Erwärmung beitrage, ist nichts als ein schlechter Scherz.
Um zumindest etwas Licht ins Dunkel zu bringen, bemühen sich verschiedene Akteure darum, den energetischen Fußabdruck der KI zu messen. Aktivisten und Außenseiter aus der Industrie sammeln und veröffentlichen Zahlen nach dem Motto „was man nicht messen kann, kann man nicht verändern“, das dem Physiker Lord Kelvin (1824–1907) zugeschrieben wird. Um den Energieverbrauch der KI zu senken, müsse man ihn zunächst einmal quantifizieren.
Der niederländische Wissenschaftler Alex de Vries beispielsweise betreibt seit 2014 eine Website namens Digiconomist, um die Auswirkungen von Bitcoin auf die Umwelt zu dokumentieren. Von de Vries stammt auch die Schätzung, dass ChatGPT zehnmal mehr Strom verbraucht als die Suchmaschine von Google.9 Er veröffentlichte sie 2023, und sie wurde von der Internationalen Energieagentur (IEA) übernommen.10 In einem neueren Artikel schätzt de Vries, dass KI bereits so viel Strom wie die gesamte Schweiz benötigt und bald 50 Prozent des Stromverbrauchs von Rechenzentren weltweit ausmachen wird.11
Die Denkfabrik The Shift Project, die auf Initiative des Ingenieurs Jean-Marc Jancovici gegründet wurde, nennt ähnliche Zahlen. Datenzentren könnten demnach in einigen Jahren für 2 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sein, allein die Hälfte davon durch KI.12
Eine Koryphäe auf diesem Gebiet ist die kanadische Informatikerin Sasha Luccioni. Als Klimaforscherin für das französisch-amerikanische Unternehmen Hugging Face, das Open-Source-KI im Gegensatz zu den proprietären Modellen der Branchenriesen entwickelt, zeigte sie 2023, dass der CO2-Fußabdruck von KI unter Berücksichtigung aller Schritte von der Herstellung der nötigen Geräte bis zur Endnutzung doppelt so groß ist wie bisher angenommen.13
2024 wurde Luccioni vom Time Magazine als eine der „100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich KI“ eingestuft. Sie nutzt heute ihre Bekanntheit, um auf den Mangel an Transparenz bei großen Technologieunternehmen aufmerksam zu machen und für die Entwicklung von energiesparenden KI-Modellen einzutreten.
Die Grenze der numerischen Aufklärung
Die Messungen von Digiconomist, The Shift Project, Hugging Face und anderen bilden nicht nur ein Gegengewicht zur irreführenden Rhetorik der Industrie. Sie führen auch zum kritischen Nachdenken über die Folgen dieser Flut von widersprüchlichen und wissenschaftlich fragwürdigen Zahlen.
Methodisch ist die Quantifizierung des Energieverbrauchs und des CO2-Fußabdrucks der KI allein schon deshalb schwierig, weil selbst der Umfang dessen, was gemessen werden soll, umstritten ist. Wo fängt KI an und wo hört sie auf? Müssen die Emissionen bei der Herstellung von Prozessorchips berücksichtigt werden? Und der Ressourcen- und Energieverbrauch beim Bau der Gebäude, in denen die Rechenzentren untergebracht sind? Und rechnet man die Klimafolgen von schädlichen Aktivitäten wie der Ölförderung ein, die durch KI effizienter werden?
Darüber hinaus führt die Verdunklungstaktik der Industrie dazu, dass Wissenschaftler:innen sich auf Schätzungen und näherungsweise Angaben beschränken müssen. Ungenauigkeiten werden dann wiederum von den Lobbys der Industrie aufgebauscht, um die Verlässlichkeit der Studien in Zweifel zu ziehen. Und nicht zuletzt drängt die Fokussierung auf den CO2-Fußabdruck andere entscheidende Umweltfragen im Zusammenhang mit KI oft in den Hintergrund, etwa den Wasserverbrauch, die Folgen des Abbaus der benötigten Rohstoffe und die entstehenden Abfälle.
Die Versuche, den CO2-Fußabdruck von KI zu quantifizieren, werfen jedoch eine noch grundlegendere Frage auf, mit der sich Aktivist:innen aus globalisierungskritischen, ökologischen, feministischen und antirassistischen Bewegungen seit Jahrzehnten auseinandersetzen: Wie wirksam sind Zahlen, um der Öffentlichkeit das Ausmaß eines Problems bewusst zu machen?
Die Befürworter der numerischen Aufklärung folgen mehr oder weniger bewusst dem Glauben, dass die Verbreitung von Informationen positive soziale Veränderungen bewirkt. Sobald die Nutzer:innen über den Stromverbrauch von KI aufgeklärt sind, so die Annahme, werden sie auf unnötige, energieintensive Anwendungen verzichten. Unternehmen würden ihrerseits sparsamere und auf die Bedürfnisse der Konsument:innen zugeschnittene IT-Lösungen anbieten, und auch die Regulierungsbehörden würden ihre Maßnahmen anpassen.
Auch Luccioni setzt bei ihrem Engagement auf solche Überlegungen: Wenn die Öffentlichkeit nur wüsste, wie viel Energie jede Anfrage verbraucht, würden die Menschen doch „eher zögern, KI für überflüssige Aufgaben wie die Suche nach der Hauptstadt eines Landes einzusetzen“.14 In diesem Zusammenhang entstand die Idee, einen Öko-Score für KI einzuführen, ähnlich dem Energielabel für Haushaltsgeräte, dem Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen oder den Angaben zum Kraftstoffverbrauch von Autos. Dadurch, so die Annahme, würden die Verbraucher:innen zu einem nachhaltigeren Konsum angeregt.
Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt allerdings, dass allein das Vorhandensein von Informationen nicht automatisch zu Veränderungen im Verhalten der Menschen führt: Der mit Zahlen belegte und etablierte wissenschaftliche Konsens über die globale Erwärmung und deren Folgen hat nicht zu einem Rückgang von Flugreisen innerhalb Europas geführt. Der warnende Nutri-Score hat etwa die Menschen in Frankreich nicht davon abgehalten, ihren Konsum von Kartoffelchips in zehn Jahren um 42 Prozent zu steigern. Und das Wissen darüber, dass ein SUV im Schnitt 15 Prozent mehr Kraftstoff verbraucht als ein normales Auto, hat nicht verhindert, dass immer mehr solcher Fahrzeuge gekauft werden.
Unter den Befürwortern einer Quantifizierung des ökologischen Fußabdrucks von KI ist zudem der Glauben an die Selbstregulierung der Märkte verbreitet. Damit sie funktioniert, müssten nur alle Beteiligten über die nötigen Informationen verfügen. Doch bei anderen Problemen – wie bei der globalen Erwärmung oder der Umweltverschmutzung durch chemische Abfälle – hat die Regulierung durch den Markt kläglich versagt.
Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum dies bei der KI besser sein sollte. Schließlich hängt hier die Entwicklung weniger von den Forderungen der aufgeklärten Nutzer:innen ab als vielmehr von den Tech-Akteuren, die ihre Anwendungen in alle Wirtschaftsbereiche und Aufgaben des täglichen Lebens integrieren wollen. Schädlichen und gefährlichen Produkten oder Dienstleistungen erst einen uneingeschränkten Zugang zum Markt zu ermöglichen und dann darauf zu setzen, dass diese von den Konsument:innen nur in Maßen genutzt oder ganz abgelehnt werden, ist schlicht eine absurde Idee. Sie geht von einer Rollenverteilung aus, deren Ineffizienz heute nicht mehr zu übersehen ist: den Unternehmen und Investoren die Freiheit, den Kunden die Verantwortung.
Entscheidend ist mithin tatsächlich die Regulierung. In Umweltbelangen verlangt das EU-Recht von den Wirtschaftsakteuren die Veröffentlichung von Daten über die Auswirkungen ihrer Aktivitäten. So verpflichtet etwa die EU-Richtlinie zur Energieeffizienz (EED) große Datenzentren zur Schaffung von Bewertungs- und Überwachungssystemen, um ihren Energieverbrauch in einer gemeinsamen Datenbank zu dokumentieren.
Diese Entwicklung ist ein Schritt in die richtige Richtung, zeigt aber vor allem einen Wandel im Rechtsverständnis. Die Gesetze dienen nicht mehr dazu, Wirtschaftsakteure zu etwas zu zwingen, beispielsweise durch Obergrenzen für den Energieverbrauch, sondern die Marktinformation zu verbessern. Anstatt schädliche Praktiken zu verbieten, verlangt die EU bloß, dass sie transparent sind.
Die Quantifizierung des energetischen Fußabdrucks der KI ist daher ein Unterfangen, dessen Nutzen für die Umwelt ungewiss ist. Das ist natürlich kein Grund, diese Versuche aufzugeben, aber man sollte sich der Grenzen dieses Ansatzes bewusst sein. Im Kampf gegen die Macht der großen Techkonzerne sind Zahlen nur ein Werkzeug unter vielen.
1 Sasha Luccioni, „We still don’t know how much energy AI consumes“, The Financial Times, 20. Mai 2025.
2 Kaye Crawford, „Generative AI’s environmental costs are soaring – and mostly secret“, Nature, 20. Februar 2024.
3 Josh You, „How much energy does ChatGPT use?“, Epoch AI, 7. Februar 2025.
4 James O’Donnell und Casey Crownhart, „We did the math on AI’s energy footprint. Here’s the story you haven’t heard“, MIT Technology Review, 20. Mai 2025.
5 David Patterson und andere, „The Carbon Footprint of Machine Learning Training Will Plateau, Then Shrink“, Computer, Juli 2022.
6 „Environmental Sustainability Report. Accelerating progress to 2030“, Microsoft, 2025
7 Siehe „Why Microsoft made a deal to help restart Three Mile Island“, MIT Technology Review, 26. September 2024.
8 Troy Wolverton, „AI boosters’ climate claims warrant skepticism, critics argue“, San Francisco Examiner, 26. Mai 2025.
9 Alex de Vries, „The growing energy footprint of artificial intelligence“, Joule, 18. Oktober 2023.
10 „Electricity 2024. Analysis and forecast to 2026“, IEA-Bericht, Januar 2024.
11 Alex de Vries-Gao, „Artificial intelligence: Supply chain constraints and energy implications“, Joule, Mai 2025.
12 „Intelligence artificielle, données, calculs. Quelles infrastructures dans un monde décarboné?“, The Shift Project, März 2025.
13 Sasha Luccioni, Sylvain Viguier und Anne-Laure Ligozat, „Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model“, Journal of Machine Learning Research, Bd. 24, Cambridge 2023.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert
Sébastien Broca ist Dozent für Informations- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Paris VIII und Autor von „Pris dans la toile. De l’utopie d’Internet au capitalisme numérique“, Paris (Seuil) 2025.