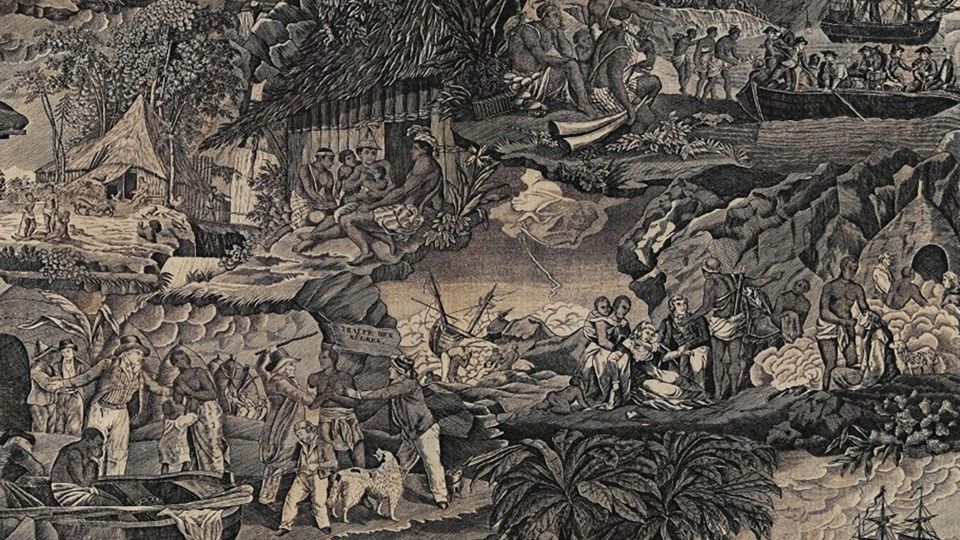Durch den Monat mit Fitzgerald Crain (Teil 3) : Wie können Lehrpersonen entlastet werden?
Fitzgerald Crain hält die frühe Selektion in der Schule für falsch. Er engagierte sich für eine Schulreform in Basel, die gelang – und doch rückgängig gemacht wurde. Trotz solcher Rückschläge hat er die Hoffnung nicht verloren.