Literatur: Croissants für 48 Dollar
Ein komplexes Stück Literatur: Der düstere New-York-Roman «Auflösungen.» von Marlene Streeruwitz ermöglicht ganz unterschiedliche Deutungen.
Eine Wiener Lyrikerin kommt für ein Semester nach New York – nicht zum ersten, aber vielleicht zum letzten Mal. Für Nina Wagner, 56 Jahre alt, ist die Reise auch eine Flucht: vor dem trinkenden Exmann, dem verlorenen Liebhaber und der entfremdeten Tochter. Um dieses Szenario dreht sich «Auflösungen.», der neue Roman von Marlene Streeruwitz. Er spielt im Frühjahr 2024, also einen Schritt vor der Gegenwart. Und da findet die Protagonistin ihr New York nicht wieder.
Rastlos läuft sie durch die Strassen. Doch das richtige Gefühl will sich nicht einstellen. Nichts scheint zu stimmen: der Rhythmus nicht, die Häuser und Menschen auch nicht. «New Yorkers are walkers»? Nicht mehr wirklich, seit die Blicke sich nur noch auf die Smartphones senken. «Standing Still and Walking in New York» ist der erste, längere Teil des Romans trotzdem überschrieben. In kurzen, harten Sätzen erzählt er von wenigen Tagen aus Nina Wagners Leben. Nimmt der Roman im sprachlichen Stakkato das Tempo der Stadt auf? Oder die Anspannung der Protagonistin? Worauf zielt dieser Sound, der als Markenzeichen der Autorin gilt?
Ist noch jemand wach?
Man kann diesen Roman auf mindestens drei Arten lesen. Zum einen als Erneuerung eines bewährten Genres, dem es schon immer um das Grosse und Ganze ging: der Kulturkritik. Mit den Augen und Ohren der Lyrikerin beobachten wir den Verfall einer Stadt, die immer teurer wird. Zwei «Croissants mit Lachs. Zwei Americanos klein» auf die Hand macht 48 Dollar. Wagner wird von der Universität bezahlt, ihre Künstlerfreund:innen haben geerbt oder können sich die Stadt nicht mehr leisten. In manchen Strassenzügen ist es schmutzig. Ratten. Abrissbuden. Irgendwann werden dann neue Hotels entstehen.
Es ist mehr als die New Yorker Kunstszene, in der sich die titelgebenden «Auflösungen» abzeichnen. Gleich zu Beginn wird die rigide Einwanderungspolitik vorgeführt. Nina Wagner erlebt sie bei ihrer eigenen Einreise. Eine unbekannte Frau liegt am Boden, niemand kümmert sich um sie, auch Wagner nicht. Alle laufen um den unbeweglichen Körper herum, steigen drüber, schauen weg. Das Wegsehen ist Teil des Desasters, das sich anbahnt. Trump ist noch nicht wieder an der Macht, sein Name fällt trotzdem 31 Mal.
Von wem kommt die Kritik? Ist überhaupt noch jemand wach und hellhörig? Oder löst sich nicht nur die Stadt auf, sondern die Subjekte gleich mit? Das wäre eine zweite, düstere Lesart. Mit den Fragen des Älterwerdens und Sterbens beschäftigt sich nicht nur die Protagonistin. Manche in ihrem Umfeld verlassen die Wohnung nicht mehr. Andere sind dem Alkohol verfallen. Eine Freundin mit einem Miniapartment hätte ihr Heim um ein Haar für einen chauvinistischen Trinker aufgegeben; nun telefoniert sie regelmässig mit ihm.
Im zweiten Teil des Romans landet Wagner in der Notaufnahme: «Meditations in an Emergency». Jetzt liegt sie selbst am Boden, wie die namenlose Frau am Flughafen, ist verwirrt, wird nur halb versorgt, in ein Krankenhaus gebracht, allein gelassen, die blutende Kopfwunde nicht behandelt. Sie wartet, sie türmt. Ihr Foto erscheint auf Social Media, die Rede ist von Drogenmissbrauch. In Wien verschwindet ihr Exmann. Am Ende des Romans ist er tot. Wagner findet in ihr Apartment am Washington Square zurück – und bekommt ihren Rucksack samt Pass und Schlüssel wieder. Ein Happy End ist das trotzdem nicht.
Nicht aufzulösende Spuren
Spielerischer wäre ein dritter Zugang: Mit «Auflösungen» wären demnach die eines Rätsels gemeint. Der Plural im Titel spräche für diese Version. Wieder stünde New York im Zentrum, diesmal als literarischer Erinnerungsort. Die Gegenwart spiegelt sich in den Romanen und Erzählungen des 19. Jahrhunderts, auf die Namen und Orte verweisen. Das beginnt beim geografischen Mittelpunkt des Romans: «Washington Square» heisst ein New-York-Roman von Henry James. Auch da geht es um soziale Unterschiede, um Liebe und Betrug. Mr. Sloper, ein reicher New Yorker, verweigert dort seiner Tochter die Erbschaft aus Sorge, sie könnte diese an einen betrügenden Taugenichts verlieren.
Bei Marlene Streeruwitz taucht dann eine Mrs. Sloper auf, Gladys mit Vornamen: Sie wohnt mit ihrer Partnerin im gleichen Wohnblock wie Wagner – und trägt zu den Verwicklungen bei. Und was ist mit dem faulen Schreiber Bartleby, der in Herman Melvilles Erzählung «Bartleby der Schreiber» nach eifrigem Start die Arbeit in einem Büro an der Wall Street verweigert? Tut Wagner es ihm gleich, wenn sie ihre Mailbox überlaufen lässt, auf Post ihres Instituts nicht mehr reagiert?
Marlene Streeruwitz’ New-York-Roman, nominiert für den Österreichischen Buchpreis, ist ein komplexes Stück Literatur. Der Text sei vor allem autobiografisch, hiess es immer wieder, weil die Autorin die Stadt aus eigener Erfahrung kenne. Ein altes Deutungsmuster: Frauen schreiben über sich selber, Männer über die Welt. Dabei ist es oft genug gerade andersherum. Man muss den Spuren nur folgen – gerade dann, wenn sie sich nicht auflösen lassen.
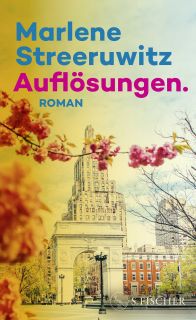
Die Autorin liest am Dienstag, 21. Oktober 2025, um 19.30 Uhr im Coalmine Café in Winterthur und nimmt am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 19 Uhr an einer Diskussion im sogar Theater in Zürich teil.

