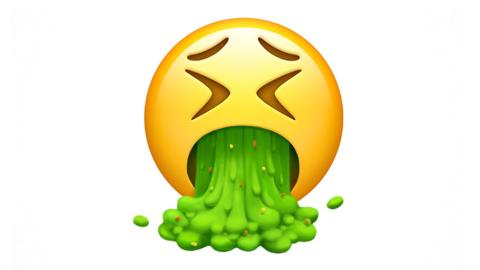Sommerferien: Die Früchte unserer Arbeit
In einem rätselhaften Land fragwürdiger Schönheit, eingeklemmt zwischen zwei Schnellstrassen, liegen direkt nebeneinander zwei bedeutende Institutionen: das Vögele-Kultur-Zentrum, eine Art Museum, das sich mit den grossen Fragen der Gesellschaft beschäftigt, und das Alpamare, der grösste Wasserpark der Schweiz. Wir befinden uns in Pfäffikon SZ. Es ist Sommer, Ferienzeit also, in der viele von uns sich zurücklehnen können, sich entspannen, sich ungezwungen den eigenen Interessen widmen und sich vielleicht sogar fragen: Wieso können wir das nicht öfter?
Pfäffikon verspricht Antworten. Wer dem Ruf der Sirenen nicht nachgibt, der nebenan in Form des Geschreis von ins Wasser rutschenden Kindern ertönt, kann sich bei Vögele derzeit eine Ausstellung zum Thema Arbeit anschauen. «Vom Wollen, Dürfen und Müssen», so der Titel. Es gelingt ihr, in fünf Ausstellungsbereichen fast jegliche politische Dimension der, wie man meinen könnte, eigentlich recht politischen Materie zu umgehen. Arbeit heute, das ist in dieser Vögele-«Erlebnislocation» vor allem eine Frage von Trends und Innovationen, die ganz individualistisch «die Balance zwischen beruflicher Erfüllung und persönlichen Bedürfnissen» neu gestalteten.
Die Ausstellung ist trotzdem interessant, quasi als Metainszenierung, weil sie verdeutlicht, wie weit sich der politische Diskurs um Lohnarbeit und Freizeit vom ihm zugrunde liegenden Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital entfernt hat. Und genau in dieser Individualisierung findet sich vielleicht die Antwort auf die Frage, warum wir nicht mehr Ferien machen dürfen.
Denn individuell wurden solche Fortschritte noch nie erkämpft. Die Forderung, so schreibt die Ferienhistorikerin Beatrice Schumacher, sei im Anschluss an den Landesstreik 1918 in den Fokus des Arbeiter:innenkampfs gerückt. Die Schweizer Reisekasse, heute als Reka bekannt, sollte ursprünglich «Genossenschaft Arbeitsfrieden» heissen. Auf erste Ferienregelungen in Gesamtarbeitsverträgen folgten nach dem Zweiten Weltkrieg erste kantonale Mindestvorgaben. In der Regel sahen sie mindestens eine Woche vor. Erst 1966 verankerte der Bund das Recht auf zwei bezahlte Ferienwochen im damals neuen Arbeitsgesetz.
Das zeigt mal wieder: Alles, was Spass macht, musste einst gegen rechts erkämpft werden. Als die Partei der Arbeit 1961 in Zürich eine Initiative lancierte, die drei mickrige Ferienwochen forderte, warnte der Regierungsrat vor deren Folgen für die Wirtschaft. Der Vertreter des Gewerbeverbands, Kantonsrat Werner Leutenegger, bezeichnete die Forderung im Kantonsrat als «Wahlköder der Kommunisten» und «ungesundes sozialpolitisches Experiment». Die Stimmbevölkerung lehnte die Initiative ab.
Dass sich die Ferien, wenn auch immer noch viel zu knapp, trotz all der Angst um Wohlstand und Disziplin im Lauf der Jahre durchsetzen konnten, liegt freilich nicht nur am linken Kampf, sondern auch an liberalem Eigennutz. Schon 1952 räumte der Zürcher Regierungsrat ein, dass Ferien «der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers» dienen könnten.
Ja, es stimmt: Urlaub, Tourismus, Freizeit und Müssiggang sind kein Ausbruch aus kapitalistischer Verwertungslogik. Natürlich bleiben wir Hamster im Rad, wenn wir im Maggiatal auf enorm unbequemen Felsen sitzend und mit überteuerter Sonnencreme im Auge fieberhaft Arbeitspläne und Maileingänge zu vergessen versuchen. Das Machtverhältnis liegt tatsächlich schon im Begriff: «Urlaub» kommt von «erlaubt».
Diese Erlaubnis soll man sich auch selbst erteilen. Zwar dürften manche Leser:innen der WOZ damit hadern, sich angesichts des hier wöchentlich dokumentierten Elends auf der Welt eine Auszeit zu gönnen – und für einmal nicht jede erdenkliche moralische Implikation ihres Handelns mitzudenken. Aber auch diese Art der Leistungsfähigkeit bedarf zwischendurch der Wiederherstellung.
Und damit zurück zur schicksalhaften Weggabelung in Pfäffikon SZ: hier die neoliberale «Erlebnislocation», dort das reine Vergnügen. Die WOZ macht nun zwei Wochen Pause – wählen Sie mit Bedacht!