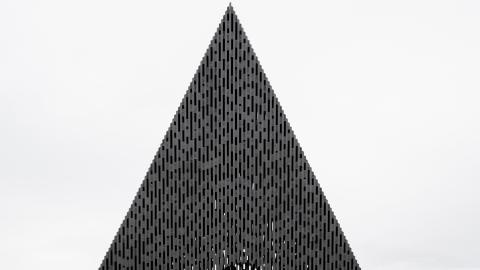Die Arbeit ist die Kunst, das Leben
Seit ich ein Kind erwarte, mache ich mir Sorgen um meine berufliche Zukunft. Wie wird das nur gehen, alle meine verschiedenen Jobs unter einen Hut zu bringen und weder unter Dauerstress zu stehen noch im Abseits zu versinken? Solche Ängste erscheinen in unserer Gesellschaft als total «normal» - so normal, dass einer ihrer Effekte der Kinderschwund ist. Schliesslich muss jetzt nicht nur regelmässig Geld angeschafft werden, sondern man ist auch nicht mehr rund um die Uhr belast- und verfügbar. Gerade im Kunstbereich ist das jedoch das oberste Kriterium - dementsprechend wenig erfolgreiche Frauen haben da noch Kinder. Die Arbeit ersetzt gewissermassen alles. Sie ist das Leben.
Auch ich gehöre zu denjenigen, denen ihre Arbeit Spass macht und die gerne viel arbeiten. Das Wort Hobby ist verpönt, da unsere Arbeit ja nicht entfremdet und wir deswegen auch keine Kompensation brauchen. Während etwa in der Ingenieurszene meines Partners trotz hoher Arbeitsbelastung das Wort Freizeit und nichtberufsbezogene Aktivitäten zum Leben gehören, sind das Fremdwörter für die Kunstszene. So hat Thomas Hirschhorn unlängst in einem Interview erwähnt, dass er nie ausgeht, weil er immer so viel arbeitet.
Die Freizeitlosen sind häufig Leute, die eine Kunst der Grenz- und Spartenüberschreitung propagieren. Diese Kunst macht Anschlüsse an gesellschaftliche Zusammenhänge, analysiert, greift in die Realität ein und erarbeitet künstlerische Alternativen zu bestehenden Gesellschaftsmodellen. Ihre VertreterInnen verstehen Kunst als Kritik oder Management. Es sind Leute, die sich sogar bewusst sind, dass ihre flexibilisierten, selbstausbeuterischen Lebensverhältnisse zum «role model» neoliberaler Ideologien geworden sind. Kritische Veranstaltungen und Ausstellungen dazu sind nicht selten. Auch Lilian Räber und ich organisierten vor neun Jahren an der Viper (Internationales Festival für Film, Video und neue Medien) in Luzern einen Kongress zu diesem Thema. Obwohl wir damals extensiv über diese Zustände sprachen, hat niemand sein eigenes hyperaktives Leben infrage gestellt. An allen mir bekannten Panels sind einige grundsätzliche Fragen letztlich nie ausgesprochen worden. Vor allem diejenige, warum wir uns so einspannen lassen, wenn wir doch gleichzeitig so oft darunter leiden. Denn das gibt es, bei allem Spass.
Eigentlich wäre es nicht nötig, dass man zur Umsetzung seiner Ziele an so vielen Events gleichzeitig präsent ist und so viel Zusatzarbeit machen muss, dass man nur noch in der Welt herumdüst. Es ist ja nicht so, dass man ständig miteinander im Gespräch ist und permanent versucht, die Welt zu verbessern. Was auffällt, ist eher die Tatsache, dass man nur für den beschränkten Zeitraum des jeweiligen Events Zeit hat, miteinander zu kommunizieren. Kaum ist der vorbei, muss man wieder an einen anderen. Das ist natürlich nicht unbedingt etwas Schlechtes, wahrscheinlich wird es sogar eine super Veranstaltung gewesen sein. Was mich beschäftigt, ist eher die Tatsache, wie reibungslos das Ganze funktioniert und wie gut sich letztlich alle damit arrangieren. Kaum jemand spürt, wie universell uns der rationalistische und kapitalistische Geist des Fleisses in den Klauen hält, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, uns selbst zu sein, frei und handlungsfähig - und erfolgreich.
Letzteres - der Wunsch nach Erfolg - scheint der tatsächliche Antriebsmotor zur Dauerbelastung zu sein. Die permanente Ruhelosigkeit in der Kunstszene lässt sich nicht nur als Existenzkampf und notwendige Suche nach Publikum erklären. Vielmehr geht es auch um die Wünsche, Gleichgesinnte zu finden, die Einsamkeit zu durchbrechen und seine subjektiven Welten im grossen Stil durchzusetzen, um Macht und Autorität zu erlangen. Kurzum, es geht ums Existenzielle, es geht aber auch um Formen von Karrieren - ebenfalls ein Wort, das in der Kunstszene verpönt, aber fundamental ist. Alles gründet hier auf der Macht von Namen und deren Durchsetzung: dem Namen des Museums, des/der KünstlerIn, des/der KuratorIn, der Biennale oder Triennale und so weiter. Deswegen scheint Omnipräsenz das alleinige Mittel, nicht vergessen zu gehen oder im Taumel des Betriebs durch jemand anderen ersetzt zu werden. Kurzum, das Kunstsystem beziehungsweise diese verschiedenen Szenen innerhalb sind nicht nur das Role Model des Neoliberalismus, in welchem sich Arbeit und Freizeit, Fleiss und Hedonismus auf nie dagewesene Weise zu neuen Identitätsmodellen verknüpfen. Vielmehr sind sie auch dessen waschechte, bei aller Kritik höchst lebendige Produkte.
Yvonne Volkart ist Dozentin für Kunst- und Kulturtheorie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Aarau, und lebt als freie Autorin und Kuratorin in Zürich.