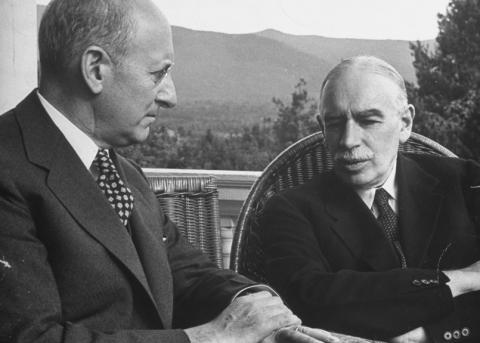Internationaler Währungsfonds: Wer braucht noch den IWF?
Nie zuvor in seiner sechzigjährigen Geschichte hat der Kreditgeber für Entwicklungsländer in einer tieferen Krise gesteckt. Es droht die Bedeutungslosigkeit.
Die Tagung, die vergangene Woche in Singapur stattfand, war ein Krisengipfel, bei dem es um Sein und Nichtsein des Internationalen Währungsfonds IWF ging, auch wenn viele Beteiligte den Schein der Normalität zu wahren suchten.
Auf der Tagesordnung stand eine Reform des IWF. Doch mehr als ein Versprechen und einen symbolischen ersten Schritt haben die 184 Mitgliedsländer nicht zustande gebracht. Das wird nicht reichen, dem Fonds das Überleben zu sichern. Diesmal könnte er in die Bedeutungslosigkeit versinken, und ausser den rund 2800 hoch bezahlten ÖkonomInnen, die in seinen Diensten stehen, dürfte das kaum jemanden schmerzen.
Der IWF steckt in einer Legitimationskrise ohnegleichen. Das wachsende Misstrauen und die vielstimmige Kritik an der Politik des Fonds hat ihm veritable Finanzprobleme beschert. Der Grund: Seit Mitte der siebziger Jahre hat keine der grossen Industrienationen mehr einen Kredit des Fonds in Anspruch genommen. Da sie deshalb auch keine laufenden Beiträge mehr zahlen wollten, sorgten sie dafür, dass der Fonds sich fortan hauptsächlich aus Gebühren und Zinsen seiner Kreditkunden finanzierte. Das hat prächtig funktioniert - bis der IWF seine Grosskunden dermassen verärgerte, dass sie ihm davonzulaufen begannen.
Neues Betätigungsfeld
Ursprünglich sollte der IWF nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse den Mitgliedsländern helfen, die Wechselkurse ihrer Währungen in den vereinbarten Grenzen zu halten und vorübergehende Zahlungsbilanzdefizite zu überbrücken. Nach dem Ende dieses Systems 1973 suchte und fand er ein neues Betätigungsfeld im globalen Süden und wurde direkter Konkurrent der Weltbank als Kreditgeber für Entwick-lungsländer. Gleichzeitig änderte sich seine Politik grundlegend: Auflagen gab es zwar schon früher, aber seit Ende der siebziger Jahre begann der IWF seine Schuldner massiv zu drängen, dem internationalen Kapital freie Bahn zu geben und Kapitalverkehrskontrollen abzubauen. Während das Volumen der vom IWF gewährten Kredite sich vervielfachte, wurden die Auflagen stets rigider. Die Staaten mussten massive Sparprogramme akzeptieren und ihre Märkte öffnen und privatisieren. Unter der Fuchtel des IWF wurde die Schuldenkrise in der Dritten Welt immer ärger. Jede Abweichung von der aufgezwungenen neoliberalen Wirtschaftspolitik wurde hart abgestraft. Als der IWF den von der Asienkrise im Jahre 1998 hart getroffenen Ländern Kredite nur unter der Bedingung gewährte, dem ausländischen Finanzkapital, voran den Hedge Fonds, Tür und Tor zu öffnen, war das Mass voll. Nur wenige Länder konnten dem Druck widerstehen, aber alle hatten ihre Lektion gelernt.
Überflüssig gemacht
Mit Ausnahme der Türkei haben inzwischen wichtige Schwellenländer wie beispielsweise Thailand oder Argentinien ihre Schulden zurückgezahlt, und zwar in der Regel vorzeitig, nur um den Fonds und seine Aufpasser loszuwerden. Darüber hinaus haben alle Schwellenländer auf eigene Faust Devisenreserven in der Höhe von heute mehr als 2500 Milliarden Dollar angesammelt, um in zukünftigen Finanzkrisen nicht mehr auf den IWF angewiesen zu sein. Sie haben in Asien und in Lateinamerika eigene regionale Währungsfonds gegründet wie zum Beispiel die Chiang-Mai-Initiative im Jahr 2000. Ihr gehören dreizehn asiatische Länder an, darunter China, Japan und Südkorea. Sie brauchen den IWF nicht mehr. Auch immer mehr Entwicklungsländer lehnen sich gegen die Politik des IWF auf. Das führt zu Mindereinnahmen: Im laufenden Jahr sind es über hundert Millionen Dollar. Natürlich könnte der IWF Goldreserven verkaufen und das Geld am Kapitalmarkt anlegen Aber das wird nicht reichen. In absehbarer Zeit wird der IWF sich selbst verschulden müssen.
Aus der Finanzkrise kommt der Fonds nur heraus, wenn er die sogenannten Quoten der Mitgliedsländer und damit deren Stimmrechte neu justiert. Damit allerdings steht auch die bisherige Machtverteilung innerhalb des Fonds zur Debatte. Denn die Höhe der Quote bestimmt gleichzeitig, wie viel jedes Mitgliedsland zum Fondsvermögen beizutragen hat, wie viel Kredit es beanspruchen darf und welchen Einfluss es auf die Politik des Fonds nehmen kann.
Der IWF ist eine höchst undemokratische Organisation. Statt «ein Land - eine Stimme» galt hier von Anfang an das gut kapitalistische Prinzip «ein Dollar - eine Stimme». Wer am meisten zahlt, hat die meisten Stimmen und den grössten Einfluss. Jedes Land erhält zwar 250 Basisstimmen, unabhängig von seiner Grösse oder seinem Reichtum, aber der weitaus grössere Teil der Stimmrechte wird auf der Grundlage der Quote verteilt, die sich nach dem Reichtum und der Wirtschaftskraft eines Landes berechnet. Im Lauf der Zeit sind die Quoten mehrfach verändert worden - sie werden alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf angepasst Bisher haben zwölf solcher Überprüfungen stattgefunden, achtmal wurden die Quoten erhöht beziehungsweise verschoben. Dadurch ist das Gewicht der Basisstimmen von anfänglich 11,3 auf heute 2,1 Prozent der Gesamtstimmenzahl gesunken.
Die ungleiche Verteilung der Stimmrechte zwischen den Mitgliedsländern ist durch die Quotenanpassungen nicht wesentlich gemildert worden: Von den 184 Mitgliedsländern sind es heute einige wenige, die im IWF das Sagen haben. Voran die USA, die mit einem Stimmenanteil von 17,08 Prozent sogar als einziges Land eine Sperrminorität, also ein Vetorecht bei allen wichtigen Entscheidungen des Fonds haben. Die fünf grössten und reichsten Mitgliedsländer (USA, Japan, Deutschland, Frankreich und Britannien) haben zusammen knapp vierzig Prozent der Stimmrechte, dagegen kommen die Länder der G-77 (der inzwischen 132 Entwicklungsländer angehören) zusammen auf weniger als dreissig Prozent der Stimmen. Auf ganz Asien entfallen weniger als siebzehn Prozent der Stimmen, die lateinamerikanischen Länder müssen sich zusammen mit einem Stimmenanteil von sieben Prozent begnügen (Deutschland allein hat schon über sechs Prozent). Die Schwellenländer verfügen über höchst bescheidene Stimmenanteile, die ihrer Bedeutung in der Weltwirtschaft schon lange nicht mehr entsprechen. Auf die achtzig ärmsten Länder der Erde entfallen zusammen nur knapp ein Zehntel der Stimmen. Sie sind daher ganz besonders unterrepräsentiert.
Reform gefordert
Die G-20, die Gruppe der wichtigsten Schwellenländer, hat letztes Jahr die lange überfällige Reform des IWF eingefordert. Auch das Europäische Parlament hat sich für eine radikale Neuverteilung der Stimmen im IWF ausgesprochen und verlangt, zumindest die Länder der Euro-Zone sollten künftig nur noch einen Sitz im Verwaltungsrat des IWF beanspruchen, statt sieben wie bisher.
Die Fondsgewaltigen konnten nicht anders: Sie haben einen Reformplan in zwei Stufen erstellt, der bis 2008 umgesetzt werden soll. Ob das gelingt, ist mehr als zweifelhaft. Denn der Zweistufenplan des Direktors Rodrigo de Rato enthält nur einen ersten, konkreten Schritt: Die Quoten der am stärksten unterrepräsentierten Schwellenländer China, Südkorea, Mexiko und Türkei sollen erhöht werden. Das ist in der Tat beschlossen worden - mit überraschend vielen Gegenstimmen: Vertreter der übrigen Schwellenländer wie Indien, Ägypten, Argentinien, Brasilien, Indonesien, Malaysia protestierten, weil sie sich mit dieser minimalen Konzession nicht abspeisen lassen wollten. Sie fordern eine weitergehende Reform. Doch nicht nur die Schwellenländer, auch zum Beispiel Deutschland sieht sich im IWF unterrepräsentiert, und die USA, die ihrerseits wiederum Europa für überrepräsentiert halten, sind nicht willens, ihre Vetomacht aufzugeben.
In der zweiten Reformstufe soll die Quote jedes Mitgliedslandes neu berechnet werden. Dabei geht es um die Frage, wie man eigentlich das relative Gewicht eines Landes in der Weltwirtschaft bestimmen soll, ob die Bevölkerungszahl eine Rolle spielen sollte oder der Kapitalreichtum eines Landes, ob Ressourcenreichtümer zu berücksichtigen sind oder seine Devisenreserven und Zahlungsbilanzdefizite und welches Gewicht dem jeweils zukommt.
Machtkampf
Was wie ein Streit um politische Arithmetik aussieht, ist ein Machtkampf in der Weltwirtschaft. Den können die Schwellenländer nur gewinnen, wenn sie Verbündete finden. Da tut sich schon einiges. So wirbt etwa die Schweiz dafür, in der neuen Quotenformel das relative Gewicht jedes Landes im System der internationalen Finanzmärkte angemessen zu berücksichtigen; sie ist dabei, eine Allianz mit anderen europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Schweden) zu schmieden. Derlei Risse in der Front der reichen Länder bieten den Entwicklungsländern politische Chancen.
Es wäre ja schon ein Erfolg, wenn nach 2008 kein einzelnes Land mehr über eine Sperrminorität im IWF verfügen würde. Auch die notorischen Blockierer wären dann zu einem Minimum an Kompromisspolitik gezwungen. Mehr Transparenz der Entscheidungsprozesse könnte dem Fonds auch nicht schaden: Bis heute gibt es keine formellen Abstimmungen, und die Entscheidungen jedes einzelnen Mitgliedslandes dürfen nicht publiziert werden. Es gibt auch keine öffentlich zugänglichen Protokolle der IWF-Sitzungen - gleichzeitig fordert der Fonds seit Jahr und Tag bei seinen Schuldnern Transparenz.
Viel wichtiger aber ist die Frage, welche Rolle der IWF in der Weltwirtschaft künftig spielen soll? Wozu wird er gebraucht und von wem? Auf diese Frage hat im Moment niemand eine schlüssige Antwort. Wäre es dann nicht mutiger und vernünftiger, sofort auf eine wirkliche Neuordnung des internationalen Geld- und Finanzsystems hinzuarbeiten, das das jetzige «Nicht-System» ersetzen kann?
• Der IWF wurde 1945 im US-amerikanischen Bretton Woods gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte er eine massgebliche Rolle beim Wiederaufbau der Weltwirtschaft spielen.
• Der IWF ist ein Sonderorganisation der Uno und gehört zur Weltbankgruppe. Er wird von einem Direktor geleitet. Zurzeit ist dies der ehemalige spanische Wirtschaftsminister Rodrigo Rato. Gemäss einer Vereinbarung zwischen den USA und den westeuropäischen Ländern ist der IWF-Direktor immer ein Europäer, während die USA den Chef der Weltbank bestimmen.
• Zu seinen Aufgaben gehören neben der Koordination und Überwachung der internationalen Währungspolitik die Kreditvergabe an die heute 184 Mitgliedstaaten. Sie können sich bei wirtschaftlichen Problemen an den IWF wenden, müssen sich jedoch im Gegenzug strengen neoliberalen Auflage beugen.
• Jedes Mitgliedsland bekommt eine sogenannte Quote zugewiesen. Diese repräsentiert seine Wirtschaftskraft und ist massgeblich für die Anzahl Stimmrechte und die Höhe der Kreditsumme, die ihm zustehen.
• Immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer lehnen sich gegen die Politik des IWF und die bestehenden Machtverhältnisse auf. Die Finanzinstitution soll insbesondere die Verschärfung der Wirtschaftskrise in Argentinien und in Asien Ende der neunziger Jahre mitverschuldet haben. Das belegen seriöse Studien. Doch der IWF wehrte sich bisher standhaft gegen Reformen.
Elvira Wiegers