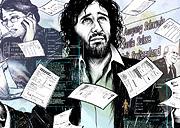Visa-Veto : «Verschlusssache – nur für Dienstgebrauch»
Die Schweiz treibt die Schengener Geheimhaltung auf die Spitze, mehr noch als das Schengen-Gründungsmitglied Deutschland. Das ist das Resultat von Anfragen in den beiden Parlamenten zum Visa-Konsultationsverfahren.
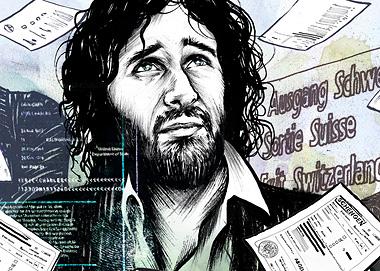
Die Schweiz muss ein Visumsgesuch ablehnen, wenn ein anderer Schengen-Staat sein Veto einlegt. Dass die Betroffenen dabei keine weitere Begründung erhalten und auch nicht erfahren, welcher Staat ihnen den Weg nach Europa versperrt, bereitet dem Bundesrat kein Kopfzerbrechen. Das Bundesverwaltungsgericht habe festgestellt, dass das Schengen-Recht «keine weitere Orientierung» vorsehe. Nachzulesen ist das seit Montag in der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage von Balthasar Glättli. «Das widerspricht dem rechtsstaatlichen Grundsatz, dass der Staat seine Entscheidungen begründen muss – umso mehr, wenn sie derart gravierende Folgen haben», sagt der grüne Nationalrat. «Nur dann kann ein Betroffener das Vorgehen einer Behörde anfechten. Bei jeder Parkbusse gibt es mehr Rechtsschutz.»
Mit seiner Anfrage hat Glättli auf den Fall eines Iraners reagiert, über den die WOZ Ende August berichtete: Im Juli 2009 hatte die Schweizerische Botschaft in Teheran dem Iraner Mehdi Rahimi ein Schengen-Visum verweigert. «Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit oder die internationalen Beziehungen darstellen», hatte die Begründung gelautet – angekreuzt auf dem einheitlichen Formular, das alle Schengen-Staaten für die Visumsverweigerung benutzen (siehe WOZ Nr. 35/12 ). Welcher Staat ihn als Sicherheitsrisiko einstufte und aus welchen Gründen, weiss Rahimi bis heute nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März 2012 seine Klage abgeschmettert. Rahimi ist kein Einzelfall: Seit die Schweiz bei Schengen mitmacht, hat sie 357 Personen das Visum verweigert, weil ein anderer Schengen-Staat im Rahmen des sogenannten Konsultationsverfahrens das so wollte. Umgekehrt hat die Schweiz selbst in 1884 Fällen ihr Veto gegen die Visumsvergabe durch einen Schengen-Partner eingelegt.
Vertrauliches Vertrauen
Das Konsultationsverfahren ist in Artikel 22 des Schengener Visakodex geregelt. Danach können die Mitgliedstaaten verlangen, dass ihnen die «zentralen Behörden» der anderen Schengen-Partner Visumsanträge zur Prüfung vorlegen, die auf deren Konsulaten gestellt werden. Dies, wenn es sich um Gesuche von BürgerInnen ausgewählter Drittstaaten oder bestimmter weiterer Gruppen handelt.
Die EU-Kommission führt eine entsprechende Liste, auf der heute 29 Drittländer und drei Personengruppen – Staatenlose, Flüchtlinge und PalästinenserInnen – verzeichnet sind. Die Liste selbst ist öffentlich, aber «die Information, welche Länder von welchem Schengen-Staat auf die Liste gesetzt wurden, wird von der EU als vertraulich eingestuft und wird von den Schengen-Staaten und somit auch von der Schweiz daher nicht öffentlich kommuniziert», schreibt der Bundesrat in der Antwort auf Glättlis Anfrage. Auch sonst herrscht unter den Staaten Vertrauen und Vertraulichkeit. Die «zentralen Behörden» teilen sich nur mit, ob sie der Vergabe eines Visums zustimmen oder nicht.
Die «Konsultation» verläuft weitgehend automatisiert über das «Vision»-Netz (Visa Inquiry Open Border Network). Die zentrale Behörde für die Schweiz ist das gleichnamige Büro, das dem Bundesamt für Migration (BFM) angeschlossen ist. Es gleicht die Daten aus Visumsgesuchen, zu denen die Schweiz «konsultiert» wird, unter anderem mit dem Fahndungsregister Ripol und dem BFM-Informationssystem Zemis ab. «Gegebenenfalls» werde auch der Nachrichtendienst des Bundes angefragt. Das geschieht pro Jahr rund 300 000 Mal. Von 2009 bis 2011 hat der Nachrichtendienst aber nur in dreissig Fällen eine Ablehnung empfohlen.
Standardformel «innere Sicherheit»
«Das Konsultationsverfahren ist zutiefst undemokratisch und intransparent», sagt auch Andrej Hunko. Der Abgeordnete der Linksfraktion im Deutschen Bundestag hat den WOZ-Bericht ebenfalls zum Anlass für eine Anfrage genommen. Welche Drittstaaten die BRD auf die Liste der EU-Kommission hat setzen lassen, teilt auch die Bundesregierung der Öffentlichkeit nicht mit: «Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch». Dennoch wird aus der Antwort auf Hunkos Anfrage deutlich, dass die deutschen Behörden sich die Visumsanträge aus den meisten der gelisteten Drittstaaten vorlegen lassen. Das Auswärtige Amt als deutsche «zentrale Behörde» fragt dabei jeweils die Staatsschutzabteilung des Bundeskriminalamts, das Zollkriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst sowie den Militärischen Abschirmdienst an. Von Oktober 2007 bis September 2012 hat die deutsche Staatsschutz-Community über 5,2 Millionen Visumsanträge, die bei anderen Schengen-Staaten gestellt wurden, mit entschieden. In 3050 Fällen meldete die BRD Sicherheitsbedenken an.
Umgekehrt haben andere Schengen-Staaten 2293 Mal die Visumsvergabe durch deutsche Konsulate blockiert. In diesen Fällen speist das Auswärtige Amt die Betroffenen ebenfalls mit der Standardformel – «… öffentliche Ordnung, innere Sicherheit …» – ab, die auch Mehdi Rahimi erhalten hat. Anders als in der Schweiz hat die Geheimhaltung in Deutschland jedoch ein Ende, wenn die Betroffenen vor Gericht ziehen: «Im Rahmen eines Klageverfahrens kann dem Antragsteller mitgeteilt werden, welche Behörde beziehungsweise welcher Mitgliedstaat Bedenken erhoben hat.»