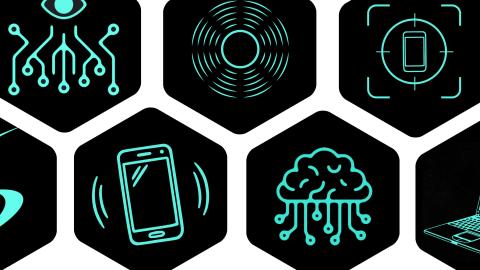Auf allen Kanälen: Unter dem Radar
Das Darknet als digitales Gegenmodell zur Überwachung im Netz zieht üble Gestalten an. Die Anonymität dort kann aber auch Whistleblower und linke Aktivistinnen schützen.

«Das Internet ist kaputt» lautet ein Bonmot. Will heissen: Aus dem anfangs anarchistischen World Wide Web ist ein repressiver Ort geworden, in dem grundlegende menschenrechtliche Konzepte wie das Recht auf Privatsphäre nichts mehr gelten. Und das stellt zum Beispiel WhistleblowerInnen vor ein Problem: Wie können diese ethisch motivierten GeheimnisverräterInnen ein brisantes Dokument an die Öffentlichkeit bringen, ohne dass sie verräterische Spuren hinterlassen?
Die Lösung findet sich an einem Ort, dem viele nichts Gutes zutrauen, ist er doch vor allem als Unterwelt von Drogen-, Falschgeld- und Waffenhandel bekannt: das Darknet. Dort haben eine Reihe von Medien abhörsichere Postfächer eingerichtet. Die Anonymität des Darknets schützt potenzielle WhistleblowerInnen vor Enttarnung, auch wenn sie selbst kaum über IT-Know-how verfügen.
Ein Darknet ist ein digitales Netz, das sich vom sonstigen Internet abschirmt. Das bekannteste Darknet basiert auf der Anonymisierungssoftware Tor, die IP-Adressen versteckt. Diese digitalen Postadressen zeigen bei jeder Kommunikation im Netz an, wo ein Datenpaket herkommt und wo es hinsoll. Das ist effektiv, macht NutzerInnen aber leicht identifizierbar. Tor dagegen leitet den Datenverkehr über ein Netzwerk von etwa 6000 Knotenpunkten, die Freiwillige bereitstellen. So verschleiert die Technologie Kommunikationswege.
Kryptische Adressen
Mit einem Browser auf der Basis von Tor kann man weitgehend anonym und unzensiert im normalen Netz surfen. Zudem lassen sich mithilfe der Technologie versteckte Websites betreiben – das ist das eigentliche Darknet. Die Adressen dort muten kryptisch an, sie enden stets auf einer Art Darknetendung namens «.onion» und sehen beispielsweise so aus: expyuzz4wqqyqhjn.onion. Solche «.onion-Adressen» lassen sich nicht blockieren und nicht lokalisieren. Das Darknet ist ein Gegenmodell zum Internet, das heute zu einer gigantischen Überwachungsmaschine geworden ist.
Das Darknet lässt sich nur mit dem Tor-Browser betreten. Ein Darknetpostfach schützt also die Identität von WhistleblowerInnen – vor Behörden und Geheimdiensten, aber auch vor einer zu neugierigen Redaktion. Zurzeit gibt es etwa sechzig solche Postfächer. Einige Medien betreiben Einzelpostfächer im Darknet, so die «New York Times», die Nachrichtenagentur AP, der britische «Guardian», die linke «taz» und ein Kollektiv um den investigativen Dopingjournalisten Hajo Seppelt. Ein anderes Modell sind Gemeinschaftspostfächer. Hinter dem Darknetpostfach «afriLeaks» etwa stehen siebzehn Zeitungen, Sender und Onlinemedien aus mehreren afrikanischen Ländern. Für «Sourcesûre» wiederum haben sich französischsprachige Medien aus Frankreich, Belgien und der Schweiz zusammengeschlossen, darunter Radio Télévision Suisse.
Alternativer Zugang
Auch linke IT-Kollektive haben die Vorteile der Technologie entdeckt. In vielen westlichen Demokratien werden linke Gruppierungen als sogenannte Linksextremisten kritisch von Behörden beäugt und mitunter auch digital überwacht. Darknetauftritte fungieren als alternative, abhörsichere Zugangstür zu ihren Inhalten, die eigentlich unter klassischen Webadressen verfügbar sind.
Die Techkollektive Riseup.net und Systemli.org bieten Kommunikationswerkzeuge für linke AktivistInnen an. Für die einzelnen Tools haben sie jeweils eigene Darknetadressen eingerichtet. Auch einige Regionalversionen des linken Mediennetzwerks Indymedia.org sind mit ihren Inhalten im Darknet vertreten, so der Ableger von Indymedia in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland.
Indymedia-Projekte zeichnen über ihre NutzerInnen keinerlei Daten auf, die sie im Fall der Fälle an Ermittlungsbehörden aushändigen müssten. Sie können aber nicht verhindern, dass Behörden möglicherweise auf dem Weg vom Rechner zur Website Daten abfangen. Wie das Kollektiv hinter dem deutschen Ableger von Indymedia mitteilt, habe man die eigenen NutzerInnen von Anfang an dazu aufgerufen, den Tor-Browser zu nutzen, um sich nicht der Überwachung auszusetzen. Der Gang ins Darknet, die Eröffnung einer .onion-Präsenz, sei daher «ein logischer Schritt» gewesen.
Stefan Mey ist Autor des Buchs «Darknet: Waffen, Drogen, Whistleblower» (C.H. Beck 2017).