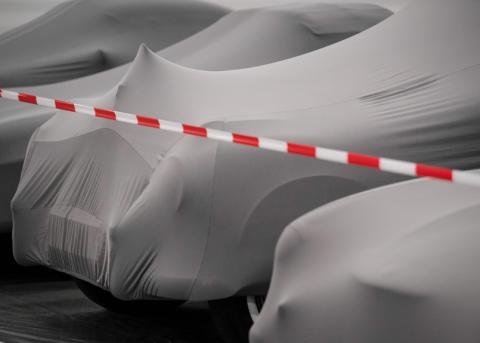Ökologische Zukunft: Immer fliegt der Bumerang zurück
Die Coronakrise zeigt einmal mehr: Ein ökologischer Umbau kann nur gelingen, wenn das Wirtschaftswachstum eingeschränkt wird. Dafür lässt sich einiges von der britischen Kriegswirtschaft lernen.
Die Coronapandemie macht das Undenkbare denkbar: Plötzlich fliegen kaum noch Flugzeuge, der Ausstoss an Treibhausgasen sinkt, Öl wird zur Ramschware, und viele Länder führen eine Art bedingungsloses Grundeinkommen ein. Der Staat hat allerorts das Sagen, während die meisten Neoliberalen verdattert schweigen. Die Globalisierung scheint genauso beendet wie der ungebremste Kapitalismus. Es wirkt, als wäre ein Weg gefunden, der zu mehr Nachhaltigkeit führt.
Doch dieser Schein trügt. Die Coronakrise zeigt gerade nicht, wie man den Kapitalismus verlassen kann – sondern beweist im Gegenteil, dass unser Wirtschaftssystem zum Wachstum verdammt ist. Die Weltwirtschaft befindet sich erst seit wenigen Wochen in der Fastquarantäne, doch die Schäden belaufen sich schon jetzt auf mehrere Billionen US-Dollar. Längst wären viele Unternehmen pleite und fast alle Beschäftigten arbeitslos, wenn die Staaten nicht permanent neue Hilfsprogramme auflegen würden, um die Wirtschaft zu stabilisieren.
Momentan besteht der Trick darin, einfach neues Geld zu «drucken», indem der Staat Kredite aufnimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes wird die Coronakrise mit Geld zugeschüttet. Die Schweiz hat inzwischen 62 Milliarden Franken eingeplant; Deutschland ist bereits bei 1,2 Billionen Euro angekommen. Es ist unmöglich, diese gigantischen Schulden zu tilgen und zurückzuzahlen. Stattdessen setzt man auf Wachstum. Sobald die Wirtschaftsleistung steigt, verlieren die Schulden an Relevanz – bis sie irgendwann vergessen sind.
Lenkung bleibt aus
Bleibt nur ein Problem: Die KlimaschützerInnen haben ja recht, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Die Schweiz und Deutschland hinterlassen einen ökologischen Fussabdruck, als könnten sie drei Planeten verbrauchen, aber bekanntlich gibt es nur die eine Erde.
Bisher hoffen die Regierungen, dass sie Wirtschaft und Umwelt langfristig irgendwie versöhnen könnten. Die Stichworte heissen «Green New Deal» oder «Entkopplung» von Wachstum und Energie. Auch in den jetzigen Pandemiezeiten wird intensiv diskutiert, wie sich der Wiederaufbau nach der Coronakrise ökologisch gestalten liesse.
Angeblich wäre es sogar billig, die Welt zu retten. Alle gängigen Studien gehen davon aus, dass ein vernünftiger Klimaschutz nur maximal ein bis zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts kosten würde. Fragt sich bloss, warum sich in der Umweltpolitik so wenig tut, wenn sie doch fast umsonst wäre? Irgendwo muss sich ein Denkfehler verbergen.
Um diesem Fehler auf die Spur zu kommen, eignet sich als Beispiel die Schweizer «Lenkungsabgabe»: Pro Tonne CO2 werden derzeit 96 Franken fällig, was im internationalen Vergleich beachtlich ist. Deutschland will erst ab 2021 eine CO2-Steuer einführen, die dann zunächst bei lächerlichen 25 Euro pro Tonne starten soll. Zudem sind die CO2-Preise längst nicht die einzigen Energiesteuern, die die Schweiz erhebt. Werden alle Abgaben zusammengerechnet, besteuern die SchweizerInnen ihren Energieverbrauch etwa doppelt so hoch wie die Deutschen. Doch seltsamerweise zeigt dies keinerlei Effekt. Die CO2-Bilanz der Schweiz ist nicht besser als jene der Bundesrepublik. Auch die OECD muss feststellen, dass es «keinen klaren Zusammenhang gibt zwischen den Emissionen eines Landes und der Energiebesteuerung».
CO2-Steuern wirken anders als gedacht, weil die Einnahmen ja nicht verschwinden. Das Geld wird nicht in einen tiefen Brunnen geworfen und verschwindet dort, sondern es bleibt im System. Die BürgerInnen müssen zwar tiefer ins Portemonnaie greifen, wenn sie Energie verbrauchen – aber ihr Geld landet dann beim Staat, der es wieder ausgeben kann und damit für neue Nachfrage und neue CO2-Emissionen sorgt. Es entsteht eine «Kreislaufwirtschaft», die mit einer ökologischen Postwachstumsökonomie fast nichts zu tun hat.
Der Denkfehler fällt zunächst gar nicht auf, weil die CO2-Steuern eigentlich sehr fair gestaltet sind: Die Einnahmen werden an die BürgerInnen zurückgezahlt. In der Schweiz wird die Krankenkasse billiger, und in Deutschland soll es ein «Energiegeld» für alle geben. Die Konsequenz ist, dass Heizen zwar ein bisschen teurer wird – aber dafür spart man bei der Krankenkasse oder kassiert das zusätzliche Energiegeld, sodass ein weiterer Flug nach Mallorca finanzierbar wird.
Windräder sind bald Schrott
Die Politik verwechselt Betriebs- mit Volkswirtschaft: Ein höherer CO2-Preis hat zwar eine Lenkungswirkung – aber nur beim einzelnen Produkt. Die Gesamtwirtschaft wird weiter in die Klimakatastrophe gesteuert. SchweizerInnen und Deutsche tappen in eine altbekannte Falle, die Bumerangeffekt heisst. Dieses Paradox wurde bereits 1865 vom britischen Ökonomen William Stanley Jevons beschrieben und ist eine der wenigen Voraussagen über den Kapitalismus, die sich als richtig herausgestellt haben. Wer Energie oder Rohstoffe spart und mit weniger Materialeinsatz die gleiche Gütermenge herstellt, steigert in Wahrheit die Produktivität und ermöglicht damit wieder neues Wachstum.
In der Umweltpolitik hat es daher wenig Sinn, nur auf Preise und Marktmechanismen zu setzen. Das weiss auch die Politik. Die grosse Hoffnung ist daher, dass man die gesamte Wirtschaft komplett auf Ökostrom umstellen könnte – ob Verkehr, Industrie oder Heizung.
Diese Idee klingt jedoch nur so lange gut, wie man die offensichtlichen Probleme dahinter verschweigt. Ein E-Auto ist, auch wenn es mit Ökostrom fährt, keineswegs umweltfreundlich, sobald auch die rohstoffintensive Herstellung berücksichtigt wird. Zudem entsteht Ökostrom nicht aus dem Nichts, sondern produziert ebenfalls Folgekosten. Windkrafträder sind zwar längst nicht so umweltschädlich wie Kohlekraftwerke, aber auch sie greifen in die Landschaft ein und werden bald zu einem Müllproblem. Denn Windräder laufen nur maximal dreissig Jahre und sind anschliessend eine Industrieruine aus neunzig Meter Schrott. Bisher ist noch völlig unklar, wie man die verschlissenen Rotorenblätter eigentlich recyceln soll.
Vor allem aber: Ökostrom wird immer knapp bleiben. Diese Aussage mag zunächst seltsam wirken, denn die Sonne schickt 10 000 Mal mehr Energie zur Erde, als die sieben Milliarden Menschen benötigen würden, wenn sie alle den Lebensstandard der EuropäerInnen geniessen könnten. An physikalischer Energie fehlt es also nicht, und dennoch wäre es eine Milchbüchleinrechnung, zu glauben, dass Ökoenergie im Überfluss zur Verfügung stehen kann.
Denn Sonnenenergie allein nutzt gar nichts; sie muss erst eingefangen werden. Solarpanels und Windräder sind jedoch technisch aufwendig – jedenfalls deutlich aufwendiger, als Kohle, Öl oder Gas zu fördern und zu verbrennen. Momentan wirkt der Ökostrom konkurrenzfähig, weil damit «nur» fossiler Strom ersetzt wird. Die Bilanz wird sofort schlechter, wenn der Ökostrom eingesetzt wird, um das Öl in anderen Sektoren zu verdrängen und beispielsweise im Autoverkehr nicht mehr Benzin oder Diesel zu verfeuern, sondern mit Elektrobatterien zu fahren. Erhellend ist der «Erntefaktor» EROI, der misst, wie viele Energieeinheiten investiert werden müssen, um neue Energieeinheiten zu gewinnen. Dabei stellt sich dann heraus, dass Ökostrom maximal die Hälfte der Nettoenergie liefern kann, die sich mit fossilen Varianten erzeugen lässt. Das ist eine bittere Einsicht. Denn damit ist klar, dass Ökostrom teuer ist und sich die Effizienz halbieren würde. Sobald aber die Produktivität sinkt, kann es kein Wachstum mehr geben. Die Wirtschaft muss schrumpfen, wenn man sie allein mit Ökostrom antreiben will.
Aber wie soll man sich dieses Schrumpfen vorstellen? Die Coronapandemie zeigt, dass eine Krise keine Lösung ist. Wenn Millionen Menschen schlagartig ihr Einkommen verlieren, bricht Panik aus – sodass nur noch das Wachstum zählt. Umweltprobleme erscheinen dann als nachrangig, solange nur die Wirtschaft wieder floriert.
Kapitalismus ohne Markt
Der Rückbau des Kapitalismus muss geordnet und geplant vonstattengehen. Zum Glück gibt es bereits ein historisches Schrumpfungsmodell, an dem man sich orientieren könnte: die britische Kriegswirtschaft zwischen 1940 und 1945. Damals standen die BritInnen vor einer monströsen Herausforderung. Sie hatten den Zweiten Weltkrieg nicht kommen sehen und mussten nun in kürzester Zeit ihre Friedenswirtschaft auf den Krieg umstellen, ohne dass die Bevölkerung hungerte.
Das erste Ergebnis war eine statistische Revolution: Damals entstand die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die bis heute ein Standardwerkzeug aller ÖkonomInnen ist. Mit diesem neuen Instrument liess sich ausrechnen, wie viele Fabriken man nutzen konnte, um Militärausrüstung herzustellen, ohne die zivile Versorgung zu gefährden.
Es entstand ein Kapitalismus ohne Markt, der bemerkenswert gut funktioniert hat. Die Fabriken blieben in privater Hand, aber die Produktionsziele von Waffen und Konsumgütern wurden staatlich vorgegeben – und die Verteilung der Lebensmittel öffentlich organisiert. Es gab keinen Mangel, aber es wurde rationiert. Die BritInnen erfanden also eine private und demokratische Planwirtschaft, die mit dem dysfunktionalen Sozialismus in der Sowjetunion nichts zu tun hatte.
Die staatliche Lenkung war ungemein populär. Wie die britische Regierung bereits 1941 feststellen konnte, war das Rationierungsprogramm «einer der grössten Erfolge an der Heimatfront». Denn die verordnete Gleichmacherei erwies sich als ein Segen: Ausgerechnet im Krieg waren die unteren Schichten besser versorgt als je zuvor. Zu Friedenszeiten hatten ein Drittel der BritInnen nicht genug Kalorien erhalten, weitere zwanzig Prozent waren zumindest teilweise mangelernährt. Nun, mitten im Krieg, war die Bevölkerung so gesund wie nie.
Heute herrscht zum Glück Frieden, aber die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist beim Klimawandel ähnlich gross. Wieder geht es ums Überleben der Menschheit. Aus der Coronakrise lässt sich zwar nicht viel für die Zukunft lernen, aber eine Lektion hält sie doch parat: Der Staat hat erneut gezeigt, dass er schnell und wirkmächtig handeln kann. Diese Kompetenz muss er als Nächstes nutzen, um geordnet aus dem Wachstum auszusteigen.
Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der deutschen «taz» und Buchautorin. Zuletzt erschien von ihr «Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen» (Westend-Verlag, 2019).