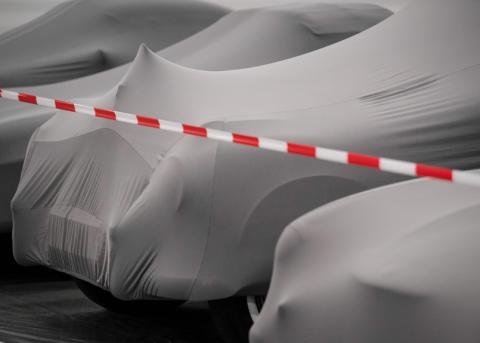«Leute, die wichtige Arbeit leisten, werden von unserem Wirtschaftssystem bestraft» Der Ökonom Tim Jackson glaubt, dass der ausschliessliche Fokus auf die Reduktion von Wachstum keine Lösung ist.

WOZ: Herr Jackson, die neue deutsche Regierung unter Olaf Scholz, die EU oder auch die USA möchten Billionen im Kampf gegen den Klimawandel investieren. Geht diese Politik in die richtige Richtung?
Tim Jackson: Ja, sicher. Wenn wir den Übergang zu einer Wirtschaft mit einem Netto-null-Ausstoss von CO2 bis 2030 schaffen wollen, müssen wir unsere Infrastrukturen, Produktionsprozesse, Lieferketten und unseren Lebensstil komplett umbauen. Dafür braucht es riesige Investitionen. Das private Investitionskapital fliesst heute an die falschen Orte, es verhält sich wie in einem Spielcasino: Das Geld wird irgendwo reingesteckt, in der alleinigen Hoffnung, dass es möglichst viel Profit abwirft. Wer investiert, sollte sich jedoch vielmehr gegenüber unserer Zukunft verpflichtet fühlen.
Die Regierungen wollen mit ihrer Politik einen Teil der Investitionsgelder in die richtigen Bahnen lenken.
Das Beratungsunternehmen McKinsey schätzt, dass die Welt jährlich neun Billionen US-Dollar investieren muss, damit wir überhaupt in die Nähe des Netto-null-Ziels gelangen. Zumindest ist der Green Deal der EU der grösste Schritt, der in Europa bis heute in diese Richtung unternommen wurde.
Besteht nicht die Gefahr, dass damit ein angeblich grünes Wachstum vorangetrieben wird, das in der Summe noch mehr CO2 ausstösst?
Das ist nicht zwingend: Entscheidend ist, wo das Geld investiert wird. Allerdings wünschen sich viele Politiker von diesen Investitionen tatsächlich vor allem einen Wachstumsschub – einfach in Grün. Sie sagen, grünes sei gar schneller als braunes Wachstum. Je schneller die Wirtschaft jedoch wächst, desto mehr muss wiederum getan werden, um sie zu «grünen». Es ist, als würde man in die falsche Richtung eine Rolltreppe hochgehen, die einem umso schneller entgegenkommt, je schneller man hochzurennen versucht. Dieses Problem ist in diesem naiven grünen Wachstumsglauben nicht mit eingerechnet.
Sie schrieben bereits 2009 in Ihrem Buch «Wohlstand ohne Wachstum», dass die erhoffte Entkoppelung des CO2-Ausstosses vom Wachstum schlicht nicht erfolge.
Es fehlt immer noch der Nachweis, dass dies geschieht. Bei meiner Arbeit für die Aktualisierung des Buches 2016 stellte ich sogar fest, dass wir uns inzwischen noch weiter von diesem Ziel entfernt hatten. Die höchste Dekarbonisierung der Wirtschaft erreichten die sogenannt entwickelten Länder während der zweiten Ölkrise 1980, als der CO2-Ausstoss pro US-Dollar Wirtschaftsoutput um drei Prozent abnahm. Heute liegt diese Rate tiefer als damals. Zur Erreichung des Netto-null-Ziels bis 2030 wären jedoch rund fünfzehn Prozent Abnahme nötig. Die CO2-Intensität der Weltwirtschaft sinkt nur dank China, das stark in eine Reduktion investiert. Die Idee, dass wir beim heutigen Wirtschaftswachstum unseren CO2-Ausstoss dank grüner Technologien senken können, ist ein Mythos – reines Wunschdenken. Dem widersprechen sowohl die Zahlen als auch unser heutiges Wirtschaftssystem, das in die entgegengesetzte Richtung weist.
Wie meinen Sie das?
Wir leben in einem Wirtschaftssystem, in dem die privaten Investoren einzig nach Profit streben. Dies, indem sie die Produktivität steigern und alles tun, damit der materielle Konsum zunimmt – womit das Wirtschaftswachstum immer weiter vorangetrieben werden soll. Das ist mit dem Netto-null-Ziel schlicht unvereinbar.
Aber folgen die Initiativen von Deutschland, der EU oder den USA nicht diesem Mythos?
Zu einem gewissen Teil ja. Die EU hat jedoch eine progressivere Position eingenommen. Seit der Pandemie erkennt sie durchaus an, dass sich die Wirtschaft strukturell wandeln muss.
Wir müssen also aufhören, das Wachstum anzutreiben; gleichzeitig zeigt gerade die Ölkrise, dass dies Arbeitslosigkeit zur Folge hat, weil es, um die gleiche Menge zu produzieren, immer weniger Arbeitskräfte braucht. Was also tun?
Als Erstes müssen wir einsehen, dass unsere Wirtschaften ohnehin immer langsamer wachsen. Und das nicht erst seit der Finanzkrise 2008, sondern schon seit den sechziger Jahren. Das Problem ist, dass das Wachstum der Arbeitsproduktivität schwindet. In Grossbritannien liegt es bei annähernd null Prozent, selbst in China ist es am Fallen. Alle reden von künstlicher Intelligenz, Robotern und digitalen Technologien; und tatsächlich steigt die Arbeitsproduktivität in der Produktion und den Lieferketten weiter an – Amazon braucht etwa durch den Einsatz von Drohnen immer weniger Personal. Unsere Wirtschaft besteht jedoch zu einem grossen Teil eben auch aus Dienstleistungen, in denen die Produktivität nicht gross wachsen kann: Die Pflege- und Sorgearbeit etwa kann kaum durch Automatisierung gesteigert werden.
Genau hier liegt eine Ihrer Hauptantworten auf die Klimakrise: Sie fordern, dass in Dienstleistungen wie die Pflege viel mehr investiert wird.
Genau, denn erstens sind diese Dienstleistungen viel weniger ressourcenintensiv, sie belasten die Umwelt viel weniger als die Produktion von Konsumgütern. Und zweitens sind sie entscheidend für die Qualität unseres Lebens, für unseren Wohlstand. Interessanterweise ist zudem das Wohlbefinden der Arbeitskräfte in diesen Berufen tendenziell höher als in der Produktionsindustrie – wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem diese, wirtschaftlich gesehen, weniger produktiven Aktivitäten ausgebaut werden: Gesundheitssystem, Pflege, Kultur, Bildung für unsere Kinder.
Sie argumentieren, dass diese Dienstleistungen die Qualität unseres Lebens gar viel stärker steigern als die Produktion weiterer Konsumgüter, mit der das Wachstum angekurbelt wird.
Dass unsere Gesundheitsversorgung wichtiger ist als viele Konsumgüter, ist ja die offensichtlichste Erkenntnis aus der Coronapandemie. Natürlich ist Geld wichtig – man kann es sich nur leisten, über weniger Geld zu reden, wenn man genug davon hat. Befragt man Menschen über die Grundlage ihres Wohlstands, geben sie neben Essen und einer anständigen Unterkunft jedoch schnell einmal Dinge an wie Gesundheit, soziale Einbettung, Kultur. Darauf verwiesen Ökonomen wie John Stuart Mill bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Unser Wirtschaftssystem ist jedoch auf die Vermehrung von Vermögen ausgerichtet, darum ist der Ausbau sozialer Dienstleistungen schwer zu erreichen.
Das private Kapital investiert zu wenig in diese Sektoren?
Wenn es investiert, führt dies zu teilweise perversen Ergebnissen. Die Privatisierung des Gesundheitssystems ist in Grossbritannien sowohl für die Pflegebedürftigen als auch die Arbeitskräfte, die in diesem Sektor arbeiten, ein Desaster. Da die Arbeit kaum automatisiert werden kann, besteht der einzige Weg zu mehr Profit darin, die Löhne zu drücken, die Arbeitszeit zu verlängern oder die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Diese Leute, die wichtige Arbeit leisten, werden von unserem Wirtschaftssystem bestraft. Wir brauchen wirtschaftliche Organisationsformen, die nicht ständig nach noch mehr Produktivität trachten, um ihre Profite zu erhöhen.
Neben dem Ausbau solcher Dienstleistungen schlagen Sie als Antwort auf die Klimakrise auch Arbeitszeitverkürzungen vor.
Die steigende Arbeitsproduktivität in der Produktion führt dazu, dass es immer weniger Menschen braucht, um die gleiche Wirtschaftsleistung zu produzieren. Um alle Leute in der Arbeit zu behalten, wird versucht, ständig mehr zu produzieren. Die Alternative besteht darin, dass alle einfach weniger arbeiten. Der britische Ökonom John Maynard Keynes schrieb dies bereits 1930 in seinem Essay «Die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkel»: Künftig würden wir alle mehr Freizeit geniessen.
Tatsächlich wurde die Arbeitszeit in Industriestaaten über Jahrzehnte kontinuierlich gesenkt, erst seit einiger Zeit hat sich der Trend gewendet.
Seit rund zwanzig Jahren versuchen viele Regierungen, mit längeren Arbeitszeiten das Wirtschaftswachstum zu forcieren. Denn wenn das Wachstum der Arbeitsproduktivität gegen null tendiert, ist die Erhöhung der geleisteten Arbeitsstunden der einzige Weg, um das Wachstum zu erhöhen – entweder man holt Leute aus anderen Ländern, oder man lässt die Leute länger arbeiten. Allerdings bin ich inzwischen überzeugt, dass es auch künftig viel Arbeit benötigen wird: nicht in der Produktion, aber – wie bereits erwähnt – in sozialen Dienstleistungen wie der Pflege.
Sie sagen, dass das private Kapital diese Arbeit jedoch nicht schaffen wird. Dann muss also der Staat einspringen und mehr in Gesundheit, Kultur oder Bildung investieren?
Ja, allerdings nicht im Stil einer totalen Verstaatlichung. Der Zentralstaat muss bei der Versorgung sicher eine entscheidende Rolle spielen. Doch zum öffentlichen Sektor gehören auch die Gemeinden oder die Zivilgesellschaft. Wir müssen Wege finden, um einen Care-Sektor aufzubauen, der nicht auf Profit ausgerichtet ist.
Der Elefant im Raum ist das private Kapital, das man sich zuerst etwa über Steuern holen muss, wenn man es anderswo investieren will.
Hier liegt der grosse Machtkampf, genau. Ich behaupte nicht, die einfache Lösung für dieses Problem bereitzuhalten. Natürlich fordert der nötige, tiefgreifende Wandel die Interessen des privaten Kapitals heraus. Dieses baut eine ganze Verteidigung gegen diesen Wandel auf, wie etwa die Rhetorik um angeblich grünes Wirtschaftswachstum. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat in der Pandemie den «Great Reset» ausgerufen – den Neustart hin zu einem grünen Kapitalismus. Dieselben Leute, die für die Architektur der wachstumsgetriebenen Weltwirtschaft der letzten fünfzig Jahre verantwortlich sind, behaupten nun, für die Interessen der Armen und des Planeten einzustehen? Sie übernehmen die grünen und sozialen Argumente, um sich als die neuerdings guten Kapitalisten auszugeben.
Ist das ausschliesslich Greenwashing, oder bringt diese Rhetorik auch ein Stück Bewegung mit sich?
Natürlich ist es gut, wenn diese Leute verstehen, dass sich etwas ändern muss. Und tatsächlich gewinnen soziale und ökologische Kriterien bei Investitionen an Bedeutung. Es existieren immer mehr Fonds, die nach ethischen Richtlinien investieren, es gibt einen Rückzug von Investitionen aus fossilen Energien. Gleichzeitig erinnert das Ganze an die königliche Erbfolge: Der Kapitalismus ist tot – lang lebe der Kapitalismus! Ohne klare Regeln für den Finanzmarkt wird sich zu wenig ändern: Ohne diese werden Leute, die nach ökologischen Kriterien investieren, gegenüber anderen stets im Nachteil sein. Wir kommen nicht umhin, diesen Machtkampf gegen grosse Profitinteressen zu führen, einen Kampf, vor dem der liberale Ökonom Adam Smith bereits Mitte des 18. Jahrhunderts gewarnt hat.
Wovor warnte er genau?
Vor der Gefahr, dass sich Kapital so stark akkumuliert, dass es die Politik bestimmen kann – um noch mehr Kapital anzuhäufen. Wir sind heute in vielen Ländern in der Situation, dass grosse Investoren die politische Debatte und entsprechend Gesetze zu stark beeinflussen können. Die einzige Antwort auf die Macht des privaten Kapitals, das sich dem öffentlichen Interesse widersetzt, ist die Gegenmacht des Staates.
Der mächtige Einfluss von Investor:innen auf die Politik ist ein Weg, wie die zunehmende Ungleichheit die Klimapolitik torpediert. Für Sie schadet die Ungleichheit aber auch aus anderen Gründen …
Ein weiteres Problem zeigt sich etwa beim Versuch, den Öl- und Treibstoffverbrauch zu reduzieren: Die Ausgaben dafür machen bei ärmeren Haushalten einen viel grösseren Anteil an den Gesamtausgaben aus als bei reichen Familien – unter anderem, weil sie in schlechter isolierten Häusern wohnen. Eine Steuer, die den Verbrauch verringern will, wirkt entsprechend degressiv: Sie fällt auf Ärmere zurück – was die Ungleichheit verschärft. Es braucht Mechanismen, die dem entgegenwirken. Und die Ungleichheit schafft noch viele weitere Probleme …
Welche?
Sie schafft eine Gesellschaft, in der alle nach dem Leben der Reichen streben: nach deren Lifestyle, deren Vermögen und den materiellen Dingen, die damit einhergehen. Dies macht es schwierig, normale Leute für den ökologischen Wandel zu gewinnen. Mit dem ganzen Greenwashing schaffen es Leute mit Geld und Macht sogar, ihr Leben als grün erscheinen zu lassen.
Fast zehn Prozent der Weltbevölkerung können ihre Grundbedürfnisse nicht decken. Sie haben allen Grund, nach mehr materiellem Wohlstand zu streben.
Klar, wir tragen in den Industriestaaten eine viel grössere Verantwortung, dass das Netto-null-Ziel erreicht wird, als Menschen in ärmeren Ländern, die noch keinen anständigen materiellen Lebensstandard haben. Wir müssen mehr tun! Untersuchungen, die ich gemacht habe, zeigen: In ärmeren Ländern führt zusätzliches Wirtschaftswachstum zu einer viel stärkeren Zunahme der Lebensqualität als in reichen Ländern. Die Kindersterblichkeit sinkt, die Lebenserwartung, das Bildungsniveau und das Glück allgemein nehmen zu. Ab rund 20 000 US-Dollar pro Kopf und Jahr beginnt die Zunahme der Lebensqualität abzuflachen. Einzelne Kollegen kritisieren mich, weil ich nicht kategorisch gegen Wachstum bin. Wenn Menschen jedoch in dreckigen Hütten mit kontaminiertem Wasser und schlechtem Essen leben, ist es schwierig, gegen mehr materiellen Wohlstand zu sein.
Sie sprechen im Unterschied zur «Degrowth»-Bewegung, die sich explizit gegen Wachstum stellt, von «Postwachstum».
Ja, allerdings stimmt mir die Degrowth-Community in vielen Dingen, die ich sage, zu – und umgekehrt. Ich glaube, dass die Perspektive, sich vom Wachstum zu lösen, mehr politische Optionen offenlässt als der Fokus auf die Reduktion von Wachstum. Die Ärmsten könnten noch etwas wachsen, während die Reichsten ihr Wachstum umso mehr reduzieren sollten.
Dass sich fast eine Milliarde Menschen aus der Armut befreien, ohne den CO2-Ausstoss stark zu erhöhen, scheint ein fast unmögliches Unterfangen zu sein.
Es ist schwierig, doch es gibt keine andere Alternative, als es zu versuchen. Befreien sich Leute aus der Armut, kann das teilweise sogar einen positiven Effekt auf die CO2-Bilanz haben. Man bezeichnet das als Leap-Frogging: Wenn Leute mit Solarenergie statt Brennstoff oder Müll heizen, ist das auch gut fürs Klima.

Wie viel kann in einer globalisierten Wirtschaft ein einzelnes Land überhaupt gegen den Klimawandel tun?
Man kann auch als einzelnes Land vieles ändern. Wo es Kooperation unter den Staaten braucht, ist bei der Kontrolle multinationaler Konzerne, die heute gewissermassen ausserhalb staatlicher Gesetzesstrukturen operieren. Hier liegt der grosse Machtkampf der Zukunft.
Der Postwachstumsökonom
Tim Jackson (64) ist Professor für nachhaltige Entwicklung an der englischen University of Surrey. Weltweite Bekanntheit erlangte der Brite 2009 mit seinem Buch «Wohlstand ohne Wachstum», das er ursprünglich als Bericht im Auftrag der britischen Regierung verfasst hatte. Auch in seinem letztes Jahr erschienenen Buch, «Wie wollen wir leben?», skizziert Jackson das Modell einer Postwachstumsgesellschaft.