Zürcher Kunstpreis: Die Utopien des Harald Naegeli
Als Sprayer von Zürich hat er die toten Mauern immer wieder zum Tanzen gebracht: Nun wurde Harald Naegeli mit dem Zürcher Kunstpreis geehrt. In seiner – hier leicht gekürzten – Laudatio würdigte Reto Hänny den Künstler als Erben des Dadaismus.
Lieber Harald Naegeli, sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren
«Alles, was über Harald Naegeli, den Sprayer von Zürich, zu sagen und zu schreiben ist, basiert auf dem Zusammentreffen der drei Elemente: Er hat am richtigen Ort (1) zur richtigen Zeit (2) das Richtige getan (3). Das ist Kunst», hat es Joseph Beuys 1984 auf den Punkt gebracht.
Ausgedeutscht vom Zürcher Obergericht: «Der Angeklagte hat es verstanden, über Jahre hinweg und mit beispielloser Härte, Konsequenz und Rücksichtslosigkeit die Einwohner von Zürich zu verunsichern und ihren auf unserer Rechtsordnung beruhenden Glauben an die Unverletzlichkeit des Eigentums zu erschüttern.» –
… Und schon steck ich als Laudator im Dilemma: Hier und heute gilt es einerseits, mit Harald Naegeli einen grossen Künstler zu ehren, dessen immenses Werk, das sei vorweggenommen, weit mehr umfasst als das, was auf den Mauern zu lesen war und ist – frei nach Heines «Belsazar»:
Und sieh! und sieh! an weisser Wand
Da kam’s hervor wie Menschenhand;
Und schrieb, und schrieb an weisser Wand
Zeichen von Feuer, und schrieb und schwand.
(…) doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand
– und so habe ich, andererseits, was nicht alle Tage vorkommt, die Laudatio auf einen Kriminalisierten zu halten, einen Schmierueli, Sachbeschädiger, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war, einen Verbrecher, der, ausgeschrieben von seiner Heimatstadt, welcher er so viel schenkte und, einmal erwischt dabei, wieselflink auch schon wieder entwischte, nachdem man seiner nicht habhaft werden konnte, mit einem von der Schweiz erwirkten internationalen Haftbefehl durch ganz Europa gejagt, dank Computertechnologie der Polizei weit im Norden schliesslich ins Netz ging und, nach langem Hin und Her auf Drängen der Schweiz von der Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert, im Frühjahr 1984 – im Orwell-Jahr also; ich kann mich an den Tag genau erinnern –, begleitet von Josef Beuys, Klaus Staeck und zahlreichen anderen Grössen aus Kunst und Kultur und diesseits von ein paar Schweizer Freunden begrüsst, sich freiwillig dem Basler Grenzschutz stellte, um der Schweizer Gerichtsbarkeit überstellt im Hochsicherheitstrakt Winterthur bei einer halben Stunde Hofgang und einer Stunde Besuchszeit pro Woche, unter Haftbedingungen, die eher einem Gewaltverbrecher zustehen, seine neunmonatige Strafe abzusitzen.
Ja, man kanns drehen und wenden, wie man will: Für die, welche sehen können oder dank Naegelis Figuren sehen lernten – Kunst, nach Paul Klee, stellt nicht das Sichtbare dar, sie macht sichtbar – ist er der grosse, für seine Schöpfungen international hochgeachtete Künstler; der Freund, um den man, je kecker er mit seinen Aktionen wurde, desto mehr fürchten musste, er werde Kerberos früher oder später in die Fänge geraten – was wegen einer nächtens beim Gerangel mit dem Grossen Bruder verlorenen Brille, die er tags darauf suchen ging, auch geschah.
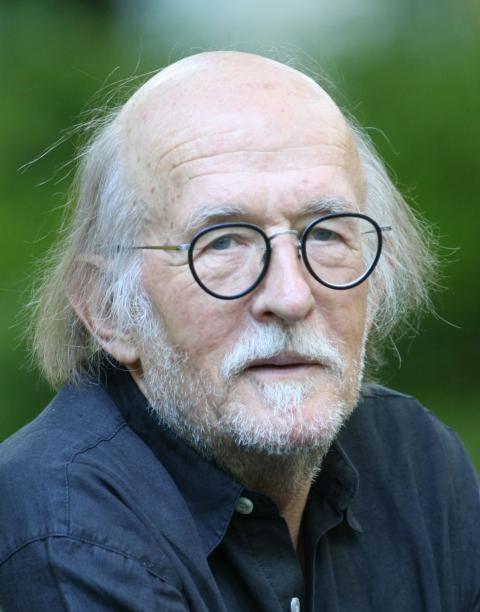
Für die anderen, die Betonanbeter und Eigentumsbewahrer, die sich, mit einem Brett vor dem Kopf hinter dicken Mauern verschanzt, wohl alle so aufgeklärt glauben – aber, wie schon Lichtenberg 1798 in sein Sudelbuch notierte: «Man spricht viel von Aufklärung, und wünscht mehr Licht. Was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben, oder die, die sie haben, vorsätzlich verschliessen?» –, für diese anderen bleibt er der Kriminelle, der – noch bevor Zürichs Strassen, von ihm lernend, ein Jahr nach seiner ersten Festnahme zu tanzen begannen, bis mit Kanonen auf Dada böllernd der überbordenden Fantasie der Garaus gemacht war – die Volksseele zum Kochen brachte und bis heute am Sieden hält. Sogar nachdem publik geworden, dass die Stadt Zürich ihn mit dem diesjährigen Kunstpreis ehrt, flatterte dem Künstler Anfang August eine weitere Vorladung der Staatsanwaltschaft ins Haus, in welcher als Geschädigte, der Straftatbestand einmal mehr Sachbeschädigung, der Kanton Zürich, vertreten durch die Baudirektion, sowie die Stiftung Zentralbibliothek genannt werden – während das Kunsthaus, ob dem Mut erschrocken, Kunstwerke getilgt zu haben, seine Strafanzeige zurückzog. –
Luftgeister, über Beton huschend
Doch der Reihe nach – lang ists her, und es schadet nicht, sich zu erinnern: Im Herbst 1977 begannen eigentümliche Wesen Zürichs gepflegte Strassen zu bevölkern, erweckten die Stadt aus der Starre wie der Frühling die Natur, geisterte unvermittelt ein Eulenspiegel durch die Betonwüsten und trieb, verbotenerweise sich Verbotenes erlaubend, seinen Schabernack, setzte mit der Spraydose Kritzelkrakel und krähenfüssige Strichmännchen, Einbeiner wie Zweibeiner, auf grauen Stein, Wanzen, Käferroboter, und, wunderschön wie die zwei vor dem Rechberg, die dort in bewegter Zeit mein Töffli beschützten, immer wieder Frauen, schöner und sinnlicher als jede den Wellen entstiegene Aphrodite, schwellende Urmütter mit lockenden Tentakelaugen, anderswo Kreise mit eingezeichnetem Punkt, die, in ein Dreieck gefasst, langarmig sich um Hausecken hangelnd, einen auf dem Weg zur Arbeit eines Morgens anblitzten, den Blick bannten und die ganze Hässlichkeit vor Augen führten, auf die man sich konditionierte, um nicht darob irrezuwerden; liess mit subversivem Witz federleichte Luftgeister, Ariels Verwandte, über Beton huschen, Wichte und Riesen, deren Hände Königszeptern gleichen oder dem Dreizack des Gehörnten aus Boschs Welten, einen zu Gedankenflügen animierend und Erinnerungen an eigene Kindertage weckend, als man selber noch zeichnen konnte, mit Eifer die Tageszeitung verzierte, am liebsten, bevor die Erwachsenen sie zu Gesicht bekamen, oder Mutters Kochbuch und mit Vorliebe Vaters Männerchornoten verschönerte, bass erstaunt, dass die Grossen am Werk so gar keine Freude hatten, und mit den Geistern des Phantoms stellte sich eine Ahnung von quirliger Lebendigkeit wieder ein, gesellte sich ein Hauch Melancholie dazu und regte sich in einem selbst wieder eine Spur von Protest: Poesie contra Beton … –
Nach Naegeli gibt es zwei Sorten Künstler: Die einen kämpfen mit der Bombe Poesie, der sanftesten und, wollen wir nicht jedem Glauben, jedem Traum von einer Veränderbarkeit der Wirklichkeit abschwören, letztlich wirkungsvollsten Waffe; die anderen fabrizieren weiter unbehelligt Torten, wenns hochkommt beim Sonntagsausflug im Kunsthaus zu delektieren. Während die einen vor Neid erblassen ob all der Aufmerksamkeit, die einem Anonymus zuteilwurde, liess das Phantom der Nacht, zwei Jahre unerkannt Stadtgespräch, mit kühnem, elegantem Strich auf abweisenden Beton gesprayt gespenstische Kobolde aus allen Ecken springen, Undinen, und als Kind einer Künstlerin aus einer Fischerfamilie von den Lofoten, die am Zürichberg nie heimisch wurde, in den Schulferien oft in Norwegen, früh mit dem Wasser vertraut und wissend, wie gefährdet dieses überlebenswichtige Element ist, am Ende, welch’ Ungeheuerlichkeit in der zwinglianischen Hochburg, gar Fische langbeinig aus einer Vagina fliehen – der Fisch, am Seeufer beim Bellevue an Land gesprungen, wurde von der Wasserpolizei in sein Element zurückbeordert, das gleiche Schicksal wie unzählige andere von Naegelis Werken erleidend, bevor man die Zeit überdauernde Reste heute endlich zu schützen beginnt – oder beginnen wollte, denn der Sensenmann auf dem Sockel des Waldmann-Denkmals wurde erst vor zwei Wochen – durch wen? – praktisch vor den Augen der Stadtregierung zerstört: Das ist Sachbeschädigung. Wenn ich lese, wie viel Zustimmung der Zerstörer bekommt, wird mir schlecht, und zornig frage ich mich, ob der über achtzigjährige Naegeli dafür noch Galgenhumor aufbringt wie einst.
«Seht, ob ihr mich töten könnt!», lachte der Künstler damals und war schon um die Ecke, um, von Stippvisiten abgesehen, die in gesprayten Polizisten in Kampfmontur, wildgewordenen Zahlenkolonnen und an chinesische Schrift gemahnenden Zeichen ihre Spuren hinterliessen, viele Jahre in weniger vermintem Gelände zu wirken, eh er, in seine Heimatstadt zurückgekehrt, diese, nachdem er die Chemiekatastrophe bei Sandoz am Rheinknie als Fischsterben an jedem Brückenpfeiler rheinabwärts bis Düsseldorf angeprangert, mit einem «Tanz der Fische» beschenken wollte, der sich im Grossmünster nach jahrelangen Querelen zum Totentanz wandelte – aber ich greif schon wieder vor:
Bis er gefasst wurde und, solange kein Urteil vorlag auf freiem Fuss, untertauchte, schrieb Naegeli mit der Spraydose hierzulande munter weiter seine Zeichen, befreit vom tradierten Kunstbegriff, von Käuflichkeit und Domestizierung auf vorbestimmte Orte, die einen erfreuend und andere das Fürchten lehrend, oder wie er, noch unerkannt, sein nächtliches Tun in einem Leserbrief erklärte: «Ich realisiere unmittelbar. Lege bloss, decke auf, setze das Messer an …»: Heute wie damals hat solches Tun alle Chancen, aus der Kunst in die Kriminalität gedrängt zu werden, überlässt eine Gesellschaft mit abgeschlossen klar definiertem Kunstbegriff die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Nichtkunst der Justiz.
Dem Schaden ins Auge blicken
Zwei Wörtchen nur ausgewechselt, und der Leserbrief aus dem Jahr 1979 könnte heute in der Zeitung stehen: «Ich finde es empörend, dass sich in dieser Angelegenheit unser Herr Stadtpräsident wohlwollend geäussert haben soll. Was der Sprayer tat, war ein Vergehen, ein Delikt. Es geht nicht darum, ob die Zeichnungen schön sind oder nicht, sondern allein um das Gesetz. Bitte mehr Gerechtigkeit, meine Herren», gezeichnet: «eine Verehrerin der echten Kunst».
Recht hat die Dame; aber was ist echte Kunst? Oder der kultivierte Kafka-Kenner, der seine «Strafkolonie» gründlich studiert hat, wenn er «mit freundlichen Grüssen» schreibt: «Nachdem gefordert wurde, diesem Künstler müsse ein Preis verliehen werden, habe ich keine Mühe und kein Kopfzerbrechen gescheut, um eine passende Ehrung zu finden: Der kahle Körper des Künstlers soll mit Tätowierungen – ausgeführt durch die Personen, die er schädigte – verschönert werden. Damit ihm die Preisflut und der plötzliche Ruhm nicht zu Kopfe steigen, erfolgt die Tätowierung stufenweise. Höhepunkt der Ehrung bildet die Einritzung ‹Schmierfink von Zürich› auf der Stirn des Künstlers.» –
Mir verschlägt es ob dieser in Folterfantasien gipfelnden Entrüstung, mit der Volkes Stimme sich Luft machte und macht, die Sprache. Ich sage es mit den Worten meines Lehrers und Dichterfreunds Adolf Muschg:
Harald Naegeli hat seine Figuren dorthin gesprayt, wo sie gesehen werden müssen und nicht als Kunstwerke übersehen werden können; wo ihre Anwesenheit schmerzt, weil sie einen Schmerz bewusst macht, und zugleich zu einer merkwürdigen Schaden-Freude zwingt: der Bereitschaft, dem Schaden ins Auge zu blicken, den wir uns mit der Hässlichkeit unseres Lebens selbst antun; ihn als weniger zwingend zu betrachten als die Zwingmauern, die ihn dokumentieren. Naegeli hat diese Mauern gezeichnet, als Denkmäler kulturellen Ruins. Noch besser und schlimmer: er hat mit einem Streich gezeigt, wie wenig Heiterkeit sie ertragen. Nur einmal lachen, und sie stehen unglaublich und befreiend dumm da.
Naegelis Wirken im öffentlichen Raum ist das eine; im Atelier hat er ein nicht weniger bedeutendes Werk geschaffen, das – hierzulande – die wenigsten kennen. Um es entdecken zu können, müsste es erst einmal gezeigt werden; mein Vorschlag: Solange um die Sammlung Bührle nicht alles geklärt ist, Unliebsames weiter geschönt oder unter den Teppich gekehrt wird, eröffnet das Kunsthaus seinen Chipperfield-Neubau mit Naegelis Werken auf Papier.
Angefangen bei Kurt Schwitters und Hans Arp verpflichteten Collagen (deren eine mit dem Titel «Die Wespe», ohne ahnen zu können, dass das zierliche Tierchen stechen kann, das Kunsthaus seinerzeit für 900 Franken erwarb – der ich all die Jahre als Bilderhirte in den Sälen aber nie begegnete –, und nun, wie man weiss, liessen die Verantwortlichen des gleichen Hauses kürzlich erst einige unvergleichlich bedeutendere Werke, kurlige Kerle, die eines Nachts hinter Rodins Höllentor hervorsprangen, die Herrschaften, im Wissen um dessen Herkunft, so erschreckend wie Belsazar die Schrift an der Wand, umgehend wegscheuern: Sie waren nicht am richtigen Plätzli, sie waren nicht innerhalb der heiligen Mauern).
Die Collagen, Holzschnitte mit chinesischen Bergen und die hauchfeinen Radierungen ergänzt mit einer Auswahl aus den Hunderten von Notizbüchern mit Zeichnungen – Naegeli, seit Kindstagen zeichnend und, nachdem die Schule es ihm wie uns allen austrieb, dies neu lernend, zeichnet bis heute alle Tage; ob in der Natur, im Zoo, auf Reisen oder beim Gespräch hält seine Hand, einem Seismografen gleich, fest, was er sieht und ihn bewegt; nicht nur darin ist er Joseph Beuys verwandt –. Und wenn seine oft mit einem einzigen Strich gezeichneten, alles Nebensächliche offenlassenden Tierporträts von Schafen, Schweinen, Pferden mir die Kindheit auf dem Bauernhof wachrufen, evozieren ein paar über zwei Seiten flüchtig hingeworfene Linien die Silhouetten und Grate meiner Berge, ohne dass er sie zu kennen braucht … Und diese Abertausenden im Lauf der Jahre entstandenen Zeichnungen sind für ihn «nur» Studien zu seinem Hauptwerk, der «Urwolke», und – für mich nicht weniger faszinierend – der «Grossen Landschaften». Teile abgestürzter «Urwolken» überzeichnet Naegeli heute, hoch expressiv, brutal fast, und irritierender noch, als was sich in diesem Frühjahr auf den Mauern manifestierte. Aber all diese Werke müsste man, wie gesagt, erst einmal ausstellen … –
Staunend unterm Sternenhimmel
Lieber Harald, seit den achtziger Jahren, wenn nicht früher, arbeitest du, ausgehend von einem Naturverständnis als prozesshafte Einheit steter Veränderung, in höchster Konzentration am Konzept der «Urwolke» und an deinen «Grossen Landschaften», an einzelnen der inzwischen weit über 500 grossformatigen Blätter über Jahre und Jahrzehnte, die Schritte der Entstehung, den Arbeitsprozess auf den Rückseiten, ergänzt mit Notaten zum Alltag und figürlichen Zeichnungen aus dem christlich-abendländischen Vokabular, genau vermerkt. Waren die Graffiti die Manifestation im öffentlichen, politisch besetzten Raum, so sind deine grossen Zeichnungen, wie du in einem Statement schreibst, «ein Hinweis auf einen imaginären utopischen Raum, in dem es kein Oben/Unten, Hinten/Vorne, Links und Rechts gibt, sondern ‹nur› Punkte, Striche, Strukturen. Sie alle stehen in einer sehr empfindlichen anarchischen, nichtrationalen Beziehung und Ordnung mit- und zueinander»; bei meinem Naturbezug konkretisieren sich mir deine Zeichnungen mit ihrer unterschiedlichen Dynamik und in steter Wandlung auf einem Blatt dennoch zum nächtlichen Blick in einen vom Wind bewegten Laubbaum unvorstellbaren Ausmasses oder, auf einem andern, zu sich ballenden, wieder auflösenden und neu formierenden Starenschwärmen, wie man sie beim Eindunkeln über italienischen Städten kennt, auf einem dritten, kaum angedeutet, sehe ich als Memento mori einen Pferdeschädel, dass ich die geschundene Kreatur schreien höre, so sind mir deine Zeichnungen Partituren einer unerhörten Musik, Mittel, das Unmögliche zu realisieren, mir den Blick in den Kosmos zu öffnen, mich wieder staunen lassend wie als Kind unter dem Sternhimmel in den Bergen und später auf Reisen in der Sahara. –
Und ebenso lang musst du dich, anders als andere Künstler, die zufrieden sind, wenn es ihre Werke gut ausgeleuchtet ins Museum bringen, neben deiner Arbeit im Atelier gegen die wiederkehrende Vernichtung deiner Figuren im öffentlichen Raum zur Wehr setzen, indem du immer neue schaffst, bis, dir auf dem Fuss fast, wie vor ein paar Wochen erst, nachdem man die Schlösser auswechselte, um dich am Abschluss deines «Totentanzes» im Turm des Grossmünsters zu hindern, vor Zwinglis Zwingburg, von irgendeiner Behörde beordert, auch da ein Säuberungskommando auffährt, um, für einmal, als schämte man sich langsam für sein Tun, versteckt hinter Bauplanen mit der Reklametafel «Roth Gerüste: Wenn Schönes entsteht», als Vandalex-Vandalen mit ätzender Chemie und Heissdampf amtlichem Tachismus zu frönen, und wenn dieser bei Lichte betrachtet gar hässlich aussieht, wird mit Sandstrahl porentief nachgereinigt, werden Überwachungskameras installiert, damit die in den Köpfen betonierte Vorstellung von Sauberkeit, Ruhe und Ordnung, über die sich jeder Künstler, der seinen Beruf ernst nimmt, hinwegsetzen muss, nicht weiter Schaden erleide – was dabei leicht vergessen geht: Bei jedem Abwasch werden die Mauern dünner, und kein Verwüstungswerk ist gründlich genug; über Nacht trotzt dem blanken Nichts als ästhetischem Ideal spöttisch ein überlebensgrosser Tod, ist er wieder da, der Gevatter, ob Gehörnter oder mit Eulenspiegels Narrenkappe auf, wie mans halt sieht, der, auf Aussenmauern gebannt, den einen zur Freude und in der Hoffnung, er werde vor seinem Spiegelbild zurückschrecken und von der Stadt ablassen, als sensenschwingend über die Mauern tanzendes Stehaufmännchen allen eine Nase dreht, auf dass es den für ihr Zerstörungswerk Verantwortlichen in den Ohren gelle: «Wer meine Figuren tötet, der beschwört ihn sich, den Tod, der soll ihn haben …»
Jede Zeichnung ein Denk-Mal
Ja, deine Kunst ist militant, lieber Harald, in all ihren Ausprägungen, fordert heraus, und erfordert Geduld, neue Sehweisen – nicht nur bei der «Urwolke» und den «Grossen Landschaften», dem vielleicht schönsten an Zeichnung, was ich kenne –, und den Tod, Corona zeigt es, kann man nicht töten, indem man ihn in einen amtlich zugeordneten Perimeter zwängt, ihm, wenn er im Schwung aus Versehen mit einer Zehe sich über denselben hinaus auf den Boden vorwagt, solange auf die Füsse tritt, bis er aus dem Turmverlies in die Stadt ausbricht, wo mich Freund Hain jetzt mit eigenen Augen anschaut, wenn er mir, von dir in schwungvollem Gestus einer zielsicheren Körperbewegung nachts im Dunkeln ohne einmal abzusetzen oder gar korrigieren zu können mit grösster Präzision auf die Mauer gebannt, direkt dem Mittelalter entsprungen, als Künstler, wie Niklaus Manuel, für ihre Tänze mit «Ritter, Tod und Teufel», von den Zeitgenossen toleriert, noch Hunderte Meter Friedhofsmauern zur Verfügung hatten, aus Hottingen unterwegs zurück aufs Tram an einer Strassenecke entgegenhüpft, und sollte er dort eines Tages seine Luftsprünge nicht mehr machen, weil ein Fassadenfetischist glaubt, den Feind ausgrenzen zu können, indem er das Zeichen an der Wand tilgen lässt – wer macht sich schon die eignen Finger schmutzig –, wird er mir fehlen wie deine Figur, mit der du mir an der Froschaugasse über Jahre den Weg in die Zentralbibliothek gewiesen hast. –
«Naegeli», so Louis Peter in der Dokumentation zum Kölner Totentanz, «hat gezeigt, dass es nicht nur politischer Parolen und Bildinhalte bedarf, um das Auge des Passanten zu fesseln, sondern dass es darauf ankommt, an der richtigen Stelle unter Wahrung der Wandproportion bei Einbeziehung der vorhandenen Kanten, Ecken, Vorsprünge, Winkel und Treppen den Strassenbenutzer zu überraschen und anzustossen. Ihm ist es gelungen, aus jeder kleinen Zeichnung ein Denk-Mal zu machen.»
Doch lassen Sie mich mein kleines Patchwork zu Ehren von Harald Naegeli, der sich zu Recht als legitimer Erbe des Dadaismus sieht, mit Versen von Hugo Ball zusammenfassen – mitten im Ersten Weltkrieg geschrieben und im Cabaret Voltaire vorgetragen, haben sie nichts an Bedeutung, Brisanz und Brillanz verloren, und sosehr sie, wie Naegelis öffentliches Werk heute, damals irritierten, mehrsprachig, vielsprachig, wie wir alle sind, verstehen wir sie inzwischen, spätestens seit die Stadt ein Dada-Haus hat, während die Dada-Artefakte sicherheitshalber entschärft im Kunsthaus gebunkert werden, neben andersartiger Bombenbauer-Kunst …
jolifanta bambla ô falli bambla
grossiga m’pfa habla horem!
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
hej tata gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu ulu wassubada
tumba ba-humf
kusa-ga-uma
ba-humf
Lieber Harald, ich danke dir für deinen Durchhaltewillen, nicht nur, dass du unentwegt an deinem immensen zeichnerischen Werk weiterarbeitest, sondern auch allen Vandalex-Equipen zum Trotz die toten Mauern wie die Gemüter, besonders jetzt in Coronazeiten, indem du den Tod sichtbar gemacht, immer wieder zum Tanzen gebracht hast.
Reto Hänny
Geboren 1947 in einem Bündner Bergdorf, erregte Reto Hänny 1980 mit seinem Bericht über die Zürcher Jugendunruhen erstmals grosses Aufsehen als Schriftsteller («Zürich, Anfang September»). 1995 gewann er den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Im Frühjahr ist bei Matthes & Seitz sein autobiografisch gefärbtes Epos «Sturz» erschienen.
Am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr liest Hänny in der Buchhandlung Scheidegger in Affoltern am Albis (mit Viktoria Dimitrova Popova und Dorothee Elmiger).



