«Die unfassbare Vielfalt des Seins»: Raunen aus der Asche
Eben noch warnte der Autor James Bridle vor einem neuen dunklen Zeitalter, jetzt wird er in seinem neuen Werk zum Heilsverkünder. Das ist symptomatisch für die Logik eines Buchmarkts in der Krise.

Die Krise der globalen Erwärmung sei eine Krise des Geistes, eine Krise des Denkens und eine Krise des Seins. So schrieb der englische Autor und Künstler James Bridle in seinem Buch «New Dark Age: Der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft». Bald würden wir überhaupt nicht mehr denken können, warnte Bridle damals. Nach dem eben noch dunklen Zeitalter macht er nur knapp fünf Jahre später eine scheinbare Kehrtwende: «Die unfassbare Vielfalt des Seins» heisst nämlich Bridles neustes Buch. Die Zukunft gehört den «mehr-als-menschlichen Intelligenzen», wie es alle paar Seiten heisst. Und der Frage, wie wir achtsam mit ihnen zusammenleben sollen.
«Die unfassbare Vielfalt des Seins», im Original «Ways of Being», erweckt zuerst den Eindruck, es sei ein weiteres Buch über künstliche Intelligenz (KI). Bridle ist ein guter Erzähler, er kann mit persönlichen Geschichten, Erfahrungen und vielen verständlich vermittelten Lektüren in seine Themen einführen. Aber ob er ein selbstfahrendes Auto bastelt oder über die Ölförderung in Griechenland schreibt: Es folgt jeweils wenig dazu, was die neuen Technologien genau tun, welche Rolle sie zum Beispiel bei der Rohstoffförderung spielen. Wie wir, die Menschheit, mit nichtmenschlichen Intelligenzen in Verbindung treten, das sei das Thema des Buches, schreibt er im ersten Kapitel. Wie die KI tatsächlich gebaut sind (und wie sie laufend lernen), erfährt man weniger. Stattdessen wird es ein Buch über Bäume, die miteinander reden, über die Intelligenz der Tiere, wandernde Wälder, frühe menschliche Kulturen und auch über nichtbinäre Maschinen.
Tote spüren
Es ist viel von Symbiose die Rede, von Beziehungen statt von Dominanz, von Care statt von Wettbewerb. Und das ist ja weder falsch noch überraschend. Die Anthropologie entdeckt zum Beispiel kulturelle Stätten in Höhlen und Musikinstrumente, die viel älter als 40 000 Jahre sind und wohl von Neandertaler:innen stammen. Die Biologie lernt bei Meerestieren, etwa Tintenfischen, wie sie mit dezentralen Gehirnen denken. Der Begriff der Ökologie beschreibt ein neues Verhältnis, die alte Unterscheidung zwischen Mensch und Umwelt gilt als überholt: Das ist kein esoterisches Wissen mehr, schon gar nicht für die wachsende Zahl der Veganer:innen.
Bridles Buch leuchtet in viele solche Forschungszweige hinein. Auch wenn kühlere Geister die Stellen überspringen müssen, in denen Bridle viel spürt, zum Beispiel die toten Bewohner:innen frühgeschichtlicher Stätten, weil er auf einmal «in der Lage ist, sich in sie hineinzuversetzen». Wenn es darum geht, daraus Konsequenzen zu ziehen, etwa für unser Verhältnis zu aktuellen künstlichen Intelligenzen, zieht er allerdings gerne das Register des Raunens.
Pünktchen statt Ideen
Immer wenn man denkt, jetzt kommt der Punkt, kommen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen: offene Gedanken statt einer Idee, wie diese Intra-Relationen mit anderen Intelligenzen zu organisieren wären. Ein Beispiel: «Wie es tatsächlich aussehen würde, die gewaltige und ehrfurchtgebietende Macht der mehr-als-menschlichen Welt vollständig und sinnvoll in unsere Regierungssysteme und in unsere menschlichen Beziehungen einzubinden, ist – noch – schwer vorstellbar, geschweige denn umsetzbar.» Da sind wir bereits auf Seite 305 und haben schon sehr viel über «mehr-als-menschliche» Intelligenzen gelesen.
James Bridle weiss, was Programmieren bedeutet und wie eine Platine aussieht – ein Mann, der weder vor dem Code noch vor dem Lötkolben zurückschreckt. Deshalb ist Bridle ein gern gesehener Vortragender, wenn jemand erklären muss, was künstliche Intelligenz bedeutet. Vielleicht auch deswegen, weil er es dann selten genauer erklärt. Wichtiger scheint der Gruselgedanke: Warum wir kurz vor dem Ende sind (wer wollte das bestreiten). Und was uns – vielleicht, bald, womöglich – rettet. Bridle nimmt dabei zwei verschwisterte Posen ein: die des Untergangspredigers und die des Heilsverkünders. Um das Neue, das im aktuellen Buch vor allem Forschung referiert, als besonders neu zu verkaufen, muss das Alte in die Tonne getreten werden. Von Aristoteles bis Descartes war die Menschheit pauschal auf dem Holzweg der Hybris, schreibt er einmal. Allein, das wird ja jetzt alles anders.
Es ist zu vermuten, dass an diesen Stellen tatsächlich eine alternative Intelligenz spricht und nicht unbedingt die des durchaus schlauen Autors. Es spricht die Logik des Marktes, und weil wir über Sachbücher reden, reden wir über einen kriselnden Markt auf Talfahrt. Die Tendenz zeigt zur dünnen Spitze: Verlage verdienen nur noch mit wenigen Titeln Geld, während das Mittelfeld einbricht. Bestseller und Noseller sind kein neues Phänomen, aber die Schere dazwischen geht auf. Vermutlich geht diese wachsende Ungleichheit auf algorithmische Empfehlungssysteme zurück: Bei Onlinehändlern wie in sozialen Medien verteilen die unsichtbaren Algorithmen die Aufmerksamkeit um – weg von der Mitte, hin zur Spitze.
Aktuell kommen die Papierknappheit und die gestiegenen Produktionskosten noch obendrauf. Die Verlage stehen in einem ernsthaften Verteilkampf, viele befürchten weitere Konzentration, konkret: das Ende vieler kleiner und mittlerer Verlage sowie Stellenabbau auch bei grösseren Qualitätshäusern. In so einem wirtschaftlichen Umfeld punktet man nicht mit Komplexität, sondern mit Emotion. Etwa mit dem beliebig veränderbaren Sachbuchtitel in der Art von: «Warum wir alle sterben werden (und zehn Tipps, wie wir dennoch überleben)».
Nun gibt es nicht nur den einen Sachbuchmarkt. Es gibt den akademischen Publikumsmarkt, den seriösen (auf dem Bridle gehandelt wird) und das richtig populäre Segment mit dem endlosen Strom an Titeln zur Optimierung des Selbst oder der Manipulation des beruflichen Umfelds. Im Selbsthilfemarkt sind eindeutige Aussagen das Geschäftsmodell. In diesem Umfeld setzt auch der seriöse Publikumsmarkt auf eine Rhetorik der Eindeutigkeit. Bei Bridle lässt sich das etwa so zusammenfassen: Alles lebt und denkt, und wenn wir das anerkennen, kommen wir durch sämtliche Krisen der Gegenwart. Wie das genau geschehen soll, ist dann leider zu komplex.
Selbst in mehreren nationalen Märkten verlegte Autor:innen wie Bridle können sich nicht mehr unbedingt darauf verlassen, dass die Verkäufe allein ein gutes Auskommen garantieren. Die Wetten laufen im Anschluss an eine Publikation auf Lesungen, Vorträge, Talkshows. Da nähert sich der Buchmarkt dem Musikbetrieb an, der das schon viel länger kennt: Konzerte sind wichtiger als Tonträger, Lesungen gegebenenfalls gewinnbringender als Vorschüsse oder auch Tantiemen, falls das Buch doch besser läuft als gedacht.
Rhetorik des Untergangs
Aber vielleicht liegt in der Verschiebung vom einsamen Lesen zum kollektiven Zuhören und Diskutieren auch eine Chance. Autor:innen lernen manchmal erst auf Reisen, was sie wirklich geschrieben haben. Und auch, was sie nicht geschrieben haben. Was fehlt, was sie beim nächsten Mal besser machen können. Auf die Gefahr hin, selbst dem Kulturpessimismus und der verführerischen, aber ungenauen Rhetorik des Untergangs nachzugeben: Gerade Lesungen unterhalb der Bestsellergrenze haben neuerdings Mühe, ihr Publikum zu finden. Manche bleiben auf einmal halb leer. Was vielleicht doch wieder hilft, ist die Einsamkeit der Lektüre eines (bitte!) bezahlten Buches. Das ist schliesslich auch eine Form der Achtsamkeit und der Symbiose verschiedener Intelligenzen: jener des Autors und der Leserin zum Beispiel.
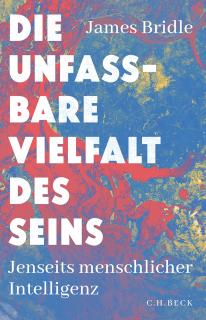
James Bridle: «Die unfassbare Vielfalt des Seins. Jenseits menschlicher Intelligenz». Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Verlag C. H. Beck. München 2023. 432 Seiten. 42 Franken.

