Auf allen Kanälen: Für ein Häufchen Kot
Wie sich die spanische Satirezeitung «Mongolia» gegen ultrakatholische und franquistische Vereine wehrt.
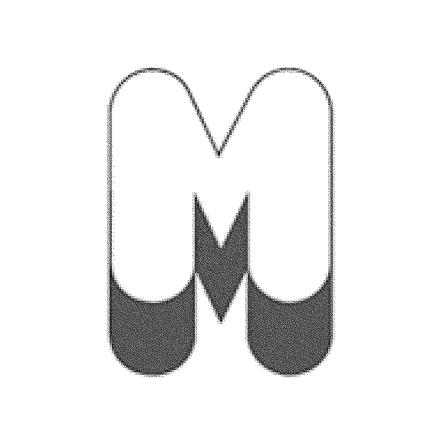
Vergangenen Dezember, pünktlich zur Weihnachtszeit, verkündete die spanische Satiremonatszeitschrift «Mongolia» die Geburt Jesu auf ihrer Titelseite. Allerdings waren auf der Karikatur rund um die Krippe nicht nur María und José versammelt, sondern war auch noch ein kleines braunes Häufchen zu sehen – mit grossen Augen und breitem Lächeln und einem Heiligenschein über dem Haupt. Das Kot-Emoji «gleiche dem Vater», war neben dem Bild zu lesen.
Postwendend reichte der Verein Fundación Española de Abogados Cristianos (Spanische Stiftung christlicher Anwälte) über ihre Präsidentin, die medial sehr präsente Anwältin Polonia Castellanos, wegen des Covers Klage gegen «Mongolia» ein. Zugleich klagte die ultrarechte Onlineplattform hazteoir.org (Mache, dass man dir zuhört!), die zuletzt mit ihren Kampagnen gegen Sexualunterricht an Schulen, die Fristenlösung oder die Verbesserungen der Gesetzeslage für trans Personen ihre fanatischen Anhänger:innen mobilisierte. Inzwischen kamen noch zwei weitere Klagen dazu.
Verletzte Gefühle
Die Klagen lauten auf «Verletzung religiöser Gefühle» sowie «Geldwäsche aus dem Drogenhandel» – Letzteres richtet sich gegen den Anwalt und Ex-«Mongolia»-Teilhaber und -Mitbegründer Gonzalo Boye. Juristisch bezieht sich dies darauf, dass Boye als Strafrechtler galicische Drogenhändler:innen sowie ehemalige ETA-Terrorist:innen verteidigt.
Das 2012 gegründete Magazin «Mongolia» publiziert neben Satirebeiträgen auch hintergründige Berichte und Reportagen über die spanische Politik. Die in der Nähe von Barcelona produzierte Monatszeitschrift hat eine Auflage von knapp 8000 Stück und finanziert sich grösstenteils über Abonnent:innen und den Kioskverkauf. Immer wieder provoziert «Mongolia» mit ihrer Satire ultrakatholische Gruppierungen, die dann klagen. Laut Artikel 525 des spanischen Strafgesetzbuchs sind das «Verletzen religiöser Gefühle» oder «jeglicher Spott gegen Glaubensrichtungen» strafbar. Allerdings machen sich diesen Paragrafen in erster Linie franquistische und nationalkatholische Organisationen immer wieder zunutze, um Künstler:innen, Musiker:innen, Aktivist:innen, Politiker:innen und nicht zuletzt Satiriker:innen ins Visier zu nehmen.
Treffen mit Darío Adanti: Der argentinische Satiriker, Illustrator, Zeichner lebt seit 1997 in Spanien und leitet mit Edu Galán, Fernando Rapa und Pere Rusiñol die Zeitschrift. Er ist überzeugt: «Für die ‹Verletzung religiöser Gefühle› wurde eine juristische Anomalie strafgesetzlich verankert. Kein Gericht der Welt kann über Gefühle urteilen.» Sonst müsste es dann ja auch Sachverständige, Mediziner, Forensiker geben, die das prüften, scherzt er. Die Klagen seien daher lächerlich. Siebzig Prozent der von den Abogados Cristianos oder hazteoir.org angestrengten Verfahren würden ohnehin abgewiesen oder im Freispruch enden, so Adanti. Er geht jedoch davon aus, dass mindestens eine der Klagen gegen das Dezembercover zum Prozess führen wird. «Wenn sich die Strafe auf 10 000 Euro beläuft, sind die Anwaltskosten mindestens genauso hoch. Und wenn man verliert, hat man auch noch die Kosten der Anwält:innen der Anklage zu tragen.» Das wären im Fall eines Schuldspruchs mindestens 50 000 Euro – etwa die Hälfte des Jahresumsatzes von «Mongolia».
«Wenn wir verurteilt werden, müssen wir ‹Mongolia› einstellen», sagt Adanti. Es gehe den Gegner:innen nur darum, sie zu ruinieren, ist er überzeugt. Finanziell ist «Mongolia» bereits jetzt angeschlagen. Erst im Januar verlor das Magazin einen Prozess gegen José Ortega Cano. Der Stierkämpfer, der rechtsextremen Kreisen nahesteht, war unter anderem wegen Ehrverletzung vor Gericht gezogen – was das Blatt rund 140 000 Euro kostete. Dies konnte zum Teil über ein Crowdfunding gedeckt werden, das Magazin bringt den Fall zudem nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Geld dank Religion
Adanti ist überzeugt, dass Vereine wie Abogados Cristianos oder hazteoir.org mit den vielfachen Klagen eine Art Geschäftsmodell begründet haben. «Das sind einfach nur Betrüger, die die Religion nutzen, um Geld zu scheffeln», sagt er. Mit den Mehreinnahmen aus der Crowdfundingkampagne, die nach knapp einem Monat über 19 000 Euro einbrachte, will Adanti gemeinsam mit Kolleg:innen in die juristische Gegenoffensive gehen. Und besagte Vereine und Organisationen im Gegenzug wegen Falschanzeige und Belästigung vor Gericht bringen.
