Auf allen Kanälen: Trauriger Rekord
In keinem Krieg wurden je so viele Medienschaffende getötet wie bislang in Gaza. Das gefährdet die unabhängige Berichterstattung weltweit.
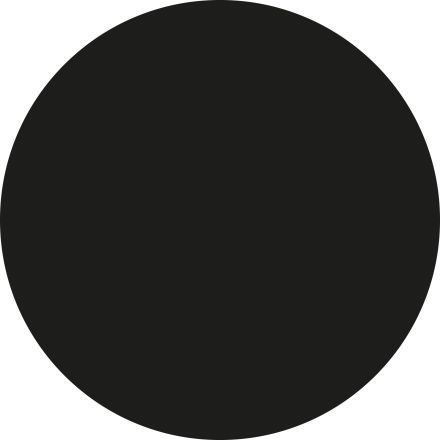
Seit dem 8. Oktober 2023 verweigert Israel internationalen Journalis:tinnen die Einreise in den Gazastreifen. Sie können nicht selbst sehen und fotografieren, nicht selbst hören und mit den Menschen auf den Strassen sprechen. Also übernehmen das diejenigen, die vor Ort sind: palästinensische Journalist:innen in Gaza. Sie schicken die Bilder, die wir nicht sehen sollen: von abgemagerten Babys; von Eltern, die ihre verwundeten Kinder über Schutt in den Strassen tragen; von Chaos an den Verteilstationen für Nahrungsmittel. Sie liefern Sätze, auf die sich Journalist:innen weltweit in ihrer Berichterstattung stützen.
Was, wenn es sie nicht mehr gibt? Der Krieg in Gaza ist auch für Journalist:innen tödlich. Von 220 getöteten Medienschaffenden spricht die NGO Reporter ohne Grenzen (RSF). Laut dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin «Foreign Policy» war der Gazakrieg für Journalist:innen schon jetzt tödlicher als der amerikanische Bürgerkrieg, der Erste und Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, die Kriege in Jugoslawien und der Krieg in Afghanistan nach dem 11. September 2001 zusammen.
Zumindest in Teilen geht das israelische Militär gezielt gegen Medienschaffende vor. Explizit bestätigte es dies im Fall des Al-Dschasira-Korrespondenten Anas al-Scharif, der am 11. August mit vier seiner Kolleg:innen in einem Zelt des katarischen Fernsehsenders getötet wurde: Scharif habe, so die Rechtfertigung, eine Terrorzelle der Hamas angeführt. Bei einem weiteren Angriff am 25. August auf das Nasser-Spital in Chan Junis hingegen sprach der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einem «tragischen Missgeschick». Allerdings ging das israelische Militär allem Anschein nach mit einem «double tap» vor: Acht Minuten nach dem ersten Angriff folgte ein zweiter. Insgesamt kamen dabei fünf Journalist:innen ums Leben. Einige von ihnen waren laut RSF zum Ort des Geschehens gekommen, um über die Rettungsmassnahmen zu berichten.
Unter Generalverdacht
Was Journalist:innen einst doppelt schützte – eine kugelsichere Weste mit der Aufschrift «Press» –, macht sie womöglich nun zum Ziel. In der Regel geben Medienhäuser an die Kriegsparteien durch, wo sich ihre Reporter:innen befinden, damit sie nicht angegriffen werden. Die Nachrichtenagentur Reuters hat Angaben des US-amerikanischen Senders NBC zufolge damit aufgehört, Israel darüber zu informieren, wo sich ihre Mitarbeiter:innen befinden – um sie zu schützen.
Das Misstrauen gegenüber der Berichterstattung ist in diesem polarisierenden Krieg denkbar gross – und für einige stellt sich dabei auch die Frage: Wann ist ein:e Journalist:in ein:e Journalist:in? Tatsächlich ist es in diesem Krieg, der von vielen Seiten propagandistisch geführt wird, notwendig, genau hinzuschauen, wer Informationen liefert. Der getötete Al-Dschasira-Reporter Anas al-Scharif ist nicht der Erste, bei dem diese Frage auch in den Medien hitzig diskutiert wird. Für Israels Behauptung, Scharif habe eine Hamas-Terrorzelle geleitet, fehlen bislang allerdings Belege. Was es gibt, sind Hinweise, dass er Sympathien für die Hamas hegte. Während des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 beklatschte er Medienberichten zufolge in einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf seinem Telegram-Kanal das Gemetzel an der Zivilbevölkerung als Heldentat. Entscheidend ist laut Genfer Konvention, ob Scharif an Kampfhandlungen beteiligt war, wofür es keine Hinweise gibt.
Doch in der angespannten Lage wiegt der Generalverdacht gegen palästinensische Journalist:innen, der Hamas nahezustehen, umso schwerer – und ist brandgefährlich. So wie nicht alle Israelis die Politik ihrer Regierung unterstützen, so folgen auch nicht alle Palästinenser:innen in Gaza den Ideen der Hamas.
Medien müssen Zugang haben
Über 270 Medien weltweit, koordiniert von RSF und der Kampagnenbewegung Avaaz, schwärzten am 1. September ihre Titelseiten oder publizierten Sonderseiten zum Thema. Auch die WOZ war am Aufruf von RSF beteiligt. Dessen zentrale Forderungen: besserer Schutz für die in Gaza arbeitenden Medienschaffenden, Notfallevakuierungen und Zugang für internationale Journalist:innen.
RSF weiss, was auf dem Spiel steht: wenn schon nicht die Wahrheit, dann doch die Möglichkeit, nach ihr zu suchen. Genauso wie die Frage, ob Journalismus in einer Welt, in der er systematisch angegriffen wird, überhaupt noch bestehen kann.