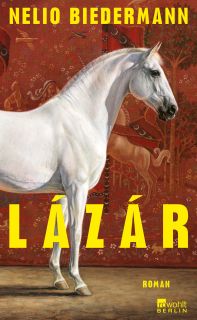Roman: Die Talentprobe
Der Literaturbetrieb als fiebrige Aufmerksamkeitsmaschine: Warum der Hype um Nelio Biedermanns «Lázár» am Ende niemandem etwas bringt. Zuletzt dem Autor und den Leser:innen.

Kann ein Buch bereits eine «Sensation» und ein «Ereignis» sein, obwohl es gerade erst in die Auslagen der Buchläden gestapelt wurde? Es kann. Zumindest behaupten dies nicht wenige Kritiker:innen und andere Notabeln des Literaturbetriebs. Unter lautem Applaus und viel Vorschussehrfurcht ist Ende August der zweite Roman des 22-jährigen Thalwilers Nelio Biedermann erschienen. «Ein wirklich grosser Schriftsteller betritt die Bühne, im Vollbesitz seiner Fähigkeiten», bebt Daniel Kehlmann im Klappentext.
Garniert sind die Hymnen mit den immer gleichen Zugaben: «Lázár» werde gerade in neunzehn weitere Sprachen übersetzt, der renommierte Rowohlt-Verlag habe die Rechte noch vor Erscheinen der Originalausgabe in zwanzig Länder weiterverkauft, der Autor soll einen sechsstelligen Vorschuss erhalten – und sein Werk von Hand geschrieben haben.
Mit viel Lob verstellt
Die meisten dieser begeisterten Kritiker:innen haben Biedermann getroffen, sind mit ihm durch Zürich spaziert, berichten von seiner Bescheidenheit, seiner Schreibdisziplin, zitieren seine abgeklärten Worte. SRF ist – auf den Spuren des Romans – gar mit ihm nach Ungarn gereist. Dazu zeigt man uns das Porträt eines ernsten, etwas scheu dreinblickenden jungen Manns mit Schnauzbart. Er ist ein Nachfahre ungarischer Adliger, die 1956 nach der sowjetischen Niederschlagung des demokratischen Aufstands in die Schweiz geflüchtet sind. Mit einer solchen Flucht endet auch sein Roman, nachdem zuvor auf gut 300 Seiten das wechselhafte Schicksal dreier Generationen der fiktiven ungarischen Adelsfamilie Lázár an einem halben Jahrhundert osteuropäischer Geschichte gespiegelt wurde.
Es wäre viel einfacher, über «Lázár» zu schreiben, wäre das Buch nicht schon vorneweg mit so viel Lob, Superlativen und einer quasi unvermeidlichen Weltkarriere verstellt worden. Wenn die «Zeit» nicht gleich im ersten «Lázár»-Artikel überhaupt den ganz grossen Vergleich ausgepackt hätte: Biedermann sei «der neue Zauberer», sein Roman vergleichbar mit den «Buddenbrooks». Ginge Anerkennung nicht auch eine Nummer kleiner?
Man muss Thomas Mann und sein nobelpreisgekröntes Epos über den Niedergang einer Lübecker Kaufmannsfamilie nicht mal sonderlich mögen, um zu begreifen, wie unsinnig dieser marktschreierische Vergleich ist – und wie er Biedermann mittelfristig wohl eher schaden als nützen wird. Das heisst aber wiederum auch nicht zwangsläufig, dass «Lázár» kein gutes Buch wäre.
Was macht Biedermann? Man kann es vielleicht so beschreiben: Er macht Literatur aus Literatur. Nicht nur streut er zahlreiche Autor:innennamen und Buchtitel in seine Erzählung und lässt wie aus dem Nichts Bücher auf den Nachttischen seiner Figuren auftauchen, sondern er schmuggelt auch Sätze aus der Weltliteratur – den berühmten Anfang von Marcel Prousts «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» etwa und den Schluss von James Joyce «Die Toten» – in seinen Text. Oder, raffinierter: Er stellt eine Gedichtzeile von Alfred Lichtenstein als Motto an den Anfang – und baut eine weitere Zeile desselben Gedichts als kleine Szene in die eigene Prosa. Der Erkenntnismehrwert dieser Zitiertechnik ist allerdings gering: Es macht wohl einfach Freude, solche ikonischen Sätze zu zitieren – und beim Lesen aufzuspüren.
Blutdurstige Jagdhunde
Dazu verwendet Biedermann Aspekte und Anekdoten aus der eigenen Familiengeschichte. Und er stellt die neue Familiengeschichte seines Romans in die Kulissen der ganz grossen Weltgeschichte: Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, ungarische Nachkriegszeit, Enteignungen, Stalins Tod. Das Problem ist, dass diese Weltgeschichte in «Lázár» wie aus Wikipedia zusammengeschrieben wirkt, wie Lukas Bärfuss im SRF-«Literaturclub» treffend bemerkt hat.
Das andere Problem sind die exaltierten Sprachbilder, die mal glücken, aber oft eben auch nicht: Die Jahre «zogen wie die Roma mit ihren Pferden und Zirkuswagen durch das Habsburgerreich». Eine liebeskranke Figur hat das Gefühl, «von einem ganzen Rudel blutdurstiger Jagdhunde zerrissen zu werden», ein Gedanke durchbohrt «wie eine Kugel». Einmal wird der Schlaf als «Vergewaltiger» bezeichnet, dreissig Seiten weiter ist wiederum der Schriftsteller «ein Vergewaltiger der Existenzen». Derlei Wiederholungen und ein paar lose Enden lassen auch auf ein etwas hastiges Lektorat schliessen.
Trotz alledem: «Lázár» liest sich flott. Man hat allerdings vieles schon nach kurzer Zeit wieder vergessen. So wie es auch schwerfällt, diesem rasanten, aber etwas geheimnisarmen Erzählwerk eine Deutung abzuringen: Es steht ja schon fast alles offen da, fügt sich in Bekanntes, anderswo Gelesenes. Einzelne Kapitel haben den Charme unfertiger Novellen. Aber der allwissende Erzähler verliert auch immer wieder das Interesse an Ideen und Figuren.
Und die Literaturkritik? In einer klick- und quotengetriebenen Medienwelt hat sie mit ihren Büchern und Rezensionen einen schweren Stand. Die Feier eines genialen neuen Schriftstellerstars und überhaupt die ganze aufgeregte Euphorie über «Lázár» – zu der sich bald auch ein paar kritische Besprechungen gesellten – sind auch Symptom einer unbeständigen Aufmerksamkeitsökonomie: Um in ihr zu bestehen, erklärt man die unbestreitbare Talentprobe gleich direkt zum Meisterwerk.