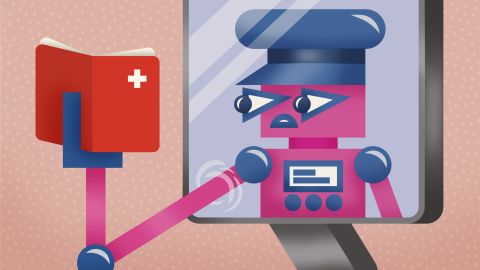Elektronisches Gesundheitsdossier: Unnötige Zentralisierung
Erik Schönenberger von der Digitalen Gesellschaft sieht die neue Vorlage für das elektronische Gesundheitsdossier kritisch. Sie schaffe mehr Risiken als Nutzen.
2015 verabschiedete das Parlament das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier, ab 2020 wurde das Dossier schrittweise eingeführt. Doch gerade einmal rund 125 000 Menschen besitzen heute ein solches. Das liegt unter anderem daran, dass sowohl die Eröffnung eines Dossiers für Patient:innen wie auch die Teilnahme für ambulante Leistungserbringer:innen freiwillig ist. Ausserdem wissen die meisten Menschen gar nicht, dass es das elektronische Patientendossier gibt, und der Registrierungsprozess ist sehr umständlich. Nun hat der Bundesrat eine «grundlegende Neuausrichtung» angekündigt und will das bestehende Modell durch ein neues «elektronisches Gesundheitsdossier» (E-GD) ersetzen. Anfang November ging der Gesetzesentwurf ans Parlament. Erik Schönenberger übt scharfe Kritik an der Vorlage. Er ist Kogeschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft, einer der einflussreichsten Stimmen in der Schweizer Digitalpolitik.
WOZ: Erik Schönenberger, die Digitale Gesellschaft hat den elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) bei der Abstimmung im September unterstützt. Die neue E-GD-Vorlage lehnt sie hingegen entschieden ab. Wo liegen die Unterschiede?
Erik Schönenberger: Die E-ID kam zwei Mal an die Urne. 2021 haben wir opponiert, weil eine zentrale Datenbank vorgesehen war, mit der sämtliche Identitätsdaten bei privaten Herausgeber:innen gelandet wären. Die zweite Vorlage war viel datenschutzfreundlicher und damit tragbar. Man kann digitale Systeme so gestalten, dass Privatsphäre und Datensicherheit gewahrt bleiben und sie trotzdem funktionieren. Das gilt auch für das E-GD.
WOZ: Was stört Sie konkret an der aktuellen E-GD-Vorlage?
Vorweg: Wir befürworten die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sie birgt viel Potenzial und ist notwendig. Die Schweiz hat einen Nachholbedarf. Aber: nicht um jeden Preis. Digitalisierung darf nicht auf Kosten der informationellen Selbstbestimmung gehen. Unsere Kritik konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Punkte.

Digitale Gesellschaft.
WOZ: Die wären?
Erstens: der Wechsel von einem freiwilligen Opt-in-System zu einem Opt-out-Modell. Der Bund möchte also für alle automatisch ein Dossier einrichten, und wer das nicht will, muss aktiv widersprechen – und wird im System entsprechend registriert. Damit geht die Freiwilligkeit verloren.
Zweitens: Sämtliche Leistungserbringer sollen verpflichtet werden, das Dossier automatisch mit allen behandlungsrelevanten Gesundheitsdaten zu füllen. Das heisst: Mein gesamter Gesundheitsverlauf wird abgebildet, von der Wiege bis zur Bahre – selbst wenn ich das Dossier nie benutze. Es wird also faktisch zwangsweise gefüllt. Das ist ein massiver Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung.
WOZ: Und drittens?
Erik Schönenberger: Die Daten sollen zentral beim Bund bearbeitet werden. Das sind hochsensible Informationen mit besonderem Schutzbedarf, aber diese Architektur schafft erhebliche Risiken wie Datenmissbrauch, staatliche Einsicht und systemische Angriffsflächen für Hacker:innen. Entscheidend ist aber vielmehr: All das ist weder technisch noch organisatorisch notwendig. Man könnte es problemlos anders gestalten, ohne eine zentrale Bearbeitung der Gesundheitsdaten der gesamten Bevölkerung.
WOZ: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) argumentiert, wenn die Daten lokal auf einem Smartphone gespeichert seien – wie bei der E-ID – und das Smartphone verloren gehe, seien sie praktisch unwiederbringlich verloren. Gesundheitsakten lassen sich nicht einfach ersetzen.
Erik Schönenberger: Die Daten aufs Smartphone auszulagern ist tatsächlich nicht praktikabel – das fordern wir auch gar nicht. Im Notfall müssen Gesundheitsdaten auch dann verfügbar sein, wenn ich bewusstlos bin oder mein Handy kaputt ist.
WOZ: Was fordern Sie dann?
Erik Schönenberger: Es ist wichtig zu verstehen, dass das Gesundheitsdossier die IT-Systeme der Leistungserbringer, also der Spitäler oder Arztpraxen, nicht ersetzt. Daten, die in diesen Systemen erfasst werden, sollen zusätzlich in das Dossier übernommen werden, damit sie zusammengeführt werden können. So sind alle relevanten Informationen auf einen Blick für die beteiligten Akteure verfügbar – Spital, Spezialistin, Hausarzt. Das ist an sich sinnvoll. Aber dafür müssen die Daten nicht zentral beim Bund bearbeitet werden.
Erik Schönenberger: Man kann das lösen, indem die Daten kryptografisch gesichert und Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Der Schlüssel in Form eines komplexen Codes oder Passworts liegt dezentral bei den Patient:innen. Diese können diesen Schlüssel dann, vereinfacht gesagt, weitergeben und entscheiden, welche Institutionen oder Ärztinnen auf welche Daten zugreifen dürfen. So bleibt die Kontrolle dort, wo sie hingehört – bei den betroffenen Personen. Damit ist die Frage nach dem Speicherort sekundär.
WOZ: Würde das nicht die digitalen Kompetenzen eines grossen Teils der Bevölkerung übersteigen?
Erik Schönenberger: Ich halte das für zumutbar. Auch beim E-Banking oder bei Kreditkarten müssen Menschen ihre Logins und Zugangsdaten selbst verwalten. Diese Möglichkeit anzubieten, heisst, sie als mündige Bürger:innen ernst zu nehmen. Und für alle, die das nicht wollen oder können, braucht es weiterhin klassische Wege der Behandlung und Dokumentation – ohne jede Benachteiligung.
WOZ: Der Bund hat über zwanzig Jahre lang versucht, eine dezentrale Lösung mit kantonalen Stammgemeinschaften aufzubauen – ohne Erfolg. Sie selbst haben zum E-ID-Gesetz einmal gesagt: «Kein Gesetz ist perfekt.»
Erik Schönenberger: Das stimmt, aber der Grundgedanke muss stimmen. Bei der jetzigen Architektur – mit Zentralisierung und Opt-out – tut er das aus unserer Sicht nicht. Diese Vorlage hat aus meiner Sicht an der Urne keine Chance. Und es wird zu einer Abstimmung kommen. Das erste Scheitern der E-ID und die knappe Annahme im zweiten Anlauf zeugen von einem tiefen Misstrauen der Bevölkerung gegenüber dem aktuellen Umgang mit unseren Daten. Für das E-GD in der vorliegenden Form sehe ich daher schwarz.
Erik Schönenberger: Wir brauchen ein gutes Gesetz mit einer überzeugenden Architektur. Freiwilligkeit gehört zwingend dazu. Wenn das System die Behandlungsqualität verbessert und die Handhabung der Daten vereinfacht, werden die Leute von selbst ein Dossier eröffnen – vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit.
WOZ: Und wie soll es jetzt weitergehen?
Erik Schönenberger: Die Vorlage muss an den Bundesrat zurückgewiesen werden mit dem Auftrag, das Gesetz von Grund auf neu zu gestalten. Dann könnte das BAG die Eckpunkte überarbeiten und eine passende Architektur entwickeln. Zahlreiche Detailfragen müssen in Ruhe neu durchdacht werden, bevor man ein Gesetz verabschiedet.
WOZ: Das kostet Zeit.
Erik Schönenberger: Eine zusätzliche Runde braucht Zeit, ist aber immer noch schneller, als mit einer schlechten Vorlage vor dem Volk zu scheitern und dann von vorn zu beginnen.