Sachbuch: Was Engels mit Marx’ Erbe machte
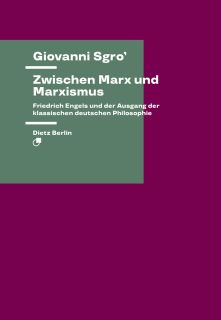
Das Spektrum der Antworten auf die Frage, wie das intellektuelle Verhältnis von Karl Marx und Friedrich Engels zu bewerten sei, ist denkbar breit: Es reicht von der Behauptung einer Symbiose oder einer in vielen Belangen produktiven Zusammenarbeit bis hin zur Idee von der Existenz eines «Engelsismus», der die Kritik der politischen Ökonomie – insbesondere durch Engels’ editorisches Eingreifen in die posthum veröffentlichten «Kapital»-Bände – und damit die marxistische Theorie extrem verflacht habe. Engels gilt als der Erfinder des Marxismus als Weltanschauung, im Guten wie im Schlechten; darauf können sich die meisten einigen.
Sgro’ legt nun einen schmalen, aber unheimlich dichten Band zu dieser Debatte vor. Er zeichnet in Auseinandersetzung mit der bestehenden Literatur in fünf Kapiteln Engels’ philosophischen Weg ab 1873, zunächst noch mit Marx an der Seite, nach. Gegenstand sind Engels’ «Dialektik der Natur», sein Feuerbach-Buch, die materialistische Geschichtsauffassung und nach Marx’ Tod die Arbeit für und an dessen Vermächtnis. Sgro’ kommt zum Schluss, dass Engels am Ende seines Lebens «nahezu wortwörtlich dieselben Interpretationen der hegelschen Dialektik und der feuerbachschen Philosophie» wiederholt habe, die er schon in den 1840er Jahren erarbeitet hatte: Er habe also keine Hegel-Kritik von der marxschen Qualität geleistet, sondern sei immer auf dem Standpunkt der Junghegelianer verblieben. Von einer Symbiose kann demnach keine Rede sein.
Fein zeichnet Giovanni Sgro’ die Unterschiede im Denken von Marx und Engels nach und zeigt auf, wie Letzterer an der Entstehung dessen, was dann zum historisch-dialektischen Materialismus werden sollte, mitwirkte. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis rundet den lesenswerten Band ab, der in einer früheren Version bereits 2017 auf Italienisch erschienen ist.