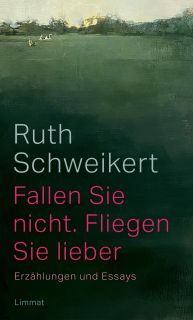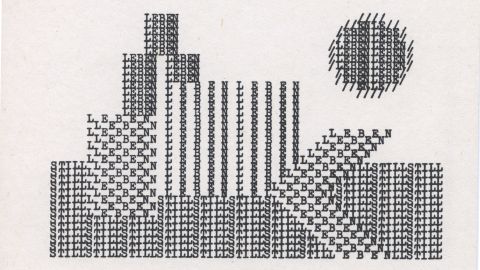Literatur: In der Zauberkiste
Ruth Schweikert konnte alles in Dichtung verwandeln. Wie virtuos, humorig und radikal sie das tat, zeigt ein neuer Sammelband mit verstreuten Texten.

Literatur, betonte Ruth Schweikert immer wieder, muss eine Zumutung sein. Und Schreiben eine Anmassung. Natürlich meinte sie damit weder plumpe Provokation noch selbstherrliche Welterklärungsprosa. Im Gegenteil: Ihre Texte sind zwar wild und heftig, sie sind aber immer auch Protokolle einer Suche, mutige Balanceakte auf dem Drahtseil der Sprache, ohne Sicherheitsnetz. Das Fallen/Stürzen/Einbrechen/Straucheln zieht sich in verschiedenen Variationen durch den Sammelband «Fallen Sie nicht. Fliegen Sie lieber», der jetzt posthum erschienen ist. Doch wie es der Titel sagt, führt längst nicht jeder Sturz in einen Abgrund, und selbst wenn, so kann es durchaus geschehen, dass sich ein Familienvater vor dem tödlichen Aufprall überraschend in einen Pinguin verwandelt.
Der Durchbruch als Schriftstellerin gelang Schweikert einst mit Erzählungen, und auch wenn ihre Romane ebenfalls überzeugten: Ihre Virtuosität und ihr unbedingtes, radikales Bekenntnis zur Literatur als eine durch nichts zu ersetzende Weise des Weltzugangs kommen in der kurzen Form besonders zur Geltung. Wie sie jede Textsorte in Dichtung verwandeln konnte, wird an der vielleicht zufälligen, aber in ihrer Vielfalt charakteristischen Auswahl deutlich. Der Band enthält unter anderem Auftragsarbeiten für Medien wie die «Berner Zeitung», die NZZ oder SRF, aber auch für die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und für das Vorstadttheater Basel, sowie mehrere Spielfilm-Outlines, die gerade wegen ihrer knappen, reduzierten Form so viel Kopfkino erzeugen, dass sich eine Verfilmung eigentlich erübrigt.
Unrettbar verloren
Die Herausgeber – ihr Witwer Eric Bergkraut, ihr Sohn Raphael Schweikert und ihr Kollege Martin Zingg – haben die Texte zusammengesucht, in Zeitungen, Zeitschriften und im Computer, denn Schweikert hat sich nie um die Archivierung ihrer Arbeit gekümmert. Auch das passt zu ihr. Eine gewisse Nachlässigkeit im Umgang mit dem eigenen Werk, vielleicht auch ein Desinteresse an der eigenen Stilisierung zum Monument. Dass sie dafür teuer bezahlte, beschreibt sie in einer Kolumne mit dem Titel «Die Furie des Verschwindens», die im Stellenmarkt-Portal «NZZexecutive» erschien: Als «die einzige Festplatte meines einzigen Laptops eines Morgens ohne vorausgegangene Krankheitsanzeichen dahinschied», verlor sie «sämtliche Artikel, ungefähr 4000 über die Jahre aufbewahrte E-Mails, diverse Buchfassungen, Notizen und Zitatesammlungen, aber auch alles, woran ich seit Jahren und Monaten arbeitete, ein neuer Roman, ein neues Theaterstück, Vorträge, Auftragstexte und so weiter.» Die Texte sind unrettbar verloren, da es – «sträflich unprofessionell» – keine Sicherheitskopie ihres Laptops gab und auch die «Computercracks» die Inhalte nicht wiederherstellen konnten.
Es ist bezeichnend, dass Schweikert aus diesem «persönlichen Super-GAU als Berufsfrau» nicht nur eine humorige Kolumne für Kaderleute auf Stellensuche macht, sondern auch eine Allegorie der Gegenwart. In der «Furie des Verschwindens» erkennt sie einen Geist, der «Sorge trägt, dass niemand seine Grenzen überschreite» und deshalb laufend Information vernichte – «was womöglich eben das Informationszeitalter charakterisiert: die permanente Gegenwart, die laufende Aktualisierung, die zu vernichten droht, was letztlich das Kerngeschäft der Autorinnen ist: sich zu erinnern».
Die Reflexion über Autor:innenschaft, über die Beziehung von Sprache und Welt und den Akt des Schreibens ist in ihren Texten stets präsent, als wäre es ihr ein Anliegen, den Entstehungsprozess selbst über das Ergebnis zu stellen. «Worauf will ich hinaus? Wenn ich es jetzt schon wüsste, ich bräuchte diesen Text nicht zu schreiben», heisst es in einem Vortrag über Annemarie Schwarzenbach. Und an anderer Stelle: «Das Zirkuszelt der Wortakrobaten ist aufgespannt, und die Autorin verschwindet in der Zauberkiste, wo sie beim Schreiben vom Schreiben zersägt wird.»
Ständig im Austausch
Ruth Schweikert, das macht auch dieser Band deutlich, stand in einem ständigen Austausch mit anderen Autor:innen, lebenden und längst verstorbenen. In Rezensionen und Porträts (etwa zu Gertrud Leutenegger und Natalia Ginzburg) sowie Vorträgen (über Robert Walser, Christina Viragh und andere) verwebt sie das Schaffen ihrer Kolleg:innen mit der eigenen Lektüre- und Schreiberfahrung und ermöglicht so immer wieder überraschende Perspektiven auf bekannte und weniger bekannte Schriftsteller:innen und deren Werk. In einer Rezension zu Elfriede Jelineks «Die Kinder der Toten» wagt sie gar eine stilistische Mimikry, nicht ohne respektvolle Verbeugung: «Auch wenn Sie jetzt das Original lieber nicht lesen möchten: Ich lege es Ihnen schwer ans Herz, und glauben Sie mir, anders als mit einer Nachdichtung ist diesem Original gar nicht beizukommen, und auch damit überhaupt nicht, und ich bin froh über einen Satz von Adorno: Kunstwerke, die der Betrachtung und dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine.»
In diesem Sinn ist dieser Band ein Kunstwerk. Und eine Zumutung: weil er noch einmal bewusst macht, was für einen Verlust der Tod dieser Schriftstellerin für die Literaturwelt bedeutet.