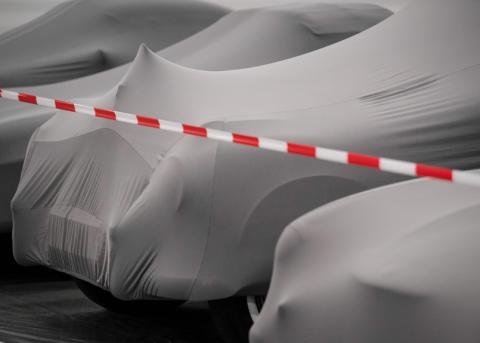Das Ende des Kapitalismus
Alles auf Erden findet in den Grenzen von Raum und Zeit statt. Auch der Kapitalismus hat einen Anfang und folglich auch ein Ende. Der Kapitalismus ist historisch. Dies wird jedoch keineswegs allgemein akzeptiert, im Gegenteil. Doch wo kein Ende ist, bleibt der Anfang im Dunkel: Kapitalismus scheint heute zur inneren Natur der Menschen zu gehören, so wie der Stoffwechsel mit der äusseren Natur, als wäre Kapitalismus eine condition humaine. Geriete der Kapitalismus an Grenzen, hörte der Metabolismus, der Stoffwechsel, auf. Das wäre das Ende der Menschheit, vielleicht sogar des Lebens auf Erden.
Dieses Denkmuster ist keine blosse Spekulation, es charakterisiert einen nach 1989 verbreiteten Diskurs. Das „Ende der Geschichte“ sei erreicht, weil paradoxerweise die moderne kapitalistische Gesellschaft mit ihren sozialen und politischen Institutionen und Prozeduren (formale Demokratie, Markt, Pluralismus) und mit ihren Theorien und Ideologien den Höhepunkt der sozialen Entwicklung des Menschengeschlechts markiere. Sie scheint grenzenlos, ewig und daher geschichtslos zu sein. Eine andere, nicht-kapitalistische Gesellschaft befindet sich ausserhalb des Gesichtskreises der Zeitgenossen: „There is no alternative“, lautet Margret Thatchers gedankenlosester und zugleich berühmtester Spruch. Für immer Kapitalismus, weil gesellschaftliche Alternativen keinen historischen Sinn machen. Wer angesichts dieses weltweit vorherrschenden Diskurses das Ende des Kapitalismus dennoch für möglich hält oder gar auf dessen Überwindung politisch hinarbeitet, gilt als weltfremder Narr, der das Rad der Geschichte drehen möchte, obwohl es zum Stillstand gekommen und seine Bewegung blockiert ist. Die Geschichte ist am Ende, die „beste aller möglichen Welten“ ist Wirklichkeit geworden. Nun hilft nur noch der Rekurs auf Leibniz und die Theodizee: Da die Welt insgesamt vom gütigen und gerechten Gott geschaffen ist und die göttliche Weisheit nicht in Frage gestellt werden kann, ist die Welt, in der wir leben, trotz der chaotischen Verhältnisse, trotz des Bösen, die „beste aller möglichen Welten“. Kapitalismus erhält, wie Walter Benjamin kritisierte, etwas Religiöses. Voltaire hat diesen heroischen Fatalismus in seinem Roman „Candide“ schon im 18. Jahrhundert, im vorrevolutionären Frankreich, persifliert. Heute hätte ein moderner Voltaire viel mehr Anlass, sich über die Verhältnisse im globalisierten Kapitalismus und über dessen dunkle Seiten, über Krieg und Elend, ökologische Zerstörung und soziale Ungleichheit, über Terror und Krieg gegen den Terror, über Folter und Geheimgefängnisse aufzuregen. Wenn die Geschichte weitergehen und die „beste aller möglichen Welten“ politisch gestaltet werden soll, muss auch über das Ende des Kapitalismus nachgedacht und müssen Alternativen entwickelt und erprobt werden. Reden wir also über das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Wie wir ihn kennen: Denn die Zukunft ist offen, und wir wissen nicht, welche Gesellschaftsform diejenigen erstreiten, die einen Ausweg aus dem Kapitalismus, wie wir ihn kennen, finden müssen.
Ich möchte im Folgenden zunächst der Frage nachgehen, welche Eigenschaften den Kapitalismus charakterisieren und wie die menschheitsgeschichtlich einmalige Dynamik seit der industriellen Revolution zu erklären ist. Die Übereinstimmung von sozialer Formation, Technik, Markt und fossilen Energieträgern, die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand, ist wesentlich dafür verantwortlich. Aber ist diese Konstellation für immer gewährleistet? Der Historiker Fernand Braudel gibt uns hier einen bedeutsamen Hinweis, wenn er schreibt: „Der Kapitalismus, davon bin ich [...] überzeugt, kann nicht durch einen ‚endogenen‘ Verfall zugrunde gehen; nur ein äusserer Stoss von extremer Heftigkeit im Verein mit einer glaubwürdigen Alternative könnte seinen Zusammenbruch bewirken“. Man wird sich also auf die intellektuelle und zugleich ganz praktische Suche nach den äusseren Erschütterungen und den im Inneren der Gesellschaft heranreifenden überzeugenden Alternativen machen müssen. Allerdings erweitern wir das uns von Braudel aufgegebene Programm um die Suche nach den im Inneren der Gesellschaften heranreifenden und sich zuspitzenden Widersprüchen, die genauso wirksam die Grundlagen der Stabilität der Entwicklung bedrohen können wie die äusseren Anstösse. Doch Fernand Braudel hat Recht; für sich allein können innere Krisen kaum den Zusammenbruch des Systems zur Folge haben. Die inneren Krisen - das sind heute die globalen Finanzkrisen mit ihren ganze Kontinente erschütternden Wirkungen. Die äusseren Anstösse - das sind die Grenzen der Verfügbarkeit fossiler Energieträger und die aus ihrer Verbrennung resultierenden Klimafolgen. Interne Alternativen, das sind gesellschaftliche Initiativen für erneuerbare Energien und für die Verwirklichung solidarischer Wirtschaftsformen.
Kapitalismus ohne Ende?
Der Begriff Kapitalismus taucht erstmals im 18. Jahrhundert auf, setzt sich allerdings erst sehr viel später durch. Adam Smith und David Ricardo verwenden den Begriff nicht, und auch im „Kapital“ von Marx findet man den Begriff nur ein einziges Mal (im 2. Band, 4. Kapitel). Erst Werner Sombart führt den Kapitalismus-Begriff in seiner epochalen Analyse der historischen Entwicklung vom „Vorkapitalismus“ über den „Frühkapitalismus“ zum „Hochkapitalismus“ ein. Im „Hochkapitalismus“ hat sich der Kapitalismus als System gegenüber anderen „Wirtschaftsstilen“ und „Wirtschaftsgesinnungen“ durchgesetzt. Auch für Marx ist die kapitalistische Produktionsweise bzw. Gesellschaftsformation historisch, sie sind aus anderen Produktionsweisen - im westlichen Europa aus dem Feudalsystem - hervorgegangen, und es werden andere folgen. Aber wie muss man sich das Ende vorstellen, bricht der historische Kapitalismus zusammen? Auf diese Frage hat der schon zitierte Fernand Braudel eine deutliche Antwort: Der „Kapitalismus als Struktur [ist] von langer Dauer“, schreibt er, und „der Kapitalismus als System“ hat „alle Aussichten“, auch die schwerste Krise zu überstehen, „ja es könne sogar sein, dass er wirtschaftlich [...] gestärkt aus ihr hervorgeht“. Kapitalismus also ohne Ende? Sicher nicht, aber die Stabilität der modernen kapitalistischen Gesellschaften darf nicht unterschätzt werden. Denn sie ist eine Folge der ausserordentlichen Dynamik kapitalistischer Gesellschaften, und diese kann sich so recht entfalten, wie die fossilen Energien mit Hilfe der neuen Techniken der industriellen Revolution die begrenzten biotischen Energien von Mensch und Tier ergänzen und ersetzen. Denn die fossilen Energien - Kohle, Gas und vor allem Öl - sind der kapitalistischen Produktionsweise höchst angemessen. Fossiles Energieregime und soziale Formation des Kapitalismus passen nahtlos zusammen, und dies aus mehreren Gründen. Erstens können fossile Energieträger anders als Wasserkraft oder Windenergie weitgehend ortsunabhängigeingesetzt werden. Sie können von den Lagerstätten relativ leicht zu den Verbrauchsorten gebracht werden, heute mit Hilfe von Pipelines und Tankschiffen. Die ökonomische Geographie wird weniger von natürlichen Gegebenheiten, als von der Kalkulation der Rentabilität von Kapitalanlagen an verschiedenen und miteinander konkurrierenden Standorten beeinflusst. Zweitens sind fossile Energieträger zeitunabhängig, da sie leicht zu speichern sind und 24 Stunden am Tag, und dies über das ganze Jahr unabhängig von den Jahreszeiten, genutzt werden können. Anders als die biotischen Energien, die nur dezentral in zumeist kleinen Einheiten in nützliche Arbeit umgesetzt werden können und in aller Regel nur dann, wenn die Sonne scheint, erlauben die fossilen Energien Konzentration und Zentralisierung ökonomischer Prozesse, wenn es das Rentabilitätskalkül sinnvoll erscheinen lässt. Die fossilen Energieträger können jedes Grössenwachstum mitmachen, also mit der Akkumulation des Kapitals mitwachsen. Drittens besitzen fossile Sekundärenergien, vor allem die Elektrizität und der Verbrennungsmotor, alle Vorzüge der Mobilität, der Dezentralisierung, des flexiblen Einsatzes in allen Lebenslagen und Arbeitsbereichen. Das reicht vom Kinderspielzeug, den Geräten in einer modernen Küche und HobbyWerkzeugen bis zum PC oder Baukran und Geländewagen. Die Potentiale der Arbeit werden enorm gesteigert. Auch die Lebensformen in den Haushalten ändern sich radikal. Das elektrische Licht kann die Nacht zum Tag machen und daher soziale Rhythmen von den Naturgegebenheiten und Biorhythmen loslösen. Auch die Wucht politischer Herrschaft kann gesteigert werden, nicht zuletzt weil sich auch das Militär der Potenzen der fossilen (und auch der nuklearen) Energieträger zur Steigerung der Destruktionskraft bedient.
Mit Hilfe von industrieller Technik, des Einsatzes fossiler Energien in der sozialen Organisation des Kapitalismus wird die Steigerung des „Wohlstands der Nationen“ in einem Ausmass möglich wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Nach Adam Smith ist dies eine Folge der Arbeitszerlegung in der Fabrik und der Arbeitsteilung in der Gesellschaft, gelenkt durch die „unsichtbare Hand“ des Marktes, heute erzwungen durch den globalen Wettbewerb. Denn der Kapitalismus ist von Anbeginn an ein - anfangs vor allem europäisch dominiertes - Weltsystem mit einer Dynamik, die heute als Globalisierung bezeichnet wird.
Fetisch Wachstum
Der jahresdurchschnittliche Anstieg der Pro-Kopf-Einkommen verzehnfachte sich von 0,22 Prozent in der Zeit zwischen 1000 bis 1820 auf 2,21 Prozent in den Jahren von 1820 bis 1998. Der Lebensstandard der Menschen in den Industrieländern hat sich seitdem ausserordentlich verbessert, Unterernährung und Hunger verschwinden - zumindest in Europa in friedlichen Zeiten. Zugleich wird seit der Industrialisierung gegen Ende des 18. Jahrhunderts jedoch der wachsende Wohlstand extrem ungleich verteilt. In Westeuropa beträgt das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen im Jahre 1998 17921 USDollar, in den USA und Kanada liegt es bei 26146 US-Dollar. In Asien (ohne Japan) beträgt der Durchschnitt der Pro-Kopf-Einkommen aber nur 2936 USDollar und in Afrika 1368 US-Dollar - ein Zwanzigstel des Wertes in den USA. Wachstum ist also keineswegs mit mehr Gleichheit in der Welt verbunden. Im Gegenteil, Ungleichheit wird zu einer Lebenserfahrung und zu einem Ärgernis zumindest für jene, die zu den Benachteiligten gehören. Kapitalismus, dies zeigt sich von Anbeginn an, ist ein System der qualitativen Angleichung (alles wird in Geld und Kapital ausgedrückt) und der quantitativen Ungleichheitsproduktion: Die einen haben viel, die anderen wenig und einige gar keine Geldeinkommen. Daher sind auch die monetären Ansprüche an die Ressourcen der Erde höchst ungleich. Die Menschen haben einen verschieden grossen „ökologischen Fussabdruck“. Ein unfreiwillig absurder Ausdruck der qualitativen Angleichung ist der Anspruch Angus Maddisons, alles in langen Zeitreihen über die Jahrhunderte und die Kontinente hinweg in normierten US-Dollar von 1990 messen zu wollen und zu können. Nun erst wird Wachstum, nachdem es so dramatisch seit der industriellfossilen Revolution gesteigert werden konnte, eine zentrale Kategorie in modernen ökonomischen Diskursen. Es wird zum Fetisch. Wachstum sei „gut für die Armen“, behaupten Weltbank-Autoren. An der Wachstumsrate wird Regierungspolitik im internationalen Vergleich bewertet, zum Beispiel seitens der OECD. Der Council of Economic Advisers des US-Präsidenten hat in seinem „Economic Report of the President“ im Jahre 2003 das sechste Kapitel ganz der Frage gewidmet, warum Wachstum im Wesentlichen Vorteile bringt.
Einige „Pro Growth Principles“ werden vorgestellt. Dazu gehören unter anderen: wirtschaftliche Freiheit, Wettbewerb und Unternehmertum, makroökonomische Stabilität, Privatisierung, Offenheit für internationalen Handel, ausländische Direktinvestitionen und Liberalisierung der Finanzströme. Das ist die neoliberale Agenda pur. Die Weltökonomie muss wachsen, lautet das Credo, das unzählige Male wiederholt wird. Der Wachstumsimperativ ist also fest verankert in den ökonomischen und politischen Diskursen. Je höher das Wachstum, desto weniger wirtschaftliche, soziale und politische Probleme - und umgekehrt. Kein Wunder also, dass auch im Koalitionsvertrag vom November 2005 „neues Wachstum“ als ein vorrangiges Ziel gilt. Man will nicht wahrhaben, dass das ökonomische Wachstum nicht geometrisch, sondern linear ist und sich mit der Zeit dem Grenzwert Null naturgesetzlich nähert. Erst seit den 1920er Jahren entsteht die Wachstumstheorie. In der frühen Sowjetunion beginnt die Planung der Wirtschaft. Jetzt kommt es darauf an, dass die Proportionen der Branchen und Abteilungen (Investitions- und Konsumgüter) stimmen. Mit der keynesianischen makroökonomischen Wende nach dem grossen Schock der Weltwirtschaftskrise vor einem Dreivierteljahrhundert kommt die Wachstumsfrage auch in der westlichen ökonomischen Theorie auf die Agenda, zumal inzwischen der „Systemwettbewerb“ ausgebrochen ist. Das erklärte Ziel lautet: Steigerung der Wachstumsraten, um den Kapitalismus „einzuholen und zu überholen“, bzw. - von westlicher Seite - um den Vorsprung gegenüber der Sowjetunion zu wahren. Wachstum wird zu einem Element der Alltagswelt und des Alltagsverständnisses sowie zu einer Selbstverständlichkeit, die überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dies lässt sich am Beispiel der globalen Krise der Automobilindustrie darstellen: Die Entwicklung des Kapitalismus des 20. Jahrhunderts wäre gar nicht denkbar ohne das Automobil. Das Auto ist das entscheidende Symbol für Modernität, Wohlstand, Mobilität und Dynamik, es hat einen zentralen Stellenwert bei der Ankurbelung von Wachstum und bei der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit von „Standorten“. Die Automobil- und mit ihr verbundene Industrien hatten über Jahrzehnte überdurchschnittliche Zuwachsraten. Die Entwicklung einer eigenständigen Automobilindustrie gilt als Schlüssel der Industrialisierung schlechthin. Die Städte, die Kommunikationsund Transportstrukturen sind auf das Automobil zugeschnitten, also auf Beschleunigung und Expansion. Das Automobil ist das paradigmatische Produkt des fossilen Zeitalters.
Ohne Öl kein Auto, und ohne Auto nicht die Art von Mobilität, die das 20. Jahrhundert und wenige Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts prägt - so lange die Versorgung mit Öl reicht. Der Fossilismus hat sich mit dem Automobil und allen seinen Begleiterscheinungen in den Lebenswelten eingenistet, zu einer Kultur verdichtet. In jeder Plastiktüte ist er präsent, und jeder Last-Minute-Flug ist ein (fossiles) Erlebnis - für die Generationen der Öl-Bonanza jedenfalls, für spätere Generationen nicht mehr. So kommt es, dass die Wachstumsdynamik nicht nur aus den Investitionen stammt, sondern auch aus dem Konsum. Wachstum wird zum Fetisch, dessen Lebenssaft aus fossilen Energieträgern, vor allem aus Öl, besteht. Damit geht eine paradoxe Verkehrung einher. In der Frühzeit der kapitalistischen Industrialisierung gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Nutzung fossiler Energieträger für den Antrieb des Systems industrieller Werkzeuge auch eine Steigerung des Wachstums zur Folge. Ein gesellschaftlicher Imperativ des Wachstums jedoch existierte in jener Epoche nicht, denn die Gesellschaften waren nicht vollständig durchkapitalisiert. Es gab nicht-kapitalistische Räume, in denen das Gesetz von Profit, Akkumulation und Zins keine volle Gültigkeit hatte. Heute ist Wachstum in die gesellschaftlichen Verhältnisse, in Produktion und Konsumwelt gleichermassen, eingeschrieben. Die Finanzmärkte spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. In der globalen Konkurrenz der Finanzplätze nämlich werden Renditen von Finanzanlagen verlangt, die 20 Prozent und mehr betragen. So hohe Zuwächse hat es über längere Zeiträume auch in den Zeiten der Wirtschaftswunder nirgendwo gegeben.
Wenn das Wachstum zur Bedienung von Finanzanlagen unzureichend ist, muss es gesteigert werden, oder/und es findet ein brutaler Prozess der Umverteilung zu Gunsten der Finanzanleger auf globalen Märkten statt. Bevor ich auf die Frage eingehe, was passiert, wenn der Treibstoff des Wachstums, die fossilen Energieträger, in den nächsten Dekaden ausgehen sollte, müssen wir uns der Funktionsweise der Finanzmärkte zuwenden. Finanzkrisen sind interne, sich aus der Funktionsweise des Systems ergebende Schocks, die ganze Gesellschaften erschüttern. So lange das Fixkurs-System von Bretton Woods (bis 1973) einigermassen funktionierte, lagen die Realzinsen unter der realen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dies war die Voraussetzung für das keynesianische Positivsummenspiel von kredit-finanzierten Investitionen, die den Kapitalisten positive Renditen (Profitraten) brachten, aus denen die (ebenfalls positiven) Kreditzinsen an die Kreditgeber gezahlt werden konnten. Nur eine solche Konstellation ermöglicht in einer kapitalistischen Ökonomie beides, nämlich Akkumulation von realem Kapital und mithin positives Wirtschaftswachstum sowie - ceterisparibus- die Schaffung neuer Arbeitsplätze einerseits und finanzielle Stabilität andererseits.
Bis Ende der 70er Jahre war das Niveau der realen Zinsen sehr niedrig, zeitweise in einigen Ländern nahe Null. Doch dann kam die böse Überraschung: Öffentliche und private Kreditnehmer, die Anleihen in US-Dollar aufgenommen hatten, als der Realzins in den USA niedrig, die Wachstumsraten der Weltwirtschaft hoch und die Exportpreise günstig waren, mussten seit Ende der 70er Jahre steigende Realzinsen, abnehmende Nachfrage in den Industrieländern und explodierende Ölpreise verkraften. Dies war vielen Ländern nicht möglich, die daher in die Schuldenkrise gerieten. Mexiko machte 1982 den Anfang, die meisten Länder der damals noch so genannten Dritten Welt folgten. Das Niveau der Realzinsen übertraf in den nächsten mehr als zwei Jahrzehnten die Zuwachsrate des BIP. Erst gegen Ende der 90er Jahre gingen die Realzinsen während des New-Economy-Booms erneut leicht zurück. Als die New-Economy-Blase im Jahre 2000 platzte und auch die realen Wachstumsraten des BIP zurückgingen, waren in den Industrieländern, und erst recht in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die Realzinsen erneut höher als die realen Wachstumsraten. Tiefgreifende Veränderungen der Struktur des globalen Kapitalismus sind die Folge der hohen Realzinsen: Erstens zählt die monetäre Rendite mehr als die Rendite von realen Investitionen (Profitrate). Das wäre kein Problem, wenn die Zentralbanken noch über die souveräne Macht verfügten, die Zinsen (den Diskontsatz) unter die Rendite (Profitrate) von realen Investitionen zu drücken - wie Keynes es zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den 30er Jahren vorgeschlagen hatte. Zweitens werden die Möglichkeiten von Kapitalanlagen weltweit verglichen. Dies hat zur Folge, dass - anders als Marx es sich vorstellen konnte - weniger die industrielle Durchschnittsprofitrate zum Vergleich von alternativen Kapitalanlagen herangezogen wird als Zinsen, Renditen und vor allem der monetär gemessene Unternehmenswert („shareholder value“). Drittens entstehen Institutionen, die Kapital sammeln und dieses weltweit für ihre Klientel investieren (Pensions-, Investitions-, Private-Equity- oder Hedgefonds etc.). Durch diese Veränderungen ist der globalisierte Kapitalismus als „Kultur“ in breite Schichten der Bevölkerung in den Industrieländern eingedrungen. Viertens haben die grossen Finanzkrisen seit den 80er Jahren den Menschen in den betroffenen Ländern extrem hohe Verluste zugefügt (in Indonesien, Argentinien, Mexiko und anderswo). Anders als in der fordistischen Phase haben die Krisen immer globale Reichweite. Infolge des grossen Gewichts der finanziellen Sphäre im globalen Kapitalismus hat sich das Verhältnis von realer und monetärer Akkumulation verändert. Freilich haben letzten Endes die Krisen doch ihren Ursprung in den Widersprüchen der Produktionssphäre. Nur sind die Vermittlungen von realer und monetärer Sphäre sehr viel komplexer als in den Zeiten vor der finanziellen Liberalisierung. Renditen von mehr als 20 Prozent können an die Aktionäre nur gezahlt werden, wenn nicht nur die aus Wachstum stammenden Überschüsse verteilt werden, sondern ein globaler Prozess der gewaltigen und häufig gewaltsamen Umverteilung zu Gunsten der „Shareholder“ aus der Vermögenssubstanz von Gesellschaften in Gang gesetzt wird. Der globale Kapitalismus ist also räuberisch und kurzsichtig, wie bereits Rosa Luxemburg und Hannah Arendt hervorhoben.
Die Falle des Fossilismus
Die Wirkungsweise der globalen Finanzmärkte führt also zu einem hohen Niveau der Realzinsen und Renditen, so dass ein enormer Druck auf ökonomische und politische Akteure ausgeübt wird, das reale Wachstum zu steigern. Der dominante Wachstumsdiskurs bietet dabei die ideologische Unterstützung. Das hohe Wirtschaftswachstum der vergangenen zwei Jahrhunderte seit der industriellen Revolution wäre aber gar nicht denkbar ohne die Ausbeutung (Extraktion) der fossilen Energieträger.
Das Öl jedoch geht zur Neige. Niemand kann genau sagen, ab wann es nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Doch spricht vieles dafür, dass der Höhepunkt der weltweiten Ölförderung von bisher 944 Mrd. Barrel im Verlauf dieses Jahrzehnts überschritten wird. Dann gibt es zwar immer noch Öl, nämlich zwischen geschätzten 748 Mrd. (ASPO) und 1149 Mrd. Barrel (BP); die statistische Reichweite (Reserven dividiert durch den gegenwärtigen Jahresverbrauch) beträgt etwa 40 Jahre. Die jährlich neu gefundenen Lager sind wesentlich kleiner als die Jahresförderung, so dass die Bestände abnehmen und die Angebotskurve des Öls sich nach unten neigt - und dies bei steigender Nachfrage. Denn alle neu industrialisierenden Länder, beispielsweise Indien und China, sind auf den Treibstoff von Wachstum, Produktivitätssteigerung und Mobilität angewiesen, und die hoch entwickelten Länder sind nicht in der Lage und kaum bereit, ihre Nachfrage nach Öl zu drosseln. Die Kongruenz von Kapitalismus und Fossilismus erweist sich nun als eine Falle. Das reale Wachstum kann gar nicht so hoch sein, dass alle monetären Ansprüche (Renditen und Profite) aus dem real produzierten Surplus und ohne illegitime und kriminelle Aneignung befriedigt werden können. Denn fossile Energien haben immerhin ein natürliches Mass, nämlich ihre Verfügbarkeit und die Tragfähigkeit der natürlichen Sphären für die Verbrennungsprodukte, vor allem das CO2; das gesellschaftliche System des Kapitalismus dagegen ist autoreferenziell und daher masslos. Der Höhepunkt der Erdölförderung lässt sich für einzelne Lagerstätten, für Länder und die Welt insgesamt bestimmen. Die USA haben den Scheitel ihrer Ölförderung (ihr „Peak Oil“) bereits Anfang der 70er Jahre überschritten. Sie können den inländischen Verbrauch mit inländischer Förderung nicht mehr decken.
Die entstehenden Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage können nur durch Importe überwunden werden. Schon im Mai 2001 - also vor dem 11. September - hat der amtierende Vizepräsident der USA und Ex-Chef von Halliburton, Richard Cheney, einen Bericht über die Ölsicherheit der USA vorgelegt. Darin wird ausgeführt, dass die heimische Produktion bis 2020 von 8,5 auf 7 Mio. Barrel pro Tag (b/d) zurückgehen und der Ölverbrauch von 19,5 auf 25,5 Mio. b/d ansteigen. Die wachsende Lücke müsse daher durch Importe gedeckt werden, die um 68 Prozent von 11 auf 18,5 Mio. b/d wachsen werden. Die Sicherung der Energieversorgung erlangt also höchste Priorität in der US-Aussenpolitik. Die Weltproduktion freilich hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, und deshalb ist es möglich, mit Hilfe eines Regimes des Freihandels und des USDollars als Ölwährung auf die Ressourcen anderer Länder zurückzugreifen, auf die von Mexiko, Venezuela, des Nahen und Mittleren Ostens etc. Das Regime des Freihandels kommt den reichen Ölimporteuren zugute. Doch nähert sich erstens die Extraktion in vielen dieser Länder ebenfalls dem Peak, und zweitens steigt die Nachfrage nach Öl in dem Masse, wie aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit unter dem Regime des Freihandels Wachstum in allen Ländern, die sich durch Liberalisierung und Öffnung der Märkte daran beteiligen, erzwungen wird. Der Zwang hat die institutionelle Gestalt des Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Welthandelsorganisation (WTO), die beides zu realisieren versuchen: Freihandel zum Zugriff auf die Ressourcen der ärmeren Länder durch die reichen Länder, und Wachstum, um den monetären Verpflichtungen (beispielsweise infolge von Verschuldung) gegenüber global operierenden Fonds nachkommen zu können. Öl wird also knapp und bei hoher Nachfrage entsprechend teuer. Importländer von Öl, insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländer, müssen daher steigende Anteile ihrer Exporterlöse für den Import des Öls aufwenden. Für Exportländer von Öl ist die Steigerung von Ölexporten und -einnahmen nicht unbedingt von Vorteil. Denn der Ölreichtum fördert eine einseitige Ausrichtung der Ökonomie, beeinflusst die Terms of Trade zu Ungunsten der Industrieproduktion, hemmt also eine ausgeglichene Entwicklung, öffnet der Korruption ein weites Feld und bietet eine offene Flanke für Interventionen von aussen, wie besonders brutal und mörderisch im Irak. Ölreichtum kann sich in einen Fluch verwandeln.
Der Mittlere und Nahe Osten ist in Zukunft entscheidend für die Versorgung mit der immer knapper werdenden Ressource Öl, und daher wird diese Region noch mehr zum Konfliktgebiet als schon in der jüngeren Vergangenheit. Die Konflikte um Ölressourcen werden daher nicht nur auf dem Markt, sondern auch auf politischem Terrain ausgetragen: als Kampf um Territorien der Ölförderung und der Logistik (Pipelines oder Tankerrouten), als Auseinandersetzung um die Preisbildung und die Währung, in der die Ölrechnungen ausgestellt werden. Ein neues „Great Game“ um den Zugang zu den Ölressourcen und um deren Verteilung wie am Ausgang des 19. Jahrhunderts ist eröffnet, dieses Mal nicht nur im Kaukasus und im Nahen und Mittleren Osten, sondern in der ganzen Welt. Pipelineistan ist überall, ist global. Angesichts der Defizite in Budget und Leistungsbilanz der USA von jeweils vielen hundert Millionen US-Dollar und einer drohenden Abwertung des US-Dollar ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass Ölexporteure dazu übergehen, den Ölpreis in Euro zu fakturieren. Der Krieg gegen den Irak hat auch den Nebeneffekt gehabt, dass Tendenzen in diese Richtung (in Venezuela, Irak, Libyen) zunächst gestoppt worden sind. Aber sie kommen wieder, wenn die USA ihr Zwillingsdefizit nicht reduzieren und sich nicht aus dem irakischen Sumpf durch Rückzug befreien können. Die USA bekämen ein riesiges Problem, wenn sie die steigenden Ölimporte nicht mehr in US-Dollar begleichen könnten, sondern beispielsweise in Euro bezahlen müssten. Wenn die jährlichen Ölimporte, wie der Cheney-Bericht ausführt, von vier auf etwa sieben Mrd. Barrel im Jahr 2020 steigen, sind bei einem Preis von rund 50 US-Dollar pro Barrel derzeit 200 Mrd. US-Dollar für die Bezahlung der Ölrechnung nötig; 2020 wären es schon an die 350 Mrd. Das sind nach dem Wechselkurs Anfang 2005 etwa 260 Mrd. Euro. Die Konfliktträchtigkeit des fossilen Regimes zeigt sich auch beim Umgang mit den Emissionen, vor allem mit den Treibhausgasen. Wegen der Schädlichit der Treibhausgas-Emissionen ist ja das Kyoto-Protokoll erarbeitet worden, das nach der Unterzeichnung durch Russland im Februar 2005 in bindendes internationales Recht verwandelt worden ist.
Die USA haben diese multilaterale Übereinkunft nicht unterzeichnet. Doch lässt sich davon die Klimaentwicklung nicht beeindrucken. Der Treibhauseffekt bedroht die Umweltund Nahrungssicherheit, die Sicherheit der Behausung und die Gesundheit der Menschen in aller Welt. Darüber hinaus hat er heute bereits kalkulierbare ökonomische Kosten. Denn die Zahl der ungewöhnlichen Wetterbedingungen und der Unwetter, die hohe Schäden verursachen, nimmt in aller Welt zu; seit den 60er Jahren hat sie sich verdreifacht. In der Mitte des 21. Jahrhunderts werden jährlich Kosten in der Grössenordnung von 2000 Mrd. US-Dollar erwartet. Die jahresdurchschnittlichen Kosten haben sich von 54 Mrd. in den 60er Jahren auf 432,2 Mrd. US-Dollar in den 90er Jahren verachtfacht. Allein im Jahre 2005 betragen die Schäden durch aussergewöhnliche Wetterbedingungen fast 250 Mrd. US-Dollar, davon sind 75 Mrd. US-Dollar versichert. Auf die dramatischen Folgen des möglichen Klimakollapses richtet sich inzwischen auch das Pentagon mit unilateralen Präventionsmassnahmen ein. Nicht vorbeugender Klimaschutz zur Vermeidung einer abrupten Klimaänderung ist die politische Linie der Bush-Cheney-Rumsfeld-Regierung, sondern die militärische Abwehr gegen die Folgen der klimatischen Änderungen. Insbesondere die zu erwartenden Migrationsströme sollen mit militärischen Mitteln abgefangen werden. Wenn infolge des Temperaturanstiegs beispielsweise die Eiskappe Grönlands teilweise schmilzt, verringern sich Dichte und Salzgehalt der Gewässer des Nordatlantik. Dies kann dazu führen, dass der Golfstrom abreisst und das gemässigte Klima in den Anrainerstaaten des Nordatlantik abrupt verändert wird, weil weniger warmes Wasser nach Norden, also in unsere Breiten transportiert wird. Paradoxerweise kann also die globale Erwärmung zu einer regionalen Abkühlung, zum Beispiel in Europa, führen. Die Auswirkungen auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln oder auf den Wasser- und Energieverbrauch können katastrophische Ausmasse haben, gewaltsame Konflikte werden befürchtet. Der Unilaterialismus der Bush-Regierung ist nicht nur aggressiv, er verfolgt vor allem die Herstellung exklusiver Sicherheit für jene in der „Heimat“ unter der Obhut des „Heimatschutz-Ministeriums“ gegen die anderen aus anderen Ländern. Jenseits des Kapitalismus Grenzen des Kapitalismus zeigen sich also überall. Wenn das Öl zur Neige geht, könnte dies der externe Schock sein, den Fernand Braudel erwähnte. Die Welt könnte im Chaos versinken. Doch gibt es auch die überzeugenden Alternativen, die im Innern der Gesellschaft heranreifen? Es gibt sie. Soziale Bewegungen, die auf Alternativen zur kapitalistischen Marktgesellschaft zielen, emanzipieren sich aus den Handlungslogiken, die vom Markt vorgegeben werden. Gibt es mehrere Handlungslogiken, dann ist dies bereits ein Hinweis darauf, dass der historische Pessimismus vom Ende der Geschichte nicht gerechtfertigt ist. Tatsächlich erhellt bereits der Blick zurück in die Geschichte des Wirtschaftens, wie unterschiedlich in verschiedenen Kulturen und Geschichtsepochen Ökonomie und Gesellschaft koordiniert wurden, wie facettenreich die Denk- und Handlungsmuster sind, die sich in den immer wiederkehrenden, zur Routine gewordenen Handlungen herausbilden. Erst im modernen Kapitalismus mit seinen globalen Institutionen und in Folge der globalen Vereinheitlichung, betrieben gerade auch von den internationalen Institutionen wie WTO und IWF, wird die Diversität von Handlungslogiken auf ein dominantes Muster, nämlich das der Äquivalenz, reduziert, theoretisch begründet innerhalb der penséeuniquedes Neoliberalismus und praktisch durchgesetzt innerhalb des Systems der Marktbeziehungen. Doch gibt es auch das Prinzip der Solidarität und Fairness. Es ist den Prinzipien von Äquivalenz und Reziprozität entgegengerichtet, denn es geht vom gesellschaftlichen Kollektiv und nicht von Individuen und ihren marktvermittelten Beziehungen aus und kann nur in organisierter Form zur Geltung kommen. Wir-AG statt Ich-AG, könnte man zuspitzen. Es verlangt keine hierarchische Regulation von Ökonomie und Gesellschaft von oben, im Gegenteil. Solidarität entsteht nur mit breiter Beteiligung von unten. Gemeinsame Anstrengungen zur Lösung eines gemeinsamen Problems sind gefragt. Jeder leistet seinen solidarischen Beitrag nach seinen Möglichkeiten, das heisst unter Bedingungen der Fairness. Solidarität setzt daher ein Bewusstsein von Gemeinsamkeit und innerer Verbundenheit in einer Gesellschaft voraus, die in einer Kultur, Ethnizität, Lokalität, Klasse oder einer die Klassen übergreifenden Lebenserfahrung begründet sein kann, um ein grosses Problem, beispielsweise Arbeitslosigkeit, Armut oder Rechtlosigkeit, gegenüber transnationalen Unternehmen gemeinsam zu bewältigen. Der „Entbettung des Marktes aus der Gesellschaft“, die eine Bedingung der ökonomischen Äquivalenzbeziehungen (alles wird in Geld ausgedrückt) ist, wird in solidarischen und fairen Verhältnissen entgegengewirkt. Moralisch ist, so Emile Durkheim, all das, was eine Quelle von Solidarität gegen die „Triebe des Egoismus“ und die Entfremdungstendenzen werden kann. Daher verwendet E. P. Thompson den Begriff der „moralischen Ökonomie“. Diese hat ihre eigenen Kriterien für das, was als legitim und sozial gerecht beurteilt wird, die sich nicht auf das Äquivalenzprinzip zurückführen lassen. Die Solidarität geht also von der Gemeinschaft aus, und diese ruht auf einem gemeinsamen Wertesystem und Erfahrungshintergrund, also auch auf einem gemeinsamen, kollektiven Gedächtnis. Dieses vermittelt ein gemeinsames Vorverständnis in politischen Auseinandersetzungen, ohne dass dieses, beispielsweise mit Hilfe von Schulungskursen in einer Partei, erst hergestellt werden müsste. Die moralische Ökonomie ist eine praktische Antwort auf die „Entbettung“ des Marktes aus der Gesellschaft, also gegen die ökonomischen Sachzwänge. Daraus entwickeln sich die Konflikte mit den Mächten des Marktes, des Weltmarktes zumal. Diese Konflikte haben immer eine politische Dimension. Denn in den meisten Fällen sind Basisbewegungen gezwungen, sich gegen Regierungen zu richten und in ihren Kämpfen Gegenmacht aufzubauen, indem Territorien, Land und Fabriken, Kohlenminen und Erdölfelder besetzt und verwaltet und gleichzeitig Bündnisse mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und manchmal auch mit Teilen des Staatsapparats geschmiedet werden. Die Ansätze einer alternativen solidarischen Ökonomie entwickeln sich gegen die dominanten neoliberalen Tendenzen der Unterwerfung der Gesellschaften unter die Gesetze des globalen Marktes. Die generelle Richtung ist eindeutig zu bezeichnen, und sie ist gut begründet: Die fossilen Energien müssen sehr schnell durch erneuerbare Energien ersetzt werden, denn das Zeitfenster ist aufgrund des Umstands, dass der Scheitelpunkt der Ölförderung sehr bald erreicht sein wird, nicht mehr lange offen. Die erneuerbaren sind langsamer als die fossilen Energien, und sie sind nicht unabhängig vom Ort: die Windenergie, die Photovoltaik, die Wasserstoffwirtschaft, die Wasserkraft, die thermische Energie, die Gezeiten, die Biomasse. Keine dieser Energien kann die Bedingung der Kongruenz von Energiesystem und Kapitalismus erfüllen, die in den vergangenen zwei bis drei Jahrhunderten die menschheitsgeschichtlich einmalige Wachstumsdynamik ermöglicht hat. Zu Beginn des fossilen Zeitalters fand der Kapitalismus das ihm entsprechende Energiesystem sozusagen in nuce vor. Es musste nur in einer von Nicholas Georgescu-Roegen so genannten „prometheischen Revolution“ freigesetzt und dann entwickelt werden. Dies ist in den letzten beiden Jahrhunderten seit der industriellen Revolution in bravouröser Weise geschehen. Die globale Autogesellschaft ist der Höhepunkt und gleichzeitig das Memento, dass es auf diesem Wege trotz der immer stärker werdenden Wagen nicht weiter geht. Am Ende des fossilistischen Kapitalismus kann nur ein erneuerbares Energieregime weiterhelfen. Dem aber muss die soziale Formation des Kapitalismus angepasst werden. Das ist eine tiefere und umfassendere Revolution als es die französische oder russische waren. Sie ist auch schwieriger als die industrielle Revolution. Aber die ebenfalls existierenden Ansätze der solidarischen Ökonomie können die Verbindung zur Bewegung für die erneuerbaren Energieträger herstellen. Der Kapitalismus verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen wie der real existierende Sozialismus im Verlauf einer „samtenen Revolution“, aber er wird ein anderer Kapitalismus werden als der, den wir kennen.
Dieser Text basiert auf einem Vortrag, den Elmar Altvater Anfang Januar vor dem Berliner Bildungsverein Urania gehalten hat. Er wurde zuerst abgedruckt in der Monatsschrift «Blätter für deutsche und internationale Politik». Mehr Informationen über diese renommierte linke Publikation bietet die Website www.blaetter.de.
Von Altvater erschienen zuletzt:
• (mit Birgit Mahnkopf): «Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft». Verlag Westfälisches Dampfboot. Münster 1996. 600 Seiten. Fr. 29.80.
• (mit Birgit Mahnkopf): « Globalisierung der Unsicherheit. Arbeit im Schatten, schmutziges Geld und informelle Politik». Verlag Westfälisches Dampfboot. Münster 2002. 393 Seiten. Fr. 42.90.
• «Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik». Verlag Westfälisches Dampfboot. Münster 2005. Fr. 26.80.