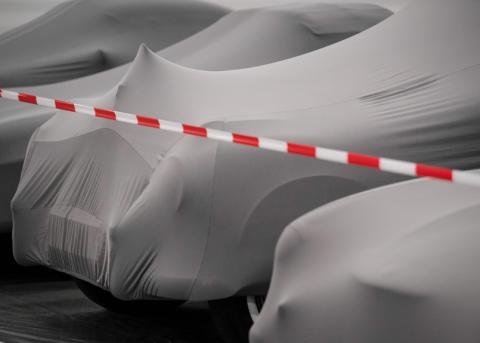Energie und Wachstum: Wenn der nukleare Zyklus sich schliesst, dann als Explosion, als Super-GAU. Fukushima, mon horreur. Der Zyklus wird durch die Katastrophe geschlossen, und das macht die atomare Technologie so gefährlich.
Öffnet der Schrecken von Fukushima uns die Augen? Überdenken wir unser Verhältnis zur Natur, unser Energiemodell, unsere Wachstumswirtschaft? Der Ökonom Elmar Altvater ist skeptisch. Wir scheinen die Diskrepanz zwischen unserem Handeln und dem Wissen um dessen Folgen immer noch nicht wahrhaben zu wollen.
«Wenn alles verstrahlt ist, hilft auch kein Mindestlohn», kommentierte der Deutsche Klaus Ernst, Ko-Vorsitzender der Linkspartei, das gute Abschneiden der Grünen und die Misserfolge der Linkspartei bei den jüngsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Ende März. In der Tat: Die Katastrophe von Fukushima hat politische Konzepte und Strategien nicht nur in Japan obsolet gemacht. Selbst die Weltwirtschaftskrise, die ja weiter höchst virulent ist und inzwischen schon so manchen Staat an den Rand der Pleite und den Euroraum fast zum Kollaps brachte, hat weniger drastisch zum Ausdruck gebracht, was Globalisierung konkret bedeutet, als das nukleare Desaster im 9000 Kilometer entfernten Japan.
Die Globalisierung und vor allem ihr Symbol und Vehikel der Container sind dafür verantwortlich, dass bereits jetzt radioaktives Material aus Japan in alle Welt verstreut wird. Müssen nach der Lockerung von Zoll- und Personenkontrollen, nach der (Neo-)Liberalisierung der Finanztransaktionen trotz intensiver Migration, trotz Kulturaustausches, Internets und Mobiltelefons, trotz der vielen formellen und informellen Meetings im Rahmen der G8, der G20 und so weiter – müssen nun neue Radioaktivitätskontrollen eingeführt werden? Beenden Lieferstopps die globalisierte Just-in-time-Produktion, die für die überlegene Wettbewerbsfähigkeit des «Standorts Japan» verantwortlich ist?
Kurzum: Sind mit einer Art terrestrischem Urknall Grenzen der Globalisierung entstanden?
Die Antwort ist: Die Grenzen gab es immer, sie sind nur nicht beachtet worden. Sie sind von der Natur errichtet, wie schon Friedrich Engels in der «Dialektik der Natur» weitsichtig ausführte: «Schmeicheln wir uns nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns, so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn.» Ökonomische Rationalität verkehrt sich, wenn die Produktiv- und Destruktivkräfte weit genug entwickelt sind – und dies ist im Atomzeitalter der Fall –, nicht nur in Irrationalität, sondern in Katastrophen.
Die Natur und unser Verhältnis zur Natur rücken weit nach vorn auf der politischen Agenda. Bislang bemühten sich die Parteien, vor allem «ökonomische Kompetenz» zu zeigen; mit diesem Anspruch hat die SPD in Hamburg die Landtagswahl im Februar 2011 gewonnen. Meistens ist dies die Ankündigung eines hemmungslosen wirtschaftspolitischen Opportunismus. Dessen Rationalität besteht darin, dass man mächtige Kapitalgruppen bedient und ihren Medien nach dem Mund redet. Gemessen wurde und wird kompetentes Wirtschaften an der wirtschaftlichen Wachstumsrate eines Landes oder einer Region. Darauf hat sich eine Maxi-Koalition verständigt, in der auch viele Strömungen der Linken mitmachen: Mit Wachstum – und besser noch mit einer «Wachstumsbeschleunigung» – lassen sich die wirtschaftlichen Probleme unserer Zeit bewältigen. In Deutschland gehörte daher ein «Wachstumsbeschleunigungsgesetz» in die Wundertüte der konservativ-liberalen Koalition.
Das könnte wieder einmal ein Plagiat sein, denn Angela Merkel hat wie ihr Ex-Verteidigungsminister abgeschrieben. Von wem? Von der linken Regierung Lula in Brasilien, die ab 2007 ein «Programm zur Beschleunigung des Wachstums» umsetzte – ökonomisch zwar ziemlich erfolgreich, aber mit einer verheerenden ökologischen Bilanz. Die Grünen hingegen versprechen mit einem Green New Deal ein «grünes» und nachhaltiges Wachstum – was auch immer sie darunter verstehen. In Deutschland beharrt zudem die Linke auf der Notwendigkeit von Wachstum, sozial ausgeglichen und ressourcenschonend, wenn auch nicht einhellig. Offenbar ist Wachstum immer noch der ideologische und politische Stabilitätsanker in einer Gesellschaft, die, wie der österreichische Sozialphilosoph Günther Anders in den fünfziger Jahren schrieb, «die Produktion [des] eigenen Untergangs pausenlos betreibt» und meint, diesen Betrieb nur durch immer mehr Ressourcen- und Energieverbrauch, also durch Wachstum, bis zum bitteren Ende fortsetzen zu können.
Die Katastrophe in Permanenz
Doch geht das überhaupt? Zweifel sind angebracht. Denn der «Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer», wie der spanische Maler Francisco de Goya sie in seinen «Caprichos» zeichnete. Es ist etwas geschehen, was in keinem Drehbuch der Mainstreamökonomie vorgesehen war: erst die Kernschmelze der Weltfinanzen nach dem Subprime-Hypothekendebakel und dem Bankrott der Lehman-Bank in den USA. Hohn und Spott auf die Theorie der effizienten, weil neoliberalisierten Finanzmärkte. Dann kamen die Pleiten in der «realen Wirtschaft» und die sprunghafte Steigerung der Staatsverschuldung, die den Euroraum erbeben lässt. Die Probleme der Ökonomie lassen sich, so die Hoffnung, mit viel Geld aus öffentlichen Kassen bewältigen. Das ist ein Irrtum, der vor allem jene teuer zu stehen kommt, die nicht mobil genug sind, ihre Steuerzahlungen durch Kapitalflucht «optimieren», das heisst am Fiskus vorbei minimieren zu können. Die Empörung über Steuervermeidung und -hinterziehung oder über ökonomische und soziale Ungerechtigkeit wird derzeit allerdings von schrillen ökologischen Alarmglocken übertönt.
An einen Katastrophenalarm hat man sich schon so sehr gewöhnt, dass «der Schlaf der Vernunft» fortgesetzt werden könnte: Der Klimawandel ist als nicht zu änderndes Geschick beinahe ins Alltagsleben der Menschen eingebettet. Doch beruhigen kann das nicht. Denn die Verbrennungsprodukte der fossilen Energieträger verbleiben für etwa 120 Jahre in der Erdatmosphäre und heizen sie auf. Die Naturgesetze sind verantwortlich. Einmal verbrauchte fossile Reserven stehen kein zweites Mal zur Verfügung. Als Energieträger sind sie weg, doch die so nützlichen Kohlenwasserstoffe sind dabei in das so schädliche Kohlendioxid verwandelt worden. Nichts geht in der Natur verloren, sagt der erste Hauptsatz der Thermodynamik («Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur in andere Energiearten umgewandelt werden»), aber in einem irreversiblen Prozess löst die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre die Klimakatastrophe mit ihren Sekundär- und Tertiärfolgen aus, vor denen die Klimawissenschaftler warnen: Überschwemmungen und Dürreperioden zu Zeiten und an Orten, wo sie nicht passieren dürften, Gletscherschmelze und Verschwinden der polaren Eiskappen. Der Meeresspiegel steigt an und flache Inseln und ganze Küstenlandstriche könnten überflutet werden; in einigen Jahrzehnten versinkt vielleicht auch das Kraftwerk von Fukushima im Meer. «Ungewöhnliche Wettereignisse» werden häufiger die Menschen plagen; die Hitze in Russland während des Sommers 2010 hat an die 55 000 Menschenleben gefordert, rechnen die Rückversicherer in ihren jährlichen Schadensbilanzen vor.
An diesem Punkt angelangt, kann man anfangen, das gelernte Einmaleins der Kostenrechnung auf die Klimakatastrophe anzuwenden, und ökonomisch «rational» entscheiden, ob man den Klimawandel laufen lassen und die Schäden in Kauf nehmen oder mit teuren Vorsorgemassnahmen bekämpfen sollte.
Verantwortung und Vorsorge
Das Vorsorgeprinzip folgt direkt aus der vom Philosophen Hans Jonas in seinem «Prinzip Verantwortung» hervorgehobenen Diskrepanz zwischen der räumlichen und zeitlichen Reichweite unseres Handelns (die ja mit dem wirtschaftlichen Wachstum immer grösser wird) und unserem Wissen über die Folgen dieses Handelns. Das hat die Paradoxie zur Folge, dass einerseits unser Wissen geometrisch wächst wie die Wirtschaft, dass wir andererseits jedoch immer weniger wissen können, welche unbeabsichtigten Nebenfolgen unser absichtsgeleitetes Handeln wann und wo haben wird, weil unser Handeln zeitlich und räumlich immer weiter ausgreift. Der Philosoph Jürgen Habermas hat das als einen Beitrag zur «neuen Unübersichtlichkeit» gedeutet.
Das politische Vorsorgeprinzip ist umkämpft. Niemand wird es unvernünftig finden, aber die zu ziehenden Konsequenzen sind dennoch umstritten, zumindest solange der (Aber-)Glaube vorherrscht, mit der Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit liessen sich die meisten Weltprobleme bewältigen. Wer dem Vorsorgeprinzip zu politischer Bedeutung verhelfen will, muss gegen die sich alternativlos darstellende Rationalität und Selbstgewissheit der Ökonomie als Wissenschaft vorgehen und die Lobbygruppen bekämpfen, die den kurzfristigen Profit über die langfristige Vorsorge stellen. Die Möglichkeit der Katastrophe als Folge dieser spezifischen «Rationalität», sprich der Umschlag rationaler Handlungsmuster in die gesamtgesellschaftliche Irrationalität, wird verdrängt. Das hat die Europäische Umweltagentur in einer Studie vor genau zehn Jahren bereits unter dem Titel «Late lessons from early warnings» (Späte Lehren aus frühen Warnungen) leicht resigniert festgehalten.
Am Ende der fossilen Energiekette
Dass die Katastrophe möglich ist, zeigt sich nicht erst am Ende der fossilen Energiekette, bei der Emission von Treibhausgasen, sondern bereits an ihrem Anfang, bei der Erkundung und Förderung der fossilen Energieträger. Auch da sind Katastrophen offensichtlich nicht auszuschliessen. Die Ölverseuchung des Golfs von Mexiko nach der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon vor einem Jahr hat vor Augen geführt, mit welch enormen Risiken die Förderung des sogenannten nicht konventionellen Öls aus der Tiefsee verbunden ist, nachdem das «konventionelle» Öl zur Neige geht. Dem fossilen Zeitalter, das mit der Kohle und der industriellen Revolution gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann, geht also der Brennstoff aus. Das ist eine Revolution, ob sie so genannt und wahrgenommen wird oder nicht. Der Energieträger, der die Moderne ebenso wie die Postmoderne angetrieben hat, geht zur Neige, und die fossilen Wandlungs- und Nutzungssysteme werden obsolet. Die das 20. Jahrhundert prägende fossile, fordistische oder auch postfordistische Kultur verschwindet. Sie wird jedoch nicht kampflos aufgegeben. Um den Zugang zu den Resten der Ressourcen und um Einfluss auf Vermarktung und Preisbildung werden mörderische Kriege geführt, im Irak und in Libyen, im Nigerdelta und im Sudan.
Lange wurde geglaubt, das Atomzeitalter sei die Alternative zur Epoche von Kohle, Öl und Gas. Der Schrecken von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 hat die ungeheure Zerstörungskraft der Atomkraft ins menschliche Gedächtnis eingegraben. Er hat aber auch die Illusion genährt, diese ungeheure Energie als «Atome für den Frieden» in der Welt nutzbar machen zu können. Das Symbol der ersten Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1958 in Brüssel war das 102 Meter hohe Atomium, ein Nachbau der Eisenkristallstruktur in 165-milliardenfacher Vergrösserung. Das Atom war auf Rolltreppen begehbar, gezähmt und den Menschen zu Diensten.
Doch seit den sechziger Jahren kam immer mehr Skepsis auf, zumal die Zahl der Atommeiler zunahm und für die Entsorgung nuklearer Abfälle keine akzeptable Lösung in Sicht war. Die Entsorgungsfrage wurde immer dringender. Wie sich das Verhältnis zum Atom seit den sechziger Jahren änderte, kann man in Deutschland an der Entwicklung der Zeitschrift «Atomzeitalter» verfolgen. Von der Befürwortung der atomaren «Zukunftstechnologie» entwickelte sich die Zeitschrift zu einem kritischen Organ der Skepsis gegenüber dem Atomzeitalter.
Zur Vorsorge, dem Prinzip, das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung von Rio de Janeiro 1992 und dann in der EU-Umweltgesetzgebung verbindlich vereinbart wurde, gehört die sichere Entsorgung des Atommülls. Nur so kann der nukleare Zyklus vom Uranbergbau zur Endlagerung abgebrannter Brennstäbe geschlossen werden: Uran wird aus der Erdkruste gefördert und so angereichert, dass seine Kernenergie kontrolliert in Wärmeenergie umgesetzt werden kann. Diese wiederum kann zur Betreibung von Dampfturbinen und auf diesem Umweg zur Stromerzeugung genutzt werden.
Doch auch hier zeigt sich, dass nach dem ersten thermodynamischen Hauptsatz nichts verloren geht: Die abgebrannten Atombrennstäbe bleiben erhalten und müssen sicher gelagert werden, und zwar über Zehntausende von Jahren. «Entsorgung» heisst vollständige Isolierung gegenüber natürlicher Erosion und menschlichen Eingriffen. Dass das nicht über 10 000, ja noch nicht einmal über 30 Jahre möglich ist, hat die Katastrophe von Fukushima gezeigt. Wenn der nukleare Zyklus sich schliesst, dann also als Explosion mit nuklearem Fallout, als Super-GAU. Der Zyklus wird durch die Katastrophe geschlossen, und das macht die atomare Technologie so gefährlich.
Fukushima. Ein schöner Name für ein ganz grosses Unglück der Menschheitsgeschichte und – anders als der Film «Hiroshima, mon amour» von Alain Resnais nach einem Drehbuch von Marguerite Duras aus dem Jahr 1959 – für eine Liebesgeschichte ein viel zu garstiger, verstrahlter Ort. Ob der «horreur» von Fukushima uns indes die Augen öffnet, ist nicht gewiss. Das ist ja nach Tschernobyl auch nicht geschehen. Und nach dem Schrecken von Fukushima folgt eine pervers zu nennende Normalisierung des «Weiter so», vergleichbar der Reaktion des Dr. Strangelove, der im gleichnamigen Film von Stanley Kubrick von 1964 begann, die Bombe zu lieben.
US-Präsident Barack Obama hat Ende März trotzig angekündigt, aus energiepolitischen Gründen weitere Atommeiler bauen zu lassen. Die Türkei plant Atomkraftwerke sogar in erdbebengefährdeten Regionen, und Projektnehmer ist das japanische Skandalunternehmen Tepco. Südkorea sieht keinen Anlass, die geplanten vierzehn neuen AKWs nicht zu bauen und die Kapazität nicht von 18,4 Gigawatt bis 2024 auf 35,9 Gigawatt zu verdoppeln. Atomkraftwerke sollen nach Autos, Halbleitern und Schiffen der südkoreanischen Exportoffensive Dampf machen. Frankreich will weiterhin achtzig Prozent seines Stromverbrauchs aus den 58 AKWs des Landes gewinnen. Russland hat neue AKWs in Planung und China auch.
Atomkraftwerke, eine Ware – der Kauf-, Kredit-, Nutzungs- und Wartungsvertrag mag sich auf drei oder vier Jahrzehnte erstrecken, doch für die Folgen von Produktion und Nutzung der Ware AKW ist die menschliche Gesellschaft in ihrer gesamten Geschichte zuständig, die Halbwertszeit von Plutonium-239 beträgt 24 110 Jahre, umfasst also einen Zeitraum, der mehr als doppelt so lang ist wie der von den ersten Anfängen der mesopotamischen Frühgeschichte vor 11 000 Jahren bis in die Gegenwart. In die atomare Halbwertszeit passen also zwei vollständige Geschichten der menschlichen Kultur.
Ein neues Energiemodell ist nötig
Wissen die AtomkraftbefürworterInnen eigentlich, was sie tun? In Deutschland stellt die Regierung Merkel nach der japanischen Katastrophe die Kernenergie infrage, nachdem sie erst im vergangenen Herbst den von der rot-grünen Vorgängerregierung beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie mit einem Beschluss über die Verlängerung der Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke rückgängig gemacht hatte. Nun aber werden die ältesten Reaktoren für drei Monate vom Netz genommen, um während eines befristeten Moratoriums ihre Sicherheit überprüfen zu können. Das ist Augenwischerei. Denn bis auf das AKW Isar 1 sollten alle anderen «stillgelegten» Atomkraftwerke sowieso zur Wartung abgeschaltet werden. Eine Ethikkommission soll diese Überprüfung begleiten. In der Europäischen Union sollen alle 143 Atomkraftwerke einem Stresstest unterworfen werden.
Was die deutsche Regierung von ihrem Beschluss hält, hat Wirtschaftsminister Rainer Brüderle auf einer Besprechung mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie ausgeplaudert. Gemäss Gesprächsprotokoll wies Brüderle «erläuternd darauf hin, dass angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen Druck auf der Politik laste und die Entscheidungen daher nicht immer rational seien». Das ist das Plädoyer eines «Homunculus oeconomicus» mit einer Rationalität, die noch nicht einmal versucht, die Diskrepanz zwischen Handlungsfolgen und Wissen darum aufzulösen. «Kompetente» Energiepolitik bedient immer nur die kurzfristigen Profitinteressen der Energiekonzerne, sie ist also borniert.
Die atomare Energie ist, anders als von den Brüderles aller Nationen erhofft und versprochen, keine Alternative zu den fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Gas. Dies ist die wichtigste Lehre aus der Atomkatastrophe von Fukushima. Sie hat die fast vergessenen oder verdrängten Lektionen von Tschernobyl und Harrisburg bestätigt. Die weltweit agierende Atomlobby verweigert sich ihnen, und die Politik folgt ihr darin, möglicherweise aus einem Grund, den der SPD-Energiepolitiker Hermann Scheer in seinem kurz vor seinem Tod im Oktober 2010 veröffentlichten Buch «Der energethische Imperativ» erwähnt: «Die Atomtechnik ist in allen Atomwaffenstaaten eine ‹Double-Use-Technik›. Atomare Rüstung ohne eigenes atomtechnologisches Potenzial ist nicht denkbar [...]. Die Atomenergienutzung zu beenden bedeutet, die Abrüstung der Atomwaffen realisieren zu müssen.»
Atomkraftwerke schrecken tatsächliche und potenzielle Gegner ab, nicht nur weil sie Zeitbomben sind, sondern weil sie das technische Know-how und das Potenzial zum Bau der Atombombe dokumentieren. Weshalb sonst soll der Iran am Bau eines Atomreaktors gehindert werden?
Das Energiemodell der vergangenen Jahrzehnte, in dessen Zentrum sich Kohle, Erdöl, Erdgas und Atom befinden, muss schleunigst aufgegeben werden. Doch prompte Auswege aus dem fossil-nuklearen System sind schwer zu finden. Natürlich, erneuerbare Energien stehen als Alternative zur Verfügung. Doch wird das nur dann gehen, wenn nicht nur der fossile Treibstoff oder der Atomstrom durch Sprit aus Biomasse und Strom aus Windkraft ersetzt werden, sondern wenn auch die Energiewandlungssysteme und mit ihnen die Lebens- und Produktionsweise, wenn also auch gesellschaftliche und Naturverhältnisse grundlegend umgestaltet werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Doch wäre es besser, heute und nicht erst morgen damit zu beginnen.
Fukushima mahnt; eine sozial gerechte Gesellschaft und eine friedliche Zukunft wird es nur mit der Nutzung solarer Energien geben.
Elmar Altvater
Der Politikwissenschaftler und Ökonom Elmar Altvater (* 1938) lebt in Berlin und schreibt regelmässig für die WOZ. Der emeritierte Professor der Freien Universität Berlin untersucht die Strudel der Finanzmärkte ebenso wie die Möglichkeiten einer solidarischen und solaren Ökonomie. Zuletzt schrieb er in der WOZ über den schwachen Euro (siehe WOZ Nr. 3/11, www.tinyurl.com/altvater). Sein jüngstes Buch beschäftigt sich mit der hegemonialen Auseinandersetzung in der Krise: «Der grosse Krach oder die Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen, von Politik und Natur» (Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2010).