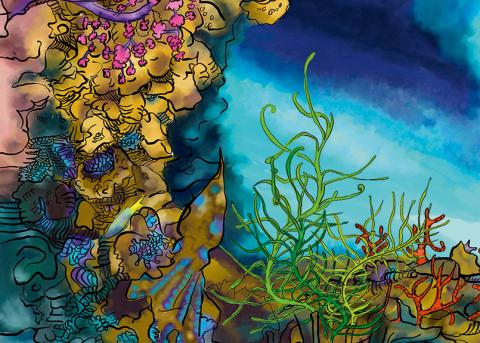Globale Gesundheit: Global denken, lokal heilen
Professor Eduardo Missoni erforscht, wie sich die Globalisierung auf die Gesundheit auswirktWie kann für alle Menschen ein «Zustand des vollständigen Wohlbefindens» erreicht werden? Eduardo Missoni untersucht, welchen Einfluss die weltweite Vernetzung auf die Gesundheitsversorgung hat.
WOZ: Professor Missoni, Sie forschen über «Globale Gesundheit», was versteht man darunter?
Eduardo Missoni: An sich meint man damit die Gesundheit von allen Menschen auf der Welt. Aber für mich ist es auch ein Studienfach. Wir untersuchen die immer schneller voranschreitende Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Es geht um die Art und Geschwindigkeit der Kommunikation oder des Verkehrs, denn mit den Menschen reisen auch Krankheiten. Oder um die Frage, wie sich das Konsumverhalten verändert. Weil sich die Menschen heute anders ernähren als vor fünfzig Jahren, ist auch Fettleibigkeit zu einer globalen Epidemie geworden.
Unsere Forschungsarbeit beinhaltet alle möglichen geografischen, biologischen, sozialen oder technischen Aspekte der Globalisierung, so auch den möglichen Einfluss von gentechnisch veränderten Organismen auf die Gesundheit und den Einfluss der Migration oder der Informationstechnologie. Wenn wir also Fragen zur globalen Gesundheit stellen, messen wir zwar einerseits den Gesundheitszustand der Bevölkerung, aber gleichzeitig betrachten wir auch die Wechselbeziehungen zwischen menschlicher Gesundheit und dem gesamten Ökosystem. Dabei gibt es eine ganze Reihe von Phänomenen, die nicht nur lokale oder nationale Auswirkungen haben, sondern eben globale.
Untersuchen Sie auch die politischen Aspekte der Globalisierung?
Ja. Dabei geht es uns vor allem um die Frage, wie globale Gesundheit gesteuert und verwaltet wird. Nicht nur von Regierungen: Uns interessiert auch die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO, des internationalen Währungsfonds IWF, von nichtstaatlichen Organisationen oder von Akteuren im privaten Sektor wie diversen Philanthropen. Globalisierung heisst Vernetzung, weit über die traditionellen Grenzen der Nationalstaaten hinaus. Mit der Globalisierung geht zudem eine stete Deregulierung einher, die zur Folge hat, dass die ursprüngliche staatliche Kontrolle – zum Beispiel des Verkehrs – immer schwächer wird.
Das klingt so, als ob das Lokale keine Rolle mehr spielte.
Keineswegs. Denn parallel zur Globalisierung wird die lokale Identität der Menschen stärker. Es ist heute klar, dass Lösungen für lokale Bedürfnisse zu den lokalen Bedingungen passen müssen. Das gilt besonders für die Gesundheitsversorgung.
Sie kritisieren die verschiedenen marktwirtschaftlichen Ansätze in der Gesundheitspolitik und die von oben verordneten Programme zur Bekämpfung von Krankheiten. Was ist in den letzten dreissig Jahren schiefgegangen?
Zuerst muss man sagen, dass vor der Gründung der Weltgesundheitsorganisation 1948 keine Institution existierte, die sich mit der Gesundheit auf globaler Ebene beschäftigt hat. Erst in den Statuten der WHO wurde festgehalten, dass Gesundheit ein allgemeines Anliegen und das Fehlen von Gesundheit eine weitreichende Gefahr für alle Menschen darstellt. Es ist also im Interesse aller Staaten und aller Menschen, sich um die Gesundheit zu kümmern.
Doch ein Recht auf Gesundheit wird auch in der Allgemeinen Erklärung der Uno nicht speziell genannt.
Nicht das Recht auf Gesundheit an sich. Seit Jahren gibt es eine Debatte darüber, was unter einem solchen Recht genau zu verstehen ist. Aber Gesundheit ist eine weltweite Verantwortung, und Gesundheit für alle ist grundlegend für weltweiten Frieden und Sicherheit. Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Uno definiert klar das Recht jedes Menschen auf «einen Lebensstandard, der ihm und seiner Familie Gesundheit gewährleistet». Es geht dabei also um die Lebensbedingungen wie Arbeit oder Bildung. Hier stellt sich die Frage, was eigentlich Gesundheit ausmacht. Und das wiederum ist in der Verfassung der WHO festgehalten, sie wird definiert als ein «Zustand des vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet».
Warum sträuben sich noch immer so viele Staaten, das Recht auf Gesundheit anzuerkennen?
Das würde für die Regierungen viele zusätzliche Verpflichtungen mit sich bringen. Ich muss allerdings auch anmerken, dass viele Länder das Recht auf Gesundheit in ihrer Verfassung haben, auch wenn es unterschiedlich formuliert sein mag. Rein juristisch müssten sich die Staaten also um die Gesundheit kümmern.
Sie tun es nicht?
Die politische Debatte hat sich stark verändert. Früher ging es darum, den Menschen bessere Lebensbedingungen zu versprechen. Beobachtet man aber die politischen Debatten der vergangenen Jahre, so geht es in zahlreichen Ländern meist nur noch um eines: Die Politiker versprechen Wirtschaftswachstum. Doch mir als Bürger ist das egal. Ich will in erster Linie einen Job, ein Zuhause, ab und zu Ferien, eine Ausbildung für meine Kinder und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Trotzdem nehmen die Politiker inzwischen an, dass mehr Wirtschaftswachstum von der Bevölkerung automatisch als Verbesserung der Lebensbedingungen verstanden wird.
Welche Rolle spielt hier die aktuelle Weltfinanzkrise?
Nun fragt erst recht kaum jemand mehr nach den Auswirkungen. Überall in den Medien sehen wir, wie Börsen zusammenbrechen oder wie viele Menschen ihre Arbeit verlieren, und alle fragen nur: Wie geht es der Wirtschaft? Und inzwischen machen sich sogar die normalen Bürger Sorgen darum. Es hat eine erkennbare Veränderung des Denkens stattgefunden.
Ein Umdenken?
Ja. Da muss man bis 1949 zurückgehen, als US-Präsident Harry Truman in seiner zweiten Antrittsrede sagte, die USA hätten die Pflicht, mit ihrem technischen Wissen den «unterentwickelten Ländern» zu helfen. Allerdings verstand er unter Entwicklung vor allem wirtschaftliches Wachstum. Auch die Vertreter des Bretton-Woods-Abkommens, die nach dem Zweiten Weltkrieg für ein internationales Währungssystem mit festen Wechselkursen eintraten, sahen ihre Rolle vor allem darin, die wirtschaftspolitischen Massnahmen des «Washingtoner Consensus» durchzusetzen, der von Schuldnerländern sogenannte Strukturanpassungen wie beispielsweise die Privatisierung der öffentlichen Einrichtungen fordert. Diese spezielle Ideologie wurde immer dominanter, sodass ihr heute alles geopfert wird.
Wie äussert sich das?
Um aufzuzeigen, ob es einem Land gut geht oder nicht, werden vor allem ökonomische Indikatoren wie das Bruttonationaleinkommen BNE benutzt. Doch das BNE zeigt nicht, wie viele Kinder in einem Land an Durchfall leiden. Dabei ist das einer der aussagekräftigsten Indikatoren für Armut. Es zeigt auch nicht, wie viele Frauen in einem Land Zugang zu Schwangerschaftsuntersuchungen haben, wie viele Kinder zur Schule gehen oder ob die Mädchen gleich viel zu essen erhalten wie die Buben. Für das tägliche Leben sind diese Faktoren wesentlich relevanter als das BNE.
Gibt es denn Gegenbewegungen?
Ja. Inzwischen gibt es auch andere Indikatoren wie den Index der menschlichen Entwicklung HDI oder den Index für die menschliche Armut HPI. Zudem gibt es Ökonomen wie den Franzosen Serge Latouche, die das Konzept der Wachstumsrücknahme vertreten und alternative Indikatoren entwickeln.
Und die WHO?
Die WHO hatte 2001 eine Kommission für Makroökonomie und Gesundheit gegründet, deren Ziel es war, die Ökonomen davon zu überzeugen, dass Investitionen in die Gesundheit gut für das Wirtschaftswachstum sind. Doch man kann Gesundheit nicht fördern, ohne auch die bestimmenden Sozialfaktoren zu berücksichtigen. Damit hat sich zwischen 2005 und 2008 die Commission on Social Determinants of Health, also die Kommission für soziale Gesundheitsfaktoren, beschäftigt. Sie hat Vorschläge entwickelt, wie jene Faktoren verändert werden können, die zu sozialer Ungleichheit und schlechter Gesundheit führen. Das sind alles Gegenbewegungen, die ebenfalls das Denken beeinflussen und einen mit Hoffnung erfüllen. Zuerst wurden die soziale Relevanz der Gesundheit und die Idee von Gesundheit für alle fallen gelassen. Doch inzwischen ist sie wieder zurück auf der Agenda. Und heute geht es um ein weitreichendes Konzept der Gesundheit für alle, und nicht um einige selektive Programme für die Armen oder um die Kontrolle einzelner Infektionen.
Aber es gibt immer noch einen starken Trend zur Privatisierung der Gesundheitsversorgung.
Ja, und er gleicht tatsächlich einer Epidemie. In jedem Land, in dem wegen einer Schuldenkrise die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des IWF angewendet wurden, leidet die Gesundheit der Menschen. Sogar dort, wo bereits eine gute medizinische Grundversorgung bestand, ist dieser Trend zu beobachten. Zudem wird durch die Einführung selektiver Programme das normale Gesundheitssystem geschwächt.
Was verstehen Sie unter selektiven Programmen?
Bei der selektiven medizinischen Grundversorgung geht es nur darum, einige wenige Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose oder Aids zu identifizieren und diese gezielt zu bekämpfen. Doch diese Programme haben eine eigene Verwaltung und Finanzierung. Sie funktionieren parallel zum normalen Gesundheitssystem und ziehen von diesem Ressourcen ab, beispielsweise ausgebildetes Personal. Auch wenn der Kampf gegen diese Krankheiten wichtig ist: Die Programme bieten keine Lösung, denn Gesundheit ist ein soziales Problem. Der selektive Ansatz ist aber natürlich billiger – oder zumindest billiger, als es die Restrukturierung des ganzen Gesundheitssystems wäre – und geht Hand in Hand mit der Politik des Neoliberalismus und der Kürzung aller öffentlichen Ausgaben.
Was muss sich ändern?
Die Politik muss Gesundheit zunehmend als relevantes Thema erkennen. Und mehr Ressourcen müssen in die Gesundheit fliessen. Entweder von der internationalen Entwicklungshilfe der Staaten oder von privaten Spendern. Wichtig ist aber auch, dass dieses Geld effizienter eingesetzt wird. Wir müssen vom selektiven Ansatz wegkommen und stattdessen die bestehenden Gesundheitssysteme stärken – mit dem Ziel, allen Menschen einen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Eduardo Missoni ist Professor für Globale Strategien für Gesundheit an der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand. Er lebt in Genf.
www.eduardomissoni.net