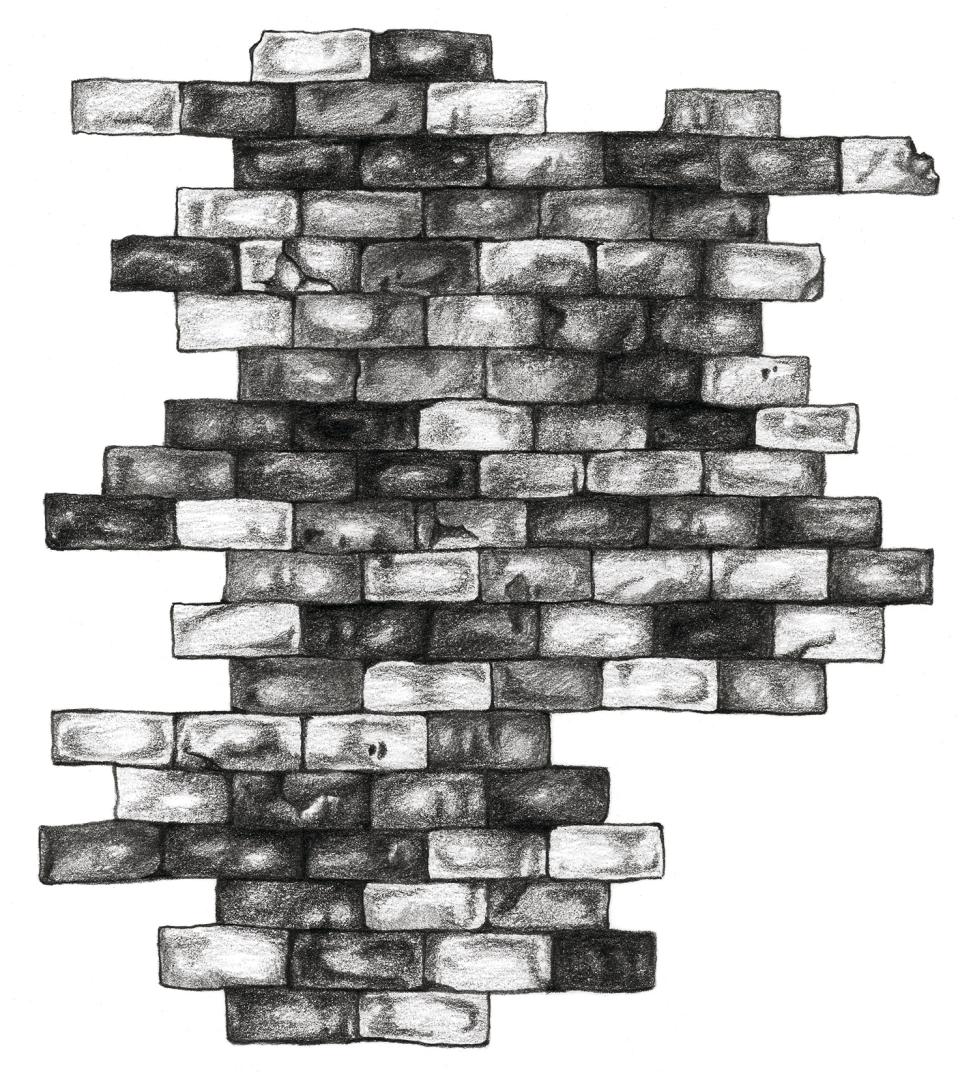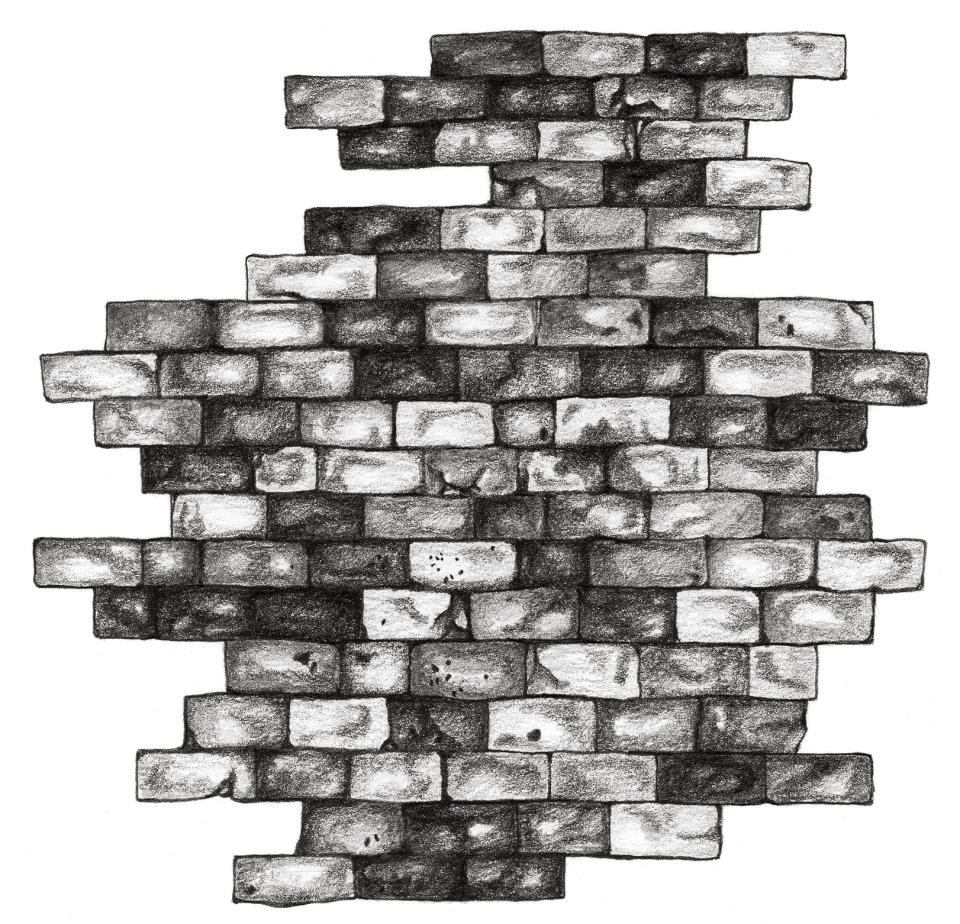In einem indischen Gefängnis: «Lies uns das vor, Onkel!»
In Indiens Gefängnissen sitzen vor allem Untersuchungshäftlinge. Viele von ihnen wissen nicht, wann sie einem Gericht vorgeführt werden – und ob sie jemals wieder freikommen. Ein Knasttagebuch unseres Indienkorrespondenten.
«Thane Central Jail» steht auf dem grossen Schild über dem eisernen Tor, «Zentralgefängnis von Thane», einer Stadt rund dreissig Kilometer nordwestlich von der Bombayer Innenstadt. Der Polizist, der mich hierher begleitet hat, liefert mich beim Wachposten ab und lässt sich den Empfang quittieren. Die Schlange vor mir ist lang. So viele Leute also wandern jeden Tag in den Knast. «Sie sind neu hier?», fragt der Zwanzigjährige vor mir. «Aber keine Angst, ich erzähle Ihnen, wie das hier funktioniert. Ich war schon öfter da, drinnen habe ich mehr Freunde als draussen.» Guddy, enge Jeans, schwarzes T-Shirt, rät mir, mich auf den Boden zu setzen: «Es dauert lange, bis wir drankommen.»
Dann redet er. Offenbar hat er nur darauf gewartet, jemandem seine Geschichte erzählen zu können. «Ich werde manchmal bei kleinen Diebstählen geschnappt, nach Raufereien mit Nachbarn verhaftet oder beim Schwarzfahren erwischt», sagt Guddy. «Aber diesmal habe ich gar nichts getan. Bei uns in der Nachbarschaft wurde eingebrochen, die Polizisten konnten niemanden ausfindig machen, standen unter Druck – und dann bin ich ihnen eingefallen.» Warum gehst du nicht ins Gefängnis, hätten sie ihn gefragt, wir holen dich ein paar Tage später wieder raus und geben dir tausend Rupien dafür (umgerechnet fünfzehn Franken). Guddy war einverstanden.
Nach einer Weile rücken ein Tisch und zwei Stühle mit Wärtern in mein Blickfeld, die Namen und Adressen aufschreiben. Nach dem Tor der Umkleideraum. Das Handy, das Portemonnaie, die Tragtasche abgeben; der Rest kommt in einen Plastikbeutel: Zahnpasta und Zahnbürste, Seife, ein Handtuch, zwei Bücher, ein Notizblock, eine alte Zeitung. Dann bis auf die Unterwäsche ausziehen und in die mitgebrachte kurze Hose und das T-Shirt schlüpfen. «Und nimm auch dies mit», sagt der Wärter und reicht mir zwei leere Plastikflaschen. «Das wirst du brauchen.» Guddy ist schon verschwunden, und ich spüre, wie die Angst in mir hochkriecht.
Dann durch das nächste Tor, bewacht von zwei Polizisten mit Gewehren in der Hand: «Rein in den Hof!», befehlen sie. «Dort wird man dir deine Baracke zuweisen.» Wieder fällt ein Tor hinter mir zu, da kann man schon nervös werden. Ein Wärter ruft meinen Namen, ich folge ihm zur Baracke Nummer zwei, erster Stock.
Viele Geschichten
«He, wen hast denn du umgebracht?», fragt ein langer Kerl mit riesigem Schnauz. Hinter ihm kauern Häftlinge, die die Neuankömmlinge beobachten. «Wir sind nur zu viert», ruft ein kleinwüchsiger Gefangener, «komm doch zu uns.» Sie breiten ein Leintuch aus, damit ich nicht auf dem nackten Boden sitzen muss; dann stellen sie sich vor: Der Kleine heisst Ajay, die anderen nennen sich Santosh, Vijay und Ritesh. Und dann erzählen sie ihre Geschichten.
Ajay, mit zwanzig Jahren der Jüngste in der Gruppe, ist ein «tribal», ein Nachfahre der indischen Urbevölkerung. Am vorletzten Erntefest hätten sich das Dorfoberhaupt und sein Bruder um ein Stück Land gestritten, erzählt er: «Die Prügelei eskalierte, mein Bruder stach zu, der andere starb sofort.» Er selber habe gerade einen Korb repariert, als sein Bruder hereingestürzt sei und ihm das blutige Messer in die Hand gedrückt habe. Die Polizei fand ihn mit der Tatwaffe, jetzt ist er seit achtzehn Monaten hier.
Santosh ist mit seinen 35 Jahren der Älteste der Gruppe, alle nennen ihn «Dada», grosser Bruder. Er ist Klempner von Beruf und sitzt wegen eines Diebstahls seit drei Jahren hier. Vor einem halben Jahr hätte man ihn auf Kaution entlassen, aber er konnte die verlangte Summe (5000 Rupien, umgerechnet 75 Franken) nicht zahlen. Vijay, 28 Jahre, langer Bart, lange Haare, ausdrucksloses Gesicht, hat einen Freund getötet, weil dieser – seiner Meinung nach – ein Auge auf seine Schwester geworfen hatte. Er wohnte direkt gegenüber dem Gefängnistor.
Der 22-jährige Ritesh sieht viel jünger aus, als er ist, und kommt aus Uttar Pradesh. «Ich habe als Verkäufer in einem Lebensmittelladen gearbeitet», erzählt er, «und mich dann in ein Mädchen aus Bombay verliebt. Ihre Eltern seien mit der Heirat einverstanden, hat sie gesagt, sofern wir eine eigene Wohnung hätten.» Also nahm er einen zweiten Job als Nachtwächter an, sparte zwei Jahre lang und kaufte mit Unterstützung seiner Familie eine Wohnung. Um zu zeigen, wie sehr er sie liebte, registrierte er das Einzimmerapartment auf ihren Namen und traf am nächsten Tag ihre Familie, um einen Hochzeitstermin zu vereinbaren. Doch statt des erwarteten freundlichen Empfangs zettelten ihre Brüder einen Streit an, schlugen Ritesh zusammen und übergaben ihn der Polizei. Inzwischen sitzt er seit vier Jahren hier. «Ich habe das Mädchen verloren, alles Geld und meinen Job – und verliere allmählich meinen Verstand», sagt Ritesh mit Tränen in den Augen. Er könne kaum schlafen, habe schreckliche Träume und sei noch nie von seinen Eltern besucht worden.
Santosh reicht mir ein Stück Chapati, dabei ist Essen das Letzte, woran ich denke. Mitglieder anderer Gruppen winken herüber, manche starren nur vor sich hin. Um 9 Uhr abends kommen die «boots» (wie die Gefangenen die Schliesser nennen) und befehlen den beiden besonders finster dreinschauenden «captains», Vorbereitungen fürs Nachtlager zu treffen – was diese als Hilfswärter amtierenden Häftlinge auch sofort laut schreiend tun. Die Häftlinge stellen sich in drei Reihen auf und breiten ihre Laken aus; Ritesh bietet mir ein Eck seines Tuchs an, da ich meins noch nicht habe.
Die zwanzig mal sechs Meter grosse Baracke wurde einst für 80 Insassen gebaut, heute Nacht sind wir aber 214. Das Lager ist unbequem, die Leiber meiner Kollegen reiben an meinem Körper. Der schlaflose Ritesh stöhnt, Ajay träumt schlecht und schlägt um sich, die hellen Lampen, die Hitze und die Moskitos halten mich die ganze Nacht wach. Wie oft werde ich wohl solche Nächte überleben müssen, bis mich mein Anwalt hier rausholt? Nie zuvor habe ich mich so hilflos gefühlt.
Der zweite Tag
Der nächste Morgen ist so völlig anders als sonst. Kein Vogelgezwitscher, kein weicher Wind im Gesicht, keine aufgehende Sonne; nur riesige hässliche Wände. Einige schlafen noch. Die Uhr an der Wand zeigt 5 Uhr, darunter ein Plakat mit der Aufschrift «Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft». Um 5.30 Uhr sperren die Boots die Türen auf, zwei Polizisten mit erhobenen Schlagstöcken schimpfen lauthals: «Alle sofort in eine Linie!» Dann zählen sie durch. Dileep, der zu einer anderen Gruppe gehört, hat Bauchschmerzen und ist zu spät dran, die Polizisten schlagen ihn auf den Kopf. Ajay schnappt sich einen Plastikbecher und rennt durch die Tür. «Er versucht, Tee zu organisieren», erläutert Santosh. Kurz danach ist Ajay zurück: «Wieder nur Tee für die Polizisten», sagt er.
Eine Stunde für die Morgenwäsche. «Beeil dich, Onkel», ruft Ajay. Die Leute strömen zu einem vielleicht neun mal zehn Meter grossen Raum mit über einem Dutzend Zellen ohne Tür, ohne Wasserhahn, alles «Indian style»: schmutzig und stinkend. Der Geruch ist ekelerregend. Aber immerhin kann ich mir kurz die Zähne putzen und das Gesicht mit Wasser aus einer der beiden Flaschen waschen, die mir der freundliche Wärter am Tor gegeben hat.
Auf dem Innenhof trainieren einige ihre Fitness. Manche haben Sand in Säcke gefüllt und wuchten sie hoch, andere massieren sich gegenseitig, eine kleine Gruppe läuft schnell im Kreis. Santosh gibt mir einen Stoss. «Du musst da mitmachen, Onkel», sagt er, «wer nicht aktiv bleibt, überlebt das hier nicht.»
Um 9 Uhr kommt das Frühstück: Puffreis und grüne Chilis, wie jeden Morgen. Sie würden schon lange keinen Puffreis mehr essen, sagt Ajay; schmeckt schal und ist voller Steinchen. Bis zum Mittag gibt es nun nichts zu tun – ausser herumsitzen und reden. Bei meinem flotten Rundgang ist mir ein Kerl aufgefallen, der aus Lehm kleine Töpfchen formt und sie über einer Kerze backt. Das sei für die Captains und ihre Drogen, sagen die Kollegen.
Um 12.30 Uhr bringen die Wärter das Mittagessen: grober Reis und wässrige Linsen. Da mir noch kein Geschirr zugeteilt wurde, teilt Santosh den Teller mit mir. Dann wieder Freizeit. Viele dösen in den Ecken vor sich hin, ich hole meine Notizbuch hervor. Wie lange habe ich davon geträumt, endlich dafür Zeit zu haben: Briefe schreiben, meine Gedanken ordnen, Pläne skizzieren! Aber ich kann mich nicht konzentrieren. Wie lange ich wohl hier sein werde? Manche sind seit fünf Jahren da, ohne dass ihr Fall auch nur ein einziges Mal gehört wurde.
Um 16 Uhr taucht Ajay mit dem Abendessen auf, wieder Chapatis, wieder Linsen. Abendessen am Nachmittag? Er deckt den Topf zu («wegen der Fliegen und Kakerlaken»), dann wandern wir im Hof herum. Zurück im Gebäude raubt einem der Qualm schier den Atem. Alle Gruppen haben Papierschnipsel, alte Zahnbürsten, Lumpen und anderes brennbares Material zusammengekramt, zu Töpfen zerbeulte Teller auf drei Aluminiumbecher gestellt und ein Feuer entfacht; Ajay nahm dazu zwei Steine. Zwölf Öfen in einem Raum, wozu denn das? «Onkel, die Linsen sind kalt und schmecken nach nichts», antwortet Vijay. «So aber können wir die Chapatistücke in den Dhal eintunken, den wir mit Gewürzen aus dem Gefängnisladen angereichert haben.» Und die Wärter sagen nichts? «Jeder von uns zahlt dem Oberwärter dafür zehn Rupien in der Woche (umgerechnet fünfzehn Rappen). Er besteht nur darauf, dass wir hinterher sauber machen.» Nach dem Essen bekomme ich endlich mein Betttuch, ein Kissen, einen Teller und einen Becher. Bevor ich einschlafe, tröste ich mich mit dem, was ich heute gesehen und erlebt habe. Vor zwei Tagen noch hätte ich mir nie träumen lassen, dass es so einen Ort überhaupt gibt.
Der dritte Tag
Der Himmel ist bedeckt, nur wenige drehen ihre Runden. Santosh stellt mir Dominic vor, der sich freut, endlich mit jemandem englisch reden zu können. Der Chilene wurde vor zwei Jahren verhaftet, als er in einem Lagerhaus inmitten von Bombay für einen Kollegen eine Sendung abholen wollte. In dem Paket seien getrocknete Früchte, hatte der behauptet. Seine Botschaft beauftragte einen Anwalt, der sich um den Drogenfall kümmern sollte; doch geschehen ist bisher nichts. «Inzwischen weiss ich, wie die Dinge hier laufen», sagt der 46-Jährige. Ein Freund habe dem Anwalt viel Geld gegeben, genug für ihn und für all die anderen, die bei so was die Hand aufhalten. «Jetzt bewegt sich was», sagt Dominic und hofft, dass er in zwei Monaten wieder zu Hause ist.
Auf dem Weg zur Baracke begegnen wir Jack aus Nigeria. Der 28-Jährige hatte sich 2008 in Bombay niedergelassen und einen florierenden Textilhandel aufgebaut. Drei Jahre lang blühte sein Kleiderexport nach Nigeria, doch dann handelte sein Kollege mit gefälschten Schecks – und floh zurück nach Nigeria. «Da die Polizei ihn nicht mehr erwischen konnte, hat sie mich gegriffen», sagt Jack. Dominic erzählt, dass noch ein dritter Ausländer in seiner Zelle sitze: Javed, 24 Jahre alt, ebenfalls aus Nigeria; er wurde auf dem Bombayer Flughafen mit einem gefälschten Pass geschnappt.
Bleib aktiv, oder du wirst das hier nicht überleben: Immer, wenn ich mich ruhelos fühle, fallen mir Santoshs Worte ein. In einem solchen Augenblick fragt mich Vijay, ob ich ihm nicht ein bisschen Englisch beibringen könne. Warum nicht? Kurze Zeit später sitzen zwölf Kerle mit mir auf dem Boden; bis auf einen kennen sie alle das lateinische Alphabet und ein paar Brocken Englisch. Wir beginnen mit einer einfachen Lektion in Konversation. Meine Studenten sind aufmerksam, ernsthaft und zielstrebig bei der Sache. Plötzlich öffnet sich die Tür: «Was ist denn hier los?», brüllen die Boots. «Der Onkel lehrt uns Englisch», antwortet Santosh, «das verbessert unsere Berufsaussichten, wenn wir wieder draussen sind.» Durch den Besuch der Wärter erfahren alle in der Baracke vom Unterricht. Nach unserer Lektion melden sich zwei Untersuchungshäftlinge als Hilfslehrer; jetzt wollen alle unterrichtet werden.
Nach dem Mittagessen hole ich eins der zwei Bücher hervor, die ich mitgebracht habe: «The Secret» von Rhonda Byrne. Ich habe es schon gelesen, will es aber genauer studieren. Ich bin noch nicht auf der zweiten Seite angelangt, als mich meine Freunde bestürmen: «Lies und übersetze das für uns, Onkel», sagt Vijay. Kurz, nachdem ich begonnen habe, hören mindestens zwanzig Leute zu. Solch einen Enthusiasmus habe ich während all meiner Jahrzehnte, in denen ich Workshops für NGOs leitete, nicht erlebt. Der Wärter schaut wieder in meine Richtung, aber jetzt weiss er, dass das alles harmlos ist.
«Gibst du mir das Buch, Onkel, wenn du fertig bist?» Dominic will es sich ausleihen. Kurz danach bitten Jack und Javed ebenfalls darum. Ich reisse das 200-Seiten-Buch in 20-Seiten-Stücke und reiche Dominic den ersten Teil, der ihn danach an Jack weitergibt und sich die nächsten Seiten holt. Den Anblick an diesem Nachmittag werde ich nie vergessen: Rund ein Dutzend Gruppen, alle über Buchteile gebeugt, einer liest vor, andere übersetzen. In der Nacht zerreisse ich das zweite Buch, «The Power», von derselben Autorin. «Wir haben die Baracke in eine Bücherei verwandelt», sagt Santosh. Ich mache mir über meine Zukunft immer noch Sorgen, aber ich fühle mich nicht mehr hilflos und schlafe vier Stunden am Stück, länger als an den Tagen davor und danach.
Der vierte Tag
Warum hat mich mein Anwalt noch nicht zu kontaktieren versucht? Hat er Kaution beantragt? Hat er meinen Fall vergessen? Wie lange bin ich noch hier, wie lange kann ich durchhalten? Das sind die ersten Gedanken an diesem Morgen. Ich bitte Santosh, bei den Wärtern nachzufragen. Drei Minuten später ist er zurück. «Wenn du 200 Rupien aus deinem hinterlegten Portemonnaie organisieren kannst und ihm die Telefonnummer deines Anwalts und deine Fragen aufschreibst, kümmert er sich darum.» Ich gebe dem Wärter das Geld, sehe ihn aber nie wieder.
Vormittags der übliche Englischunterricht. Nach dem Essen kommt Dominic, der Chilene, mit einem Keks, ich teile meine Hälfte mit den anderen in der Gruppe. Halb Spanisch, halb Englisch erzählt mir Dominic seine Lebensgeschichte. Geboren als Sohn einer armen Bauernfamilie, studierte er in San Bernardo und verliebte sich in Isabella; beide freuten sich riesig, dass ihn eine Airline als Elektriker anstellte – bis er zum ersten Mal nach Bombay flog. «Isabella und meine beiden Töchter wären die glücklichsten Menschen, wenn ich vor Weihnachten wieder draussen wäre.»
Der fünfte Tag
Der Ruf «Allahu akbar» weckt uns; die muslimischen Mitgefangenen haben ihr Morgengebet begonnen. Ihr Vorbeter Ahmad, 24 Jahre alt, schaut mich an, lächelt und tritt nach dem Puffreis-Frühstück zu mir. «Wir wollen zusammenlegen und für den Abend ein Chicken-Curry bestellen», flüstert er mir ins Ohr. Ja geht das überhaupt? «Hier drin ist alles möglich, wenn man viel Geld hat oder mächtige Freunde draussen. Bist du dabei, Onkel?» Ich hole 200 Rupien (umgerechnet 2.90 Franken) aus dem Sicherheitsraum – mehr darf man pro Tag nicht entnehmen – und gebe Ahmad das Geld. «Die Wärter kassieren 800 Rupien für eine Portion Chicken-Curry, die im Restaurant 120 kostet», sagt Ahmad und verstaut das Geld in seiner Innentasche.
Chapatis und Chicken-Curry! Ich träume den ganzen Tag davon. Natürlich würde ich das Essen mit all meinen Freunden teilen, sage ich mir; endlich verstehe ich, wie das Gefängnis funktioniert. Mit trockenen Chapatis in der Hand warte ich bis spät nachts. Doch das Curry kommt nicht. Was ist los, Ahmad? «Dieses Schlitzohr von Wärter hat mit den Captains alles aufgefressen», sagt er. Ich liege hungrig und entmutigt auf dem Boden. Wie viel Unsicherheit, Schlaflosigkeit und schlechtes Essen können Menschen auf Dauer ertragen?
Der sechste Tag
Die Angst vor den Schlägen der Boots reisst mich vom Laken. Meine Finger fahren durch das ungekämmte Haar und über das unrasierte Gesicht. Ist doch egal, wie ich aussehe. Dann eine erfreuliche Überraschung. Endlich hat Ajay eine Tasse Tee ergattert! Jeder von uns fünfen nimmt einen Schluck; nie zuvor hat mir Teesüchtigem das Gebräu so gut geschmeckt wie an diesem Morgen. Danach ein paar Übungen im Hof, waschen, der Englischunterricht und die Lektüre der Bücher. Nichts Besonderes also.
Der siebte Tag
Ich wache auf mit einem Lächeln und winke allen zu. Javed von der Gruppe nebenan ruft: «Das muss Ihr Geburtstag sein, Sir. Sie sehen so glücklich aus.» Das bin ich auch. Alle meine Projekte laufen gut, viele verfolgen die Lektionen und lesen die Bücher, ich bin bisher nicht geschlagen oder beschimpft worden. Vijays Schwester ist zu Besuch gekommen und hat ihm ein Mango-Pickle mitgebracht, das wir uns teilen. Um 16 Uhr plärren aus dem Lautsprecher wie immer völlig unverständliche Durchsagen auf Marathi. Plötzlich kommt Santosh angelaufen. «Onkel, gerade ist dein Name ausgerufen worden, du kommst auf Kaution frei. Beeile dich, du musst bis 18 Uhr das äussere Tor erreichen.» Ajay holt meinen Plastikbeutel, dessen Inhalt ich an die Mitglieder meiner Gruppe verteile. Die Nachricht verbreitet sich rasch, und alle stehen da. «Du verlässt uns, Onkel?», ruft Dominic. «Der Onkel hat Glück, lasst ihn gehen», sagt Santosh. Jack legt einen kleinen Tanz hin und summt dabei ein Kiswahili-Lied, das er mir gestern vorgesungen hat. Alle Insassen kommen mit zum Tor. Ihnen laufen Tränen über die Wangen, mir auch.
Am eisernen Tor nehme ich meinen Geldbeutel und das Mobiltelefon in Empfang. «Zähl dein Geld!», befiehlt der Wärter. Ich weiss, dass er das eher in Erwartung einiger Rupien sagt als aus Sorge um mein Geld. Dann zum zweiten Tor, wo ich meine Knasttasche abgebe und mich abmelde. Draussen erwartet mich eine ganz andere Welt. Ich sehe zum ersten Mal seit einer Woche einen Vogel, eine Krähe. Dann sehe ich zwei Menschen, die auf mich warten – meinen Freund Lallubhai und meine Nichte Rita. «Wir sind zum Gericht, haben dort die Genehmigung zur Freilassung auf Kaution bekommen und sind hergerannt, um dich heute noch herauszuholen», sagt Rita. Sie führen mich zur nächstbesten Teestube, wo ich drei Tassen hintereinander trinke. Alle starren mich an, ich weiss warum: Stoppelbart, zerzauste Haare, trockene Haut, Blick in die Ferne. Ich wasche mein Gesicht, kämme mir das Haar und blicke noch einmal zum Tor zurück, bevor mich ein Taxi nach Hause bringt.
Nachtrag
Am nächsten Tag schreibe ich ein langes Mail an Isabella; Dominic hat mich darum gebeten. Das Mail ist auf Spanisch, ich tippe Buchstabe für Buchstabe ab und verstehe kein Wort. Am selben Abend kontaktiere ich seinen Anwalt und bitte ihn, das Verfahren zu beschleunigen. Am nächsten Tag ruft mich Dominics Frau an. Sie weint und erzählt mir viele Dinge, von denen ich nur ein Wort verstehe – «Thank you», das sagt sie mindestens ein Dutzend Mal. Am selben Abend bekomme ich einen weiteren Anruf aus Chile. «Hier spricht Father Toni, der Gemeindepriester von Isabella. Ich wollte Ihnen danken, weil sie Dominic geholfen, die Mail geschickt und mit dem Anwalt gesprochen haben», radebrecht er auf Englisch. «God bless you.»
Nach zwei Tagen treffe ich Santoshs Bruder und gebe ihm das Geld für die Kaution. Innerhalb einer Woche wird Santosh freigelassen, er kommt mich direkt aus dem Gefängnis besuchen, und wir sitzen den ganzen Abend zusammen. Santosh arbeitet jetzt wieder als Klempner.
Meinen Anwalt muss ich mehrmals aufsuchen, bis er Ajays Fall übernimmt. «Das ist eine Mordgeschichte, um den Mann auf Kaution freizubekommen, muss ich zum Bombay High Court», argumentiert er. Als ich nicht locker lasse, formuliert er einen Antrag. Kurze Zeit später ist Ajay frei, er arbeitet wieder als Verkäufer. Nicht nur Guddy, auch ich habe jetzt mehr Freunde als zuvor.
Für Ritesh konnte ich leider nichts tun; ich weiss auch nicht, ob er noch lebt. Er hatte schon vor unserer Begegnung zwei Selbstmordversuche unternommen.
Aus dem Englischen von Pit Wuhrer.
Unser Indienkorrespondent Joseph Keve (65) hatte sich der Polizei, die ihn wegen angeblicher Urkundenfälschung suchte, gestellt. Der zuständige Richter kam später zum Schluss: «Die Anklage scheiterte jämmerlich und konnte nichts beweisen, daher ist der Beschuldigte freizusprechen.»
Indiens Justizsystem: Vor allem Untersuchungshaft
Die indischen Behörden haben einen sehr einfachen Weg gefunden, um Kritik an den Zuständen in den Gefängnissen gar nicht erst aufkommen zu lassen: Der Zugang zu den Haftanstalten ist strikt begrenzt, Informationen kommen so gut wie nie an die Öffentlichkeit. Meine Nichte Rita wollte mich zweimal besuchen, beide Male wurde ihr der Zutritt mit fadenscheinigen Gründen verwehrt.
Man muss daher lange suchen, um Informationen zu finden. Hier ein Auszug aus einem Artikel der «Daily News and Analysis» 2007: «Das Zuchthaus Byculla in Zentral-Bombay beherbergt derzeit 9932 Insassen bei einer Kapazität von 200. Das Moradabad-Zentralgefängnis in Uttar Pradesh ist so überfüllt, dass die 2200 Häftlinge in Schichten schlafen müssen; es wurde für 650 Gefangene gebaut.» Ein Text aus dem Magazin «India Today» 2011: «Besonders gross ist die Überfüllung in Staaten wie Chhattisgarh (252 Prozent) und Delhi (193 Prozent).» Die Haftanstalt Thane wurde für 1105 Insassen gebaut; während meiner Haft sassen dort nach Angaben eines Wärters über 4000 Menschen ein.
Über 66 Prozent aller Häftlinge in indischen Anstalten sind Untersuchungsgefangene, das ist mehr als doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt. 2000 der rund 254 000 U-Gefangenen sind über fünf Jahre eingesperrt. Die U-Häftlinge sind Opfer einer selbstherrlich agierenden Polizei und eines enorm langsam arbeitenden Justizsystems: Nur 6,5 Prozent von ihnen werden verurteilt. Es kommt häufig vor, dass sich Unschuldige für schuldig bekennen – nur damit sie endlich vor Gericht kommen. Zudem siechen Tausende in den Haftanstalten vor sich hin, obwohl sie ihre Strafe längst verbüsst haben.
Joseph Keve