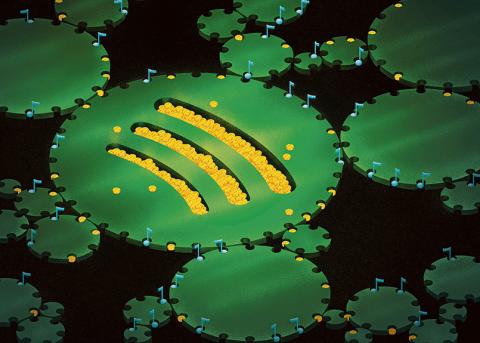Pop-Album «Teens of Style»: Das Ende von Indie
Songs für niemanden, aufgenommen auf einsamen Parkplätzen: Der junge Musiker Will Toledo alias Car Seat Headrest schenkt dem Indiepop das Requiem, das er verdient. Nachruf auf einen leeren Begriff.

Will Toledo ist ein bleicher Bub aus der US-Provinz. Seit er siebzehn ist, nimmt er Songs auf, zunächst im Auto, das er auf einsamen Parkplätzen abstellt. Die Autositze und Kopflehnen sind das einzige Publikum dieser Melodien, stumme Zuhörer, die ihn auch zu seinem absurden und einigermassen bescheuerten Künstlernamen inspirierten. So hat Toledo als Car Seat Headrest in fünf Jahren elf Alben auf der Onlineplattform Bandcamp veröffentlicht: Alben mit Lo-Fi-Songs und Songskizzen, auf die eigentlich niemand gewartet hat. Wir leben ja nicht mehr in den neunziger Jahren, als Bands wie Pavement das Slackertum definierten und Tocotronic noch Trainerjäckchen trugen. Anders gesagt: Die Aufzeichnungen von Car Seat Headrest sind eigentlich egal, aber dem klassischen Indielabel Matador schienen sie dann doch relevant genug, um diesen selbsternannten «nervous white boy» mit einem Plattenvertrag auszustatten.
Mit «Teens of Style» ist jetzt der erste Ertrag aus diesem Vertrag erschienen. Es ist ein Album, für das der mittlerweile 23-Jährige mit zwei Mitstreitern Lieder aus seinem Bandcamp-Katalog neu eingespielt hat – eine Best-of-Compilation als reguläres Plattendebüt. Und natürlich: Neu klingt an diesen Songs nichts. Vielmehr hört sich «Teens of Style» wie ein Relikt aus klassischen amerikanischen Indietagen an: Ein unsicherer, aufgewühlter und auch verschmitzter Mann berichtet über sein Aufwachsen, die Erkundung seiner Sexualität und die Liebe zur Musik. Bei allem fröhlichen Übermut und jugendlichen Überschwang, die Songs mit grandiosen Titeln wie «Psst, Teenagers Take Off Your Clothes» oder «Bad Role Models, Old Idols Exhumed» vermitteln: Dieses Album klingt auch wie ein Requiem. Ein Requiem auf die Zeiten, als Indie noch ein Do-it-yourself-Ethos implizierte und noch keine leere Worthülse war, die mittlerweile selbst ärgerlicher Konfektionsware wie dem Schweizer Popduo Boy angeheftet wird.
Alles und nichts
2015 ist aber nicht nur das Jahr von Car Seat Headrest und einer Musikerin wie Courtney Barnett, die mit ihren grossen kleinen Songs zumindest musikalisch auf die wohlbekannte Indierockautobahn eingespurt ist. Es ist auch das Jahr, in dem «Indie» definitiv in den Geschichtsbüchern versorgt wurde. Die BBC zeichnete kürzlich in einer dreiteiligen TV-Dokumentation «Music for Misfits: The Story of Indie» die Karriere des Begriffs in Britannien nach. Die MacherInnen starteten ihre Erzählung bei den Buzzcocks und bei prägenden Labels wie Rough Trade, natürlich waren die Smiths riesig, ebenso Rave. Britpop machten sie dann als den Moment aus, wo sich Indie an der Oberfläche etablierte. Die Doku endet mit The XX und dem einigermassen ernüchternden Fazit: Indie heute bedeutet alles und nichts – und umfasst in den USA natürlich wiederum andere Strömungen wie Hardcore und Bewegungen wie die Riot Grrrls.
Die Bedeutung des Worts «Indie» war schon von jeher vielfältig und immer diskutabel. Ist Indie einfach ein Musikstil, der meist von jungen weissen Männern mit Gitarren gespielt wird und wurde? Oder ist in erster Linie ein unabhängiges Plattenlabel entscheidend dafür, ob eine Musik «independent» ist? Was aber hiesse das für eine Musikerin wie PJ Harvey, die durchwegs auf einem grossindustriellen Majorlabel veröffentlicht hat? Kann sie per se keine Indiekünstlerin sein?
Solche Fragen wirken hinfällig in Zeiten der umfassenden Fragmentierung der Poplandschaft. Neben den zahllosen Mikroszenen ist der Mainstream grenzenlos und eklektisch geworden – ein Mainstream, in dem Superstars wie Kanye West, Beyoncé oder Adele (die auch ihr neues Album «25» auf einem Indielabel veröffentlicht hat) problemlos neben Grizzly Bear oder einer anderen als unabhängig geltenden Band stehen können.
Zu dieser Auflösung der Grenzen zwischen Indie und Mainstream beigetragen hat im letzten Jahrzehnt auch das Onlinemagazin «Pitchfork», das nach den Anfängen in der klassischen, gitarristisch geprägten Independent-Ecke immer weitere Stile und Subgenres erschlossen hat. «The Essential Guide to Independent Music and Beyond», nennt sich die Seite, die dank eines kontroversen Punktesystems und eigenen Festivals in Chicago und Paris zu einem Akteur wurde, der Karrieren beschleunigen oder auch schlimm ausbremsen kann. Zeitweilig griff «Pitchfork» den Untergrund mit der Plattform «Altered Zones» ab, auf der verschiedene Nischenmusikblogs gebündelt wurden. Doch mehr und mehr wurden solche Subseiten über den Haufen geworfen, das Magazin verabschiedete sich an der Oberfläche aus dem Kleinteiligen.
Abschied von der Nische
Mitte Oktober wurde das Onlineportal dann vom Grossverlag Condé Nast gekauft. Somit ist «Pitchfork» ab sofort Teil eines Portfolios, zu dem neben dem «New Yorker» auch Titel wie «Golf Digest» oder «Vogue» zählen. Der Verlag, so hiess es in der Condé-Nast-Mitteilung, freue sich dank des Kaufs des Titels auf die «very passionate audience of Millenial males», auf die «leidenschaftlichen männlichen Millenials» also, konkret: auf den nerdigen, konsumstarken Bubenklub, als der insbesondere das Publikum, das sich für Popkritik interessiert, noch immer gilt.
Abgesehen von diesem Satz, der auf Twitter und anderen Kanälen für einigen Spott sorgte, wurde die Mitteilung zumeist ziemlich gleichmütig aufgenommen. Denn ob etwas «Major» oder «Indie» ist, scheint in der Wahrnehmung der Kundschaft unwichtig geworden zu sein. Die Gewichte haben sich sowieso verschoben: Der Getränkehersteller Red Bull beispielsweise veranstaltet Avantgarde-Noise-Festivals, fördert experimentelle PopmusikerInnen und veröffentlicht auf der Website seiner Music Academy zuweilen ganz tolle musikjournalistische Features. So wird, was in seinem Selbstverständnis einstmals konsum- und systemkritisch gedacht war, nach und nach vereinnahmt und in den wachsenden Mainstream eingespeist.
Vorletzte Lieder
Gleichzeitig ist aber auch der unbeleuchtete Untergrund gewachsen. Wer sich etwa auf Bandcamp durchklickt, verliert sich schnell in diesem unaufgeräumten Laden, in dem die KünstlerInnen und Labels noch selber über ihre Musik verfügen und Preise festlegen können. Man bekommt dabei eine Ahnung davon, wie viele Songs und Tracks tagtäglich produziert werden. Musik, die kaum jemand jemals hören wird.

Das dachte sich auch Will Toledo, als er sich in Leesburg, Virginia, im Auto seiner Eltern verkroch und Songs von bis zu fünfzehn Minuten Länge einspielte, die wohl nur dank der vermeintlichen Anonymität des Internets so beglückend frisch ausgefallen sind. So frisch, dass Car Seat Headrest nun, da er an der Oberfläche aufgetaucht ist, die Gunst der Stunde nutzt und sein nächstes Album bereits angekündigt hat: «Teens of Denial» wird es heissen. Anzunehmen ist, dass Toledo hier abermals ein vor- oder auch vorvorletztes Lied anstimmen wird – auf die Musik, die wir einst Indie nannten.
Car Seat Headrest: Teens of Style. Matador/Musikvertrieb