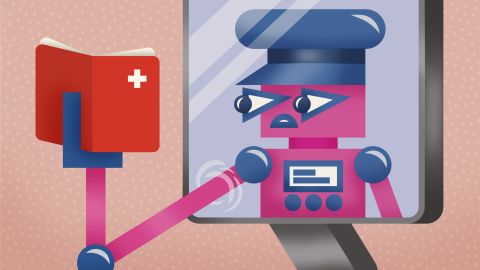Elektronische ID: Zur Baloise aufs Passbüro
Weil der Bund vor zehn Jahren mit der Einführung einer elektronischen ID gescheitert ist, will er die Aufgabe nun verschiedenen Grosskonzernen überlassen. Noch kann das Parlament dies stoppen.

Der Bund will sich darum drücken, die digitale Variante des Passes und der Identitätskarte – die sogenannte E-ID – selber an seine BürgerInnen abzugeben. Er fürchtet sich vor der technischen Herausforderung. Deshalb sollen das künftig Grosskonzerne machen, die sich angeblich besser mit dem digitalen Wandel auskennen.
Das Gesetz, das dies regeln wird, kommt am kommenden Mittwoch in den Nationalrat. Es trägt den nichtssagenden Titel «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste», kurz: «E-ID-Gesetz». Mit der E-ID soll man künftig seine Steuerunterlagen einreichen, einen Strafregisterauszug bestellen oder vielleicht auch einmal online abstimmen können. Es soll also ein vollwertiger Ausweis sein.
Eigentlich müsste es Swiss-Sign-Gesetz heissen. Das Konsortium Swiss Sign Group reisst nämlich gerade das Supergeschäft an sich: Es will seine bereits bestehende Swiss ID zur offiziellen staatlichen E-ID machen. Ursprünglich wurde die Firma Swiss Sign von der Post und den SBB gegründet. Vor einem Jahr baute man die Firma zum Megakonsortium Swiss Sign Group um. Ihm gehören zwanzig grosse Banken, Versicherungen, Krankenkassen und staatsnahe Betriebe an (vgl. «Die Swiss Sign Group» im Anschluss an diesen Text). Kommt das E-ID-Gesetz in seiner jetzigen Form durchs Parlament, vereint das Konsortium eine unglaubliche ökonomische und politische Power, ohne demokratisch legitimiert zu sein.
Verbale Nebelmaschine
Die Rechtskommission des Nationalrats hat das Gesetz schon vorberaten. Die sieben links-grünen Kommissionsmitglieder versuchen, den Schaden abzuwenden, und verlangen in ihrem Minderheitenantrag die Rückweisung des gesamten Geschäfts – «mit dem Auftrag, eine Vorlage auszuarbeiten, in der die Ausstellung einer E-ID als öffentliche Aufgabe festgeschrieben wird, die mittels Leistungsauftrag an Private übertragen werden kann». Das Risiko ist gross, dass sie damit nicht durchkommen.
Im Zentrum steht die Frage: Ist die Abgabe von Identitätsdokumenten – egal ob analog oder digital – nicht eine hoheitliche Aufgabe, die zwingend der Staat erfüllen muss? Nein, fand SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die das Gesetz ursprünglich zu verantworten hatte. Der Bundesrat überlässt das Feld den Privaten, weil er sich vor der Technologie fürchtet. Vor zehn Jahren lancierte der Bund ein eigenes Projekt, die Suisse ID, für eine staatlich anerkannte elektronische Unterschrift. Sie war ein Flop, kostete aber Millionen. Diese Erfahrung führte dazu, dass der Bundesrat heute der Meinung ist: Das sollen Private machen, die können das besser.
Inzwischen ist FDP-Justizministerin Karin Keller-Sutter für das Geschäft zuständig. Ein Glück, sonst wäre es für die SP-VertreterInnen in der vorberatenden Kommission schwieriger gewesen, gegen das Gesetz anzutreten. Verbal ist das Gesetz eine Nebelmaschine: Es ist etwa die Rede von «IdP». Die Abkürzung steht für «Identity Provider», heute würde man es noch als Passbüro bezeichnen. Übersetzt wird es aber als «Anbieterinnen von elektronischen Identitätsdienstleistungen». Das Passbüro wandert nun virtuell zur Bank, zur Krankenkasse oder zu den SBB.
Im Gesetzesentwurf ist nicht einmal garantiert, dass alle BürgerInnen einen Anspruch auf eine E-ID haben. Es könnte passieren, dass Leute mit Schulden bei den Firmen gesperrt sind und dann eben – wegen ihrer schlechten Bonität – bei keiner der beteiligten Firmen KundIn werden könnten und deshalb keine E-ID bekommen. Mindestens in diesem Punkt hat die Kommission nachgebessert: Sie verlangt, dass alle, die einen offiziellen Aufenthaltsstatus haben, auch eine E-ID bekommen müssen. Die linke Kommissionsminderheit möchte als Minimum noch ins Gesetz schreiben, dass der Bund ebenfalls E-IDs ausgeben kann, dass er sich an einem Identity Provider beteiligen darf. Das sollte selbstverständlich sein, fand aber in der Kommission keine Mehrheit.
«Staatliche Selbstaufgabe»
Min Li Marti, Zürcher SP-Nationalrätin und Mitglied der Rechtskommission, wundert sich grundsätzlich über das Gesetz: «Man tut so, als ob es einen funktionierenden Markt gäbe. Beim dominierenden Player Swiss Sign ist das aber ein Witz – de facto wird es keine weiteren Anbieter auf dem Markt, sondern eine Monopolsituation geben.»
Wie die Debatte im Nationalrat verlaufen wird, lässt sich schwer vorhersagen. Immerhin hat die Linke bei den Bürgerlichen eine prominente Unterstützerin: Die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala hat bereits klargemacht, dass sie gegen das Gesetz ist.
Fiala kritisiert die Furcht des Bundesrats vor der Technologie. «Das Argument des technologischen Wandels zu Ende gedacht, bedeutet, dass es sich der Staat nicht zutraut, in elementaren Fragen technisch auf der Höhe der Zeit zu sein. Das kommt einer Selbstaufgabe gleich», sagt Fiala. «Das Gleiche kann auch zu ‹Cyber Security› gesagt werden. Auch hier muss der Staat, wenn er seine Souveränität behaupten will, substanzielle eigene Ressourcen aufbauen, um nicht von privaten oder ausländischen Dienstleistern abhängig zu sein.» Der Staat müsse die E-ID selbst abgeben, die dazu erforderliche Technologie könne er durchaus auch einkaufen.
Zu Fiala muss man sagen, das sie im Verwaltungsrat der IT-Firma Provicis sitzt. Die Firma hat für den Kanton Schaffhausen eine eigene E-ID entwickelt, die «eID+». Der Kanton setzt sie ein, um seine Onlinedienste betreiben zu können. «Die E-ID der Swiss Sign Group kann das hohe Level an Identität – das wir brauchen – noch nicht anbieten», sagt Titus Fleck, IT-Verantwortlicher des Kantons. Mit ihrer E-ID kann man aber bereits sensitive Dokumente wie die Steuererklärung unterzeichnen. Theoretisch könnte Schaffhausen später das System von Swiss Sign übernehmen, sagt Fleck. Persönlich würde er aber den Staat als Anbieter bevorzugen. Fleck sagt auch, die E-ID des Kantons Schaffhausen liesse sich gesamtschweizerisch einsetzen.
Was passiert mit den Daten?
Politisch engagierte IT-Profis halten es ebenfalls für fahrlässig, die E-ID den Privaten zu überlassen. Erik Schönenberger, Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft, verweist darauf, dass Swiss Sign ursprünglich gegründet worden sei, weil sich die Unternehmen naheliegenderweise gesagt hätten: Wir alle haben Daten – legen wir sie doch zusammen, und überlassen wir das Geschäft nicht nur Facebook und Google. «Das vorliegende Gesetz verbietet zwar, Daten an Dritte rauszugeben», sagt Schönenberger. «Es verbietet aber dem Konsortium nicht, die Anmeldungsvorgänge selber auszuwerten und darauf basierend ein eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln, um beispielsweise personalisierte Werbeplätze zu verkaufen.» Google und Facebook würden ja auch nicht Benutzerprofile verkaufen – «aber sie werten die Daten so aus, dass sie Gruppen mit bestimmten Merkmalen bilden können, die dann gezielt mit Werbung bespielt werden. Und das liesse das Gesetz auch zu.»
Schönenberger begrüsst das Schaffhauser Modell, auch wenn man es seiner Meinung nach noch sicherer machen könnte. Grundsätzlich verlangt er, dass der Bund – neben Swiss Sign – auch eine E-ID anbietet.

Rutscht das Gesetz im Nationalrat und im Ständerat ohne grosse Änderungen durch, wäre es im Sommer fertig beraten. Dann wird sich entscheiden, ob die Digitale Gesellschaft zusammen mit anderen Organisationen das Referendum ergreifen wird.
Die Swiss Sign Group
Wenn das vorliegende E-ID-Gesetz durchkommt, wird die Swiss Sign Group die einzige Firma in der Schweiz sein, die staatlich anerkannte elektronische Identitäten ausgibt. Dem Konsortium gehören sieben Bankdienstleister (Genfer Kantonalbank, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six, UBS, Zürcher Kantonalbank), neun Versicherungen respektive Krankenkassen (Axa, Baloise, CSS, Helvetia, Mobiliar, Swica, Swisslife, Vaudoise, Zurich) und die drei staatsnahen Betriebe SBB, Post und Swisscom an.
Die staatsnahen Unternehmen und die Banken halten je 44 Prozent des Aktienkapitals, Krankenkassen und Versicherungen die restlichen 12 Prozent, teilt Thomas Kläusli, Pressesprecher von Swiss Sign, mit. Die Beteiligungen der einzelnen Aktionäre würden sie nicht kommunizieren. Die Aktionäre entscheiden, wer künftig bei Swiss Sign noch Aktionär werden darf.
Kläusli ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass «sich die Swiss Sign Group an das Konzept der Datensparsamkeit hält». Ihr Geschäftsmodell basiere darauf, dass die Onlineplattformen für das Aufschalten des Swiss-ID-Logins auf dem jeweiligen Portal bezahlten, «insofern kann nicht von einem Gratisdienst wie bei den bekannten Social-Media-Giganten gesprochen werden».
Nachtrag vom 16. Juni 2022: E-ID auf gutem Weg
Am Montag hat der Ständerat mehreren gleichlautenden Motionen zugestimmt, die verlangen, dass der Bundesrat einen staatlichen elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) schafft. Der Nationalrat hat die Motionen schon früher gutgeheissen. Die Lösung ist ein Lehrstück in direkter Demokratie: Noch vor einigen Jahren beharrte der Bundesrat darauf, dass er nicht in der Lage sei, eine E-ID auszustellen – das müsse die Privatwirtschaft übernehmen. Das Parlament winkte ein entsprechendes Gesetz durch. Das private Konsortium Swiss Sign Group stand bereit, um diese Aufgabe zu übernehmen; ihm gehörten sieben Banken (darunter Credit Suisse, UBS, Zürcher Kantonalbank), neun Versicherungen respektive Krankenkassen (darunter Axa, Baloise, Swisslife) und die drei staatsnahen Betriebe SBB, Post und Swisscom an.
Gegen das Gesetz wurde von links erfolgreich das Referendum ergriffen. Das Hauptargument: Eine so delikate Aufgabe dürfe nicht gewinnorientierten Konzernen überlassen werden. Im Frühjahr 2021 kam die Vorlage an die Urne und wurde abgelehnt. Die Parteien, die vorher noch für eine private Lösung einstanden, haben mittlerweile begriffen, dass die Bevölkerung doch ein gutes Gespür für Datensicherheit hat. Sie tragen inzwischen eine staatliche E-ID mit. Justizministerin Karin Keller-Sutter sagte am Montag vor dem Ständerat, die Vernehmlassung zu einem neuen E-ID-Gesetz werde voraussichtlich noch im Juni 2022 eröffnet. Geht doch.
Susan Boos