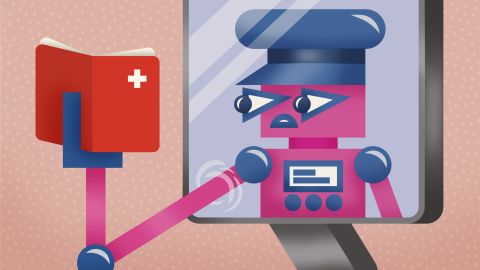Elektronische Identität: «Wollen wir den digitalen UBS-Bürger?»
Gegen das geplante Gesetz zur E-Identität regt sich in mehreren Kantonen Widerstand. Der Zuger Stadtschreiber Martin Würmli über mächtige Konzerne, dezentrale Lösungen und staatliche Aufgaben.

WOZ: Herr Würmli, Sie sind Stadtschreiber in Zug und Mitglied der Mitte-Partei, die eigentlich hinter dem Gesetz zur elektronischen Identität (E-ID) steht, das am 7. März zur Abstimmung kommt. Wie kommen Sie dazu, sich gegen die Vorlage auszusprechen?
Martin Würmli: Wir haben in der Stadt Zug vor ein paar Jahren gemeinsam mit der Fachhochschule Luzern ein Pilotprojekt realisiert: die Herausgabe einer E-ID basierend auf Blockchain-Technologie. Im Rahmen dieses Projekts haben wir herausgefunden, dass die Entwicklung einer dezentralen Lösung möglich ist, bei der die Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt stehen. Sie besitzen einen gesicherten Schlüssel auf ihren Mobiltelefonen und verwalten die E-ID selbst. Das heisst auch, sie haben die Hoheit über ihre Daten. Das ist mein Zugang zum Thema.
Dieses Projekt fand auf städtischer Ebene statt. Wäre es denn auch auf kantonaler oder auf Bundesebene umsetzbar?
Ja, technisch wäre das absolut möglich. Der Kanton Schaffhausen macht Ähnliches mit seiner eID+ bereits vor. Damit können Sie Ihre Steuererklärung abgeben oder eine Wohnsitzbestätigung bei den Behörden einholen. Wir arbeiten in Zug mittlerweile eng mit Schaffhausen zusammen.
Der Bund sagt, die Privaten könnten die Herausgabe einer E-ID besser stemmen als die öffentliche Hand, und bastelt ein entsprechendes Gesetz, das explizit private E-ID-Anbieter vorsieht, während Sie in Zug und in Schaffhausen dabei sind, tragfähige E-ID-Lösungen zu entwickeln. Da müssen Sie sich doch auf den Arm genommen fühlen?
Ich stimme in keiner Weise der Argumentation zu, der Staat könne diese Aufgabe nicht übernehmen. Dabei geht es nicht darum, dass die Gemeinden, die Kantone oder der Bund den technischen Teil selbst abwickeln müssen. In Schaffhausen und Zug übernimmt das mit der Softwarefirma Procivis auch eine private Firma, der Lead aber bleibt dabei letztlich in staatlicher Hand. Für mich als Vertreter der Verwaltung ist klar, dass das Identitätsmanagement eine Kernaufgabe des Staats ist und bleiben soll. Mir wäre es wohler, wenn die öffentliche Hand eine stärkere Rolle im Ganzen spielen würde.
Der Staat wird ja weiterhin eine Rolle spielen: Er überprüft die Identität der Nutzenden und bestätigt diese gegenüber den sogenannten Identity Providern (IdP), die künftig eine solch staatlich zertifizierte E-ID herausgeben dürfen.
Ja, aber den Verkauf, den Vertrieb und die Verwaltung der elektronischen Identität übernehmen künftig die IdP, beispielsweise Swiss Sign: ein Konsortium von Banken, Versicherungen, Swisscom, SBB und Post, das längst in den Startlöchern steht. Ich frage mich, wieso braucht es den Umweg über ein solches Konsortium?
Was meinen Sie mit Umweg?
In Schaffhausen und Zug liegen dezentrale E-ID-Lösungen vor. Der Prozess verläuft einzig zwischen den Behörden und den Nutzerinnen und Nutzern, die das Datenmanagement selber in der Hand haben. Das nun vorliegende Gesetz hingegen bringt private Anbieter ins Spiel, die künftig eine E-ID ausstellen werden und die Daten der Nutzerinnen und Nutzer als Zwischenhändler verwalten.
Was eigentlich gar nicht nötig ist …
Genau. Technologisch gesehen braucht es solche Intermediäre nicht. In der Argumentation der Befürworter heisst es immer, die zentral gespeicherten Daten würden von den Identity Providern nicht missbraucht, sie unterstünden auch weiterhin der Kontrolle des Staates. Ich will privaten Anbietern wie Swiss Sign auch gar nicht unterstellen, dass sie die Daten missbrauchen werden. Aber es ist ein kleiner Schritt, um als SBB zu sagen: Schau, lieber Nutzer, du hast eine Swiss-ID von uns, und eigentlich dürfen wir diese Daten nicht nutzen, und das machen wir auch nicht, aber wenn du die Daten freischalten würdest, dann erhieltest du das Generalabonnement zehn Prozent günstiger.
Aber Sie müssen doch zugeben, dass durch eine E-ID für die Firmen dahinter ein Effizienzgewinn entsteht, weil sich der Prozess beim Lösen eines Abos oder beim Erhalt einer Dienstleistung vereinfacht und verkürzt. Das spart Kosten.
Ich glaube schlichtweg nicht, dass dieser Effizienzgewinn, den die Befürworter des Gesetzes immer wieder ins Spiel bringen, der zentrale Grund ist, weshalb die Firmen hinter Swiss Sign bei der digitalen Identität mitmachen. Die würden einen solch hohen Investitionsaufwand nicht auf sich nehmen, wenn es nicht irgendwo eine Datenrendite gäbe.
Justizministerin Karin Keller-Sutter sagte kürzlich in der NZZ, die Daten dürften nicht für gesetzesfremde Zwecke genutzt werden. Damit werde verhindert, «dass Profile der Nutzer erstellt werden».
Ich habe diesbezüglich grosse Bedenken. Wenn die Nutzerdaten zentral über die Infrastruktur eines Anbieters wie Swiss Sign laufen, wo offenkundig grosse kommerzielle Interessen an genau solchen personenbezogenen Daten vorhanden sind, halte ich die Missbrauchsgefahr für wesentlich grösser als bei dezentralen Lösungen, wo die Hoheit über die Daten bei den Nutzerinnen und Nutzern liegt. Das grösste Problem der Vorlage sehe ich aber woanders.
Wo denn?
In der Debatte dominieren bisher die Argumente der Befürworter. Es gehe darum, Prozesse effizienter zu gestalten. Was meiner Ansicht nach viel zu wenig zur Sprache kommt, ist die langfristige Wirkung der Vorlage. Auf lange Sicht wird die E-ID eine immer wichtigere Rolle spielen und auf immer mehr Lebensbereiche angewendet werden. Ich gehe sogar davon aus, dass sie in absehbarer Zeit wichtiger wird als der rote Pass, bis hin zu dem Punkt, wo auch für einen Grenzübertritt ein Eintrag auf dem Mobiltelefon ausreichen wird, den zum Beispiel die UBS ausgestellt hat und verwaltet. Ich persönlich halte es aber für zentral, dass wir auch im digitalen Bereich als Schweizer Bürger unterwegs sind, und nicht als SBB- oder UBS-Bürger. Ich habe den Gesetzgebungsprozess eng verfolgt, und dabei ist mir bewusst geworden, dass viele Politiker und Politikerinnen die künftige Bedeutung der E-ID unterschätzen. Bereits vorgesehen ist ja beispielsweise eine Verknüpfung mit dem elektronischen Patientendossier.
Malen Sie nicht auch so schwarz, weil Sie Ihr eigenes Projekt in Zug in Gefahr sehen? Wenn Ihre Lösung so gut wäre, dann müssten Sie sich doch nicht vor der Konkurrenz fürchten?
Der Kanton Schaffhausen hat ja bereits angekündigt, dass er sein E-ID-Projekt beim Bund zertifizieren lassen wolle, wir in Zug würden uns da wohl anschliessen. Das wird im Fall einer Annahme des Gesetzes unsere Aufgabe sein: als öffentliche Hand ein dezentral angelegtes Konkurrenzprodukt anzubieten. Wir treten hier aber in Konkurrenz zu grossen, finanzstarken Playern, die bereits über enorme Kundenstämme verfügen. Wissen Sie, ich habe ein Postkonto, und schon mehrmals bin ich von der Post aufgefordert worden, ich solle doch endlich die Swiss-ID lösen. Die nutzen ihre vorhandenen Kundenbeziehungen bereits offensiv. Da liegt ein klarer Wettbewerbsnachteil vor, gegen diese Konkurrenz können wir nicht mithalten.
Martin Würmli (42) sass für die CVP im St. Galler Stadtparlament und ist seit 2014 Stadtschreiber von Zug. Er engagiert sich im Komitee «Nein zum E-ID-Gesetz».