Chlöisu Friedli: Drei Songs und was das Leben so hergibt
Das ewige Missverständnis vom depressiven Aussenseiter verfolgt Chlöisu Friedli seit jeher. Die Neuauflage seines Albums «Wohäre geisch?» bietet jetzt Gelegenheit, den beispiellosen Berner Blueser neu zu entdecken.
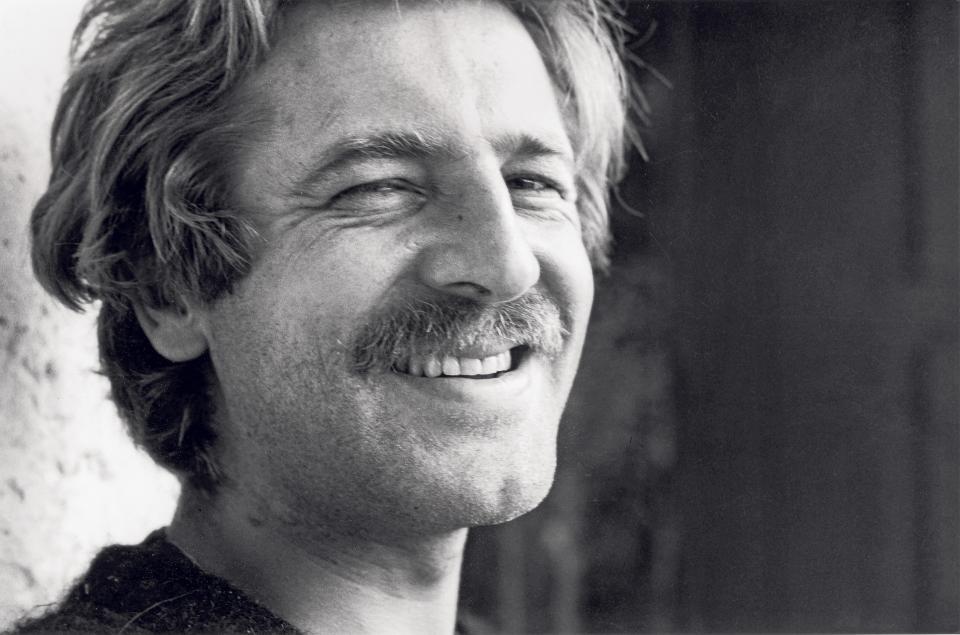
«Tscharnerguet, du bisch es! Pardon.» Und Hochhäuser sind halt grau. Der Drache steht im Wind, der Drache segelt um Bauprofile, die Zeit vergeht. Der Vater stirbt, und die Mutter kauft sich einen Fernseher. Der Bub drückt einen Boogie in die Tasten, und das Rösslein Hü reisst aus. Der Bub wird ein Mann, der Mann reisst auch aus. Im Fernsehen ist Kubakrise, StudentInnenprotest, Mondlandung. Der Mann schaut zu. Bern franst an den Enden aus. Beton ist halt grau. Und Bern geht spätestens um halb zwölf schlafen.
Das Mantra vom Aussenseiter
Dieser «Tscharni Blues» kreist seit 1981 über der Stadt. Chlöisu Friedli hat sich die Verse für eine Fernsehdokumentation über die mal berühmte, mal berüchtigte Hochhaussiedlung am Stadtrand ausgedacht. Es ist das erste berndeutsche Stück, das er im Tonstudio aufnimmt. Und viel ist dafür nicht nötig: das Klavier, seine kräftige Stimme und ein schwarzes Notizbuch. In wenigen Assoziationen erzählt er sich innerhalb eines schwerblütigen Bluesschemas durch die frühe Kindheit. Und stiftet dabei dem anonymen Quartier fast nebenher ein musikalisches Denkmal von berührender menschlicher Wärme. Es wird auch sein Denkmal sein. Von einer vergriffenen Langspielplatte hat es das rohe Stück auf CD und schliesslich ins Internet geschafft. 23 000 Klicks auf Youtube – das sind viel für einen, von dem ein paar Lieder übrig sind und ein paar Geschichten. Und Missverständnisse.
Die musikhistorische Erinnerung an Friedli und sein schmal gebliebenes Werk beginnt 1982 mit der Veröffentlichung der Schallplatte «Wohäre geisch?». Ein Jahr nach Friedlis Tod vereint sie die wenigen berndeutschen Lieder nebst körnigen Liveaufnahmen der Oldtime-Jazz-Kapelle, für die Friedli mit schnellen Fingern die Klaviatur hinauf- und hinunterkletterte. Das von seinem engsten Kreis kurzfristig initiierte Erinnerungsalbum wird zu einem beachtlichen Publikumserfolg. Doch die öffentliche Anerkennung fusst bald auf zweifelhaften Narrativen: Die Geschichte vom depressiven und alkoholkranken Aussenseiter wird zur Schablone, zum medialen Mantra – darunter leidet besonders die Familie des Musikers, die sich fortan eher um Stille bemüht.
Dass Chlöisu Friedlis Lieder überhaupt je in eine Platte geschnitten wurden, hat vielleicht an einem verrauchten Mittwochabend in den frühen Siebzigern seinen Ursprung. In Bern schart sich die Gegenkultur um die Folkmusik. Unterschlupf findet die Szene in der Mahogany Hall, dem Clublokal jener Oldtime-Jazz-Kapelle, für die Friedli das Klavier bedient. Einmal im Monat wird der kleine Laden am Klösterlistutz zum Treffpunkt der FolkenthusiastInnen der Stadt: Die Bühne ist offen, die Veranstaltungen, die sich nach amerikanisch-folkloristischem Vorbild «Hootenanny» nennen, sind gut besucht – wenn mittwochs nach zehn noch irgendwo Musik gemacht wird, ist das eine kleine Sensation im bürgerlichen Bern jener Zeit.
Der innere Diaprojektor
Friedli gesellt sich oft dazu, manchmal erst spät und nach der Arbeit. Er spielt seine Blues und Boogies, ein überschaubares Repertoire aus ungefähr drei rasenden Instrumentalstücken, die bei der versammelten Folkszene in ständiger Wiederholung eher auf zurückhaltende Begeisterung stossen. Doch zwischen diesen und einer allerdings bejubelten Gesangseinlage beginnt er bald damit, aus seinem Leben zu erzählen. In anekdotischen Ausflügen über die Arbeit als Magaziner beim Schreibmaschinenhersteller Muggli etwa oder über die Anschaffung von Kaninchen offenbart sich sein erzählerisches Talent in Pausen und wilden Assoziationen. Es sind die Töne zwischen den Stücken, die Chlöisu Friedli bald zu einem Liebling dieser Mittwochabende am Klösterlistutz machen. Hier findet man die Frühform seiner späten Lieder und im Grunde schon jenes poetische Schulterzucken, das etwa den «Tscharni Blues» bis heute so bemerkenswert macht.
In seiner Erzählkunst zeigt sich Friedlis Menschenverständnis – was im Dialekt etwas demütiger und treffender «Gspüri» genannt wird, eine ausgeprägte Sensibilität für die Kuriositäten des Lebens und der Menschen, die sich darin verfangen. Zuallererst natürlich der Erzähler selbst. Anders als bei Mani Matter und den Berner Troubadours findet sich wenig Kunstwille in dieser Erzählkunst, keine forcierten Pointen und konstruierten moralischen Gleichnisse, wie sie der franko- und anglofonen Liedtradition eingeschrieben sind. Vielmehr scheint Chlöisu Friedli auf seinen inneren Diaprojektor zu vertrauen, auf dessen Bilder und das warme Licht, das durch sie hindurchscheint. Er hält es da mit seinem grossen Idol, dem afroamerikanischen Pianisten und Texter Jimmy Yancey. Diese Qualität macht ihn in der Mundarttradition seiner Zeit einzigartig. Das Lied, das ohne Vorbereitung einfach aufhört – es ist schliesslich Chlöisu Friedlis ganz eigene traurige Geschichte.
«U wenn hüt eine wott usschlaafe, de muess er y d Waudou.» Aus der psychiatrischen Klinik Waldau berichtet lapidar der «Sünneli Blues», Friedli erzählt darin vom institutionalisierten Leerlauf, von den Widersprüchen, bis ihm schliesslich alle «der Buggu aberütsche» können: «Das isch ir Ordnig.» Dass er sein Publikum ganz ohne Bitterkeit über die eigentlich himmeltraurigsten seelischen Schmerzen schmunzeln lässt, ist das grosse Verdienst dieses Stücks. Dass er den sprachlichen Ton auch hier nicht wesentlich dramatischer ansetzt, als würde er von Schreibmaschinen erzählen. Das übersieht eine weitverbreitete und umso schmerzlicher verengte Deutung, die so tut, als sei Friedlis Lyrik zuallererst eine Lyrik der Depression und der gesellschaftlichen Ausgrenzung.
Eine einfach erzählte Geschichte. Bekannte beschreiben ihn als empfindsamen, gern etwas verschmitzten Typ, irgendwo zwischen Weltverlorenheit und Stammtisch, Schulterklopfen und Schulterzucken, zwischen Zimlisberg bei Rapperswil BE und Chicago, Illinois. Als einen von uns, den es an den Rand gespült hat, wie so manche vor ihm und viele danach. Der mediale Fetisch des pathologischen Genies verdeckt diesen Blick auf das Menschliche, im besten Sinn Prosaische an Friedlis Lyrik und bringt sie im Schluss um ihren Kern: den Blues. Dass die Bluesmusik immer schon der Selbstermächtigung jener gedient hat, die am Rand gelandet sind und für die sie einen Ort der Würde bereithält. Auch an dieser Würde nagt eine Lesart, die nach dem depressiven Künstler süchtig ist.
Emanzipation mit Blues
Höchste Zeit deshalb, Chlöisu Friedli neu zu entdecken und zu deuten. Und sich dabei zurückzubesinnen auf das emanzipatorische Moment der Bluesmusik, die weniger eine Tonleiter ist als eine menschliche Verortung der Zugehörigkeit, bei allen Abgründen.
Die Neuauflage der Liedersammlung «Wohäre geisch?» bietet dafür gute Gelegenheit. Auch dank einer wohlüberlegten Änderung gegenüber der Erstausgabe: Das gesprochene «Vo de Chüngle», das die Ursprünge von Friedlis Bühnenerzählton freilegt, ist nun erstmals dem Publikum erschlossen. Und dass wir im titelgebenden «Wohäre geisch?» ein unkonventionelles männliches Rollenbild entdecken könnten, vom schwachen Mann, der nach anleitender Erlösung von einem «Meitli» sucht, das ihn doch irgendwohin mitnehmen soll – es wäre noch mal eine ganz andere schöne Geschichte. Eine von vielen, die es noch zu erzählen gäbe über Werner Niklaus Friedli, der einfach Klavier spielen wollte und fast nebenher ein paar Lieder erfunden hat. «Aber es isch ja glych.»
Chlöisu Friedli: Wohäre geisch?. Fata Morgana Records. 2019


