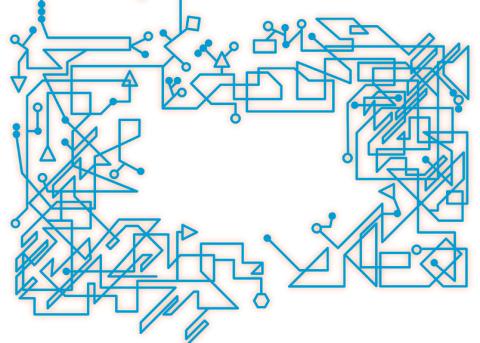Kriegsmaterial: «Das Erbe des Kalten Krieges holt uns immer wieder ein»
Die Historikerinnen Monika Dommann und Sibylle Marti haben ein Buch zur Schweizer Rüstungsproduktion im Kalten Krieg veröffentlicht. Ein Gespräch über das Geklüngel zwischen Militär und Industrie, den Mythos Neutralität und die Machenschaften der Crypto AG.

WOZ: Monika Dommann, Sibylle Marti, im Februar wurden die Cryptoleaks öffentlich. Die Geheimdienste CIA und BND haben die Zuger Firma Crypto betrieben, um manipulierte Chiffriergeräte zu vertreiben. Hat Sie die Enthüllung überrascht?
Sibylle Marti: Die Einflussnahme der CIA und des BND hat mich nicht überrascht, wohl aber ihr Ausmass. Dass die Schweiz das globale Zentrum der Spionagetätigkeit im Kalten Krieg war, hätte ich nicht erwartet. Wie wir in unserem Buch zeigen, war beim Rüstungsgüterhandel immer ein politischer und wirtschaftlicher Druck aus den USA zu spüren. Dass diese bei der Crypto so direkt eingriffen, ist aber schon erstaunlich.
Monika Dommann: Ich stamme aus dem Kanton Zug, die Väter vieler meiner Schulfreundinnen und -freunde haben bei der Crypto gearbeitet. Wir haben vage gewusst, dass die Firma in der Verschlüsselung tätig ist. Wir dachten, das habe etwas mit den Geheimschriften zu tun, die wir als Kinder ausprobiert haben. In den neunziger Jahren gab es dann erste Verdachtsmomente zur möglichen Einflussnahme der CIA. Die Dreistigkeit, dass diese Firma tatsächlich ausländischen Geheimdiensten gehörte, hat jetzt aber auch meine leicht paranoide Fantasie übertroffen.
Die Schweiz inszeniert sich bis heute gerne als neutraler Staat. Die Enthüllung passt schlecht in dieses Bild.
Marti: Man muss einmal klar festhalten: Die Schweiz war im Kalten Krieg Teil des Westens, politisch, wirtschaftlich und ein Stück weit auch militärisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte sie noch, Waren, Güter und Technologien in alle Richtungen zu exportieren, also auch in den Osten. Doch in dem Masse, wie sich der Kalte Krieg verschärfte und die USA und ihre Verbündeten begannen, eine Embargopolitik gegen die kommunistischen Staaten zu fahren, musste sich auch die Schweiz stückweise in diese Allianz einfügen. Bereits 1951 verpflichtete sie sich im geheimen Hotz-Linder-Abkommen, die Vorgaben der USA einzuhalten.
Was war der genaue Inhalt dieses Geheimabkommens?
Marti: Es handelte sich um ein Gentlemen’s Agreement, damit die Schweiz keine strategisch wichtigen Güter mehr in den Osten lieferte. Dazu zählten auch Güter aus dem Bereich der Atomtechnik. Die Unternehmen fügten sich, weil sie befürchteten, dass sie sonst vom Technologietransfer aus den USA abgeschnitten würden. Ich habe die Entwicklung von Geräten zur Messung von nuklearer Strahlung bei der Zuger Firma Landis und Gyr untersucht, die Ende der vierziger Jahre begann. Erst wollten die Behörden deren Ausfuhr locker handhaben, doch die USA bauten kontinuierlich Druck auf, bis die Schweiz kapitulieren musste. Eine sehr typische Verhaltensweise für die Schweiz im Kalten Krieg.
Dommann: Solche Konflikte kommen in allen Fallstudien in unserem Buch zum Ausdruck. Schweizer Firmen versuchten, aus der Neutralität Kapital zu schlagen, indem sie für den globalen Rüstungsmarkt produzierten. Doch sie wurden immer wieder zurückgebunden, oder sie fügten sich vorauseilend von sich aus.
Bei der Analyse der Rüstungsgeschäfte im Kalten Krieg wird gerne von einem «militärisch-industriellen Komplex» gesprochen. Können Sie diesen Begriff für die Nachgeborenen kurz erklären?
Dommann: Der Begriff wurde durch den US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower populär, der ihn 1961 in einer Rede an die Nation verwendete. Er bezeichnete damit die starke Vernetzung zwischen dem Militär und der Industrie, wie sie im Zweiten Weltkrieg entstanden war. Die ganze industrielle Produktion wurde damals auf das Militär umgepolt, später ging es weiter mit der Aufrüstung und dem Aufbau der Atomindustrie. In den achtziger Jahren wurde der «militärisch-industrielle Komplex» zu einem politischen Kampfbegriff, mit dem die Interessenkonstellationen zwischen dem Militär und der Industrie kritisch betrachtet wurden. Später fand das Konzept eine wissenschaftlich-analytische Anwendung. Zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien gingen der Frage nach, wie private Firmen über die Militärausgaben gefördert wurden.
Würden Sie auch für die Schweiz von einem militärisch-industriellen Komplex sprechen?
Marti: Der Begriff würde voraussetzen, dass die Rüstungsindustrie gesamtwirtschaftlich sehr bedeutend gewesen wäre. Sie machte in der Schweiz jedoch meist weniger als ein Prozent der Gesamtexporte aus. Trotzdem kann man aber auch in der Schweiz im Rüstungssektor eine starke personelle und institutionelle Verflechtung zwischen dem Militär, der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft feststellen. Legitimiert wurde diese enge Verflechtung damit, dass die Schweiz eine starke Rüstungsindustrie brauche, um die eigene Armee aufzurüsten. Dies führte oft zu einer Win-win-Situation, bei der sowohl das Militär wie auch die Industrie profitierten.

Dommann: Wobei es falsch wäre, sich ein harmonisches Verhältnis vorzustellen. Untersucht man die Rüstungsgeschichte, stösst man auf zahlreiche Widersprüche der Nachkriegsgesellschaft in der Schweiz. Die Gesellschaft ist einerseits global integriert, und der Generalstab bemüht sich um Hightechwaffen aus den USA oder Grossbritannien. Andererseits hängt man einem Autarkiegedanken an und will die Bewaffnung mit eigenen Rüstungsbetrieben sichern. Zwischen diesen beiden Vorstellungen kommt es immer wieder zu Konflikten.
Sie haben sich mit dem berühmten Igelpavillon an der Expo 1964 beschäftigt, in dem der Propagandafilm «Wehrhafte Schweiz» gezeigt wurde. Wie lassen sich daran diese Konflikte zeigen?
Dommann: Der Betonpavillon mit seinen Stacheln signalisierte Autarkie und Unabhängigkeit, der Film selbst wurde aber mit der neusten Technologie gedreht: mit einer 70-mm-Kamera, die von Spezialisten aus den USA bedient wurde. Die Schweizer Filmbranche, die sich im Zweiten Weltkrieg auf die Seite des Militärs geschlagen hatte, war darüber total entsetzt. An diesem Beispiel lässt sich auch zeigen, wie die Netzwerke zwischen Militär und Wirtschaft im Kleinen funktionierten. Der Werber Rudolf Farner, der Mitglied im Generalstab war, erhielt den Auftrag über seinen Duzfreund Gustav Däniker vom Militärdepartement. Im Archiv haben wir einen Brief gefunden, in dem sich Däniker total beleidigt zeigt, dass er zu wenig Geld für seine Mitarbeit am Film gekriegt hat, obwohl er Farner doch den Job zugeschoben hatte. Hier sehen wir das Geklüngel im Kleinen.
Wie wichtig war für dieses Geklüngel das Milizsystem?
Marti: Das Milizsystem ermöglichte die enge Verflechtung von Militär und Industrie überhaupt erst. Die einflussreichen Männer trafen sich in der Politik, in der Wirtschaft, im Militär. Jeder kannte jeden, zumindest um zwei Ecken. Die Männer in diesem Netzwerk teilten den schweizerischen Konsens im Kalten Krieg: Man war für eine starke Landesverteidigung, gab sich stramm antikommunistisch, wollte die Atomenergie fördern und hielt die politische Neutralität hoch. Erst mit der Zeit, mit dem sozialen Wandel ab den sechziger Jahren, verlor das Milizsystem an Bedeutung.
Können Sie an einem praktischen Beispiel zeigen, wie die Wirtschaft vom Milizsystem profitierte?
Marti: Die Strahlenmessgeräte, die ich untersucht habe, wurden zuerst von Ingenieuren bei Landis und Gyr entwickelt. Die beteiligten Ingenieure konnten ihre Geräte dann in der Armee testen. Diese Testergebnisse wiederum flossen in die Produktentwicklung von Landis und Gyr zurück. Das Wissen aus dem Militär gelangte so gratis in die Industrie. Das war nie umstritten, weil es letztlich um die Förderung von Schweizer Unternehmen ging. Auch andere Industriekonzerne wie die BBC profitierten auf diese Weise.
Mit der Dauer des Kalten Krieges nahm auch die Kritik an der Aufrüstung zu. Inwiefern haben die sozialen Bewegungen mit ihren Protesten die Rüstungsgeschäfte behindert?
Dommann: Sie spielten eine sehr wichtige Rolle. Ende der fünfziger Jahre haben die Initiativen gegen die atomare Bewaffnung das Thema überhaupt erst ins Gespräch gebracht. Die Initiativen wurden zwar letztlich abgelehnt, aber die Frage der Aufrüstung war nun politisiert. Dasselbe gilt für das Kriegsmaterialgesetz von 1973, das nur auf Druck der sozialen Bewegungen überhaupt zustande kam. Daraus kann die Linke auch etwas für unsere Gegenwart lernen, in der wieder eine starke Aufrüstung festzustellen ist: Widerstand lohnt sich.
Der Kalte Krieg ging erst vor dreissig Jahren zu Ende, liegt also zeitlich nahe an der Gegenwart. Gleichzeitig wirkt er mit seiner militärischen Paranoia auch seltsam fern. Teilen Sie diesen Eindruck?
Dommann: Für mich ist der Kalte Krieg das erste Zeitalter, das ich selbst erlebt habe. Ich war selbst an den Friedensdemos und teilte die Angst vor der atomaren Totalzerstörung. Als Historikerin und Zeitzeugin bin ich also in einer Doppelrolle, was die Forschung nicht einfach macht. Ich halte es aber grundsätzlich so, dass ich mir alle Zeiten möglichst fremd mache. Dann versuche ich, sie wie eine Ethnologin mit Fragen zu entschlüsseln. Was uns bei unserer Arbeit sicher klar wurde: Der Kalte Krieg lässt sich nicht allein als Militärgeschichte verstehen. Es braucht die Kombination verschiedener Ansätze, von Wirtschafts-, Politik- und Kulturgeschichte.
Marti: Weil der Kalte Krieg noch längst nicht fertig erforscht ist, haben wir auch noch gar nicht verstanden, wie viele Institutionen und Lebensläufe bis heute noch davon geprägt sind. Das vielfältige Erbe des Kalten Krieges holt uns deshalb immer wieder ein.
Um in diesem Sinn nochmals auf die Cryptoleaks zurückzukommen: Was würde Sie als Historikerinnen bei der Erforschung dieser Geschichte interessieren?
Dommann: Zuerst stellt sich mir die Frage nach dem Zeitpunkt dieser Enthüllung: Warum wurde der Bericht jetzt publiziert? Und weil es sich dabei um eine Selbsthistorisierung der Geheimdienste handelt, mit dem sie die Deutungshoheit behalten wollen: Was hat sich an der geopolitischen Situation geändert, dass ein solches Leak plötzlich in ihrem Interesse ist? Weiter könnte man die Rolle der Schweizer Technologiepolitik erforschen und der Frage nachgehen, wozu bestimmte Produkte verwendet werden. Was als Kriegsmaterial gilt, ist schliesslich immer Definitionssache.
Marti: Zudem könnte die Geschichte der Crypto den Anlass bieten, endlich mit alten Mythen aufzuräumen und die Geschichte der Schweizer Neutralität in ihren Widersprüchen zu erzählen. Die Crypto war nicht möglich, obwohl die Schweiz neutral war – sondern gerade, weil sie neutral war.

Monika Dommann (53) ist Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Sibylle Marti (40) ist Lehrbeauftragte an der Fernuniversität in Hagen und arbeitet als SNF-Stipendiatin an einem Habilitationsprojekt. Zusammen haben sie diesen Frühling im Schwabe-Verlag den Band «Kriegsmaterial im Kalten Krieg. Rüstungsgüter in der Schweiz zwischen Militär, Industrie, Politik und Öffentlichkeit» herausgegeben.