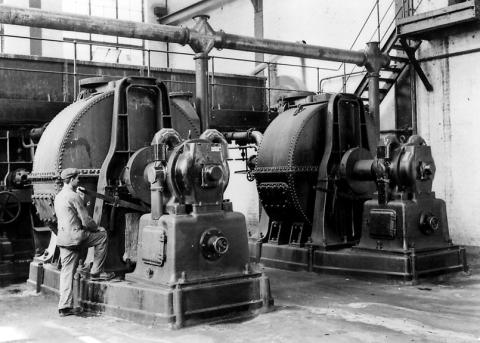Die Welt in Krisen: Im Schatten der Hydra
Während zur Eindämmung von Covid-19 so gut wie jedes Mittel recht war, ist in Bezug auf die Klimakrise seit vier Jahrzehnten so gut wie nichts geschehen. Ein Essay über eine strukturelle Schizophrenie.
Nur gut zehn Jahre nach dem Finanzcrash von 2008 hat die Coronakrise erneut zu einer gewaltigen Erschütterung der globalen Ökonomie geführt, mit einer Rezession, die sogar gravierender ausfallen könnte als die der Weltwirtschaftskrise von 1929. Die langfristigen politischen Konsequenzen sind noch gar nicht absehbar. Und obwohl die Ursachen dieser Krisen sehr verschieden sind, ist ihnen doch gemeinsam, dass sie die Verwundbarkeit und zunehmende Instabilität der gegenwärtigen Weltordnung zeigen.
Der Zusammenhang zwischen Pandemien und der rasant voranschreitenden Zerstörung der Biosphäre ist dabei ein zentraler Aspekt: Bereits seit den siebziger Jahren sind immer häufiger neue und zum Teil tödliche Erreger aufgetreten, die sich dank eines globalisierten Güter- und Personenverkehrs rasch um die Erde verbreiten. Dazu gehören HIV, die Ebola- und die Zikaviren, die Erreger von Vogel- und Schweinegrippen sowie verschiedene Typen von Coronaviren wie das Sars-Virus und Sars-CoV-2. Etwa 75 Prozent dieser neuen Krankheiten stammen von Tieren – etwa zwei Drittel von wild lebenden Tieren und ein Drittel von Tieren aus der Massentierhaltung.
Wie ein schlafender Drache
Bereits mit Beginn der Sesshaftwerdung und vor allem mit der Entstehung der ersten städtischen Zivilisationen vor 5000 Jahren hat die Tierhaltung der Menschheit eine Reihe von neuen Krankheiten beschert – darunter Masern und Tuberkulose (von Kühen), Keuchhusten (von Schweinen) und Influenza (von Enten). Einen Teil dieser Krankheiten konnten Impfungen und Antibiotika im Lauf des 20. Jahrhunderts eindämmen. Doch mit der Ausbreitung der industriellen Landwirtschaft und dem Einpferchen von Milliarden von Nutztieren auf engstem Raum hat sich eine Brutstätte für Krankheiten entwickelt, die sich zunehmend jeder Beherrschung entziehen.
Noch viel häufiger als von Nutztieren gehen moderne Epidemien von wilden Tieren aus. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass ihre Lebensräume immer weiter zerstört werden, zum Beispiel durch die Abholzung von Wäldern. Dieser Prozess begann bereits in der Kolonialzeit: Ende des 19. Jahrhunderts etwa liessen die belgischen InvasorInnen im Kongo Wälder roden, um die Kupfer- und die Kautschukvorkommen des Landes auszubeuten. In der Folge drangen aus ihrem Lebensraum vertriebene Makaken in menschliche Siedlungen ein, wo die Affenart ein bestimmtes Lentivirus verbreitete, das sich langsam an den menschlichen Körper anpasste. Heute kennen wir es unter dem Namen HIV.
So zeigen sich Pandemien nicht zuletzt als eine Konsequenz des kolonialen Herrschaftsprojekts der Neuzeit. Der Versuch, die Natur menschlicher Kontrolle und den gesamten Planeten den Zwecken der endlosen Geldvermehrung zu unterwerfen, bringt unvorhergesehene Reaktionen hervor, die auf das System zurückschlagen und es letztlich sogar zu Fall bringen können. Pandemien sind ein Beispiel für die Kurzsichtigkeit eines technokratischen Denkens, das auf dem Irrtum beruht, die lebendige Welt lasse sich durch lineare Ursache-Wirkungs-Ketten kontrollieren.
Doch natürliche Systeme können nicht wie Maschinen befehligt und dauerhaft kontrolliert werden. Sie reagieren wie die Hydra in der Herkules-Sage: Für jeden abgeschlagenen Kopf wachsen zwei andere nach. Alles, was lebt, beruht auf nichtlinearen Kreislaufprozessen, bei denen jede Wirkung zugleich wieder Ursache von unzähligen weiteren Prozessen ist, die meist unabsehbar sind. Jeder Versuch, in einem hyperkomplexen lebenden System wie der Biosphäre auf Dauer einseitig bestimmte Erträge zu maximieren, führt unweigerlich zu einer Zunahme von fatalen «Nebenwirkungen», darunter Klimachaos, Pandemien, Artensterben und Bodendegradation. Langfristig werden durch diese ökologischen Kettenreaktionen auch die wirtschaftlichen Erträge zusammenbrechen, zunächst vorübergehend wie in der Coronakrise, schliesslich aber, wenn sich der Takt der Krisen weiter verdichtet, auf Dauer. Es ist das typische Schicksal scheiternder Zivilisationen.
Der Begriff «ökologische Grenzen» ist in diesem Zusammenhang irreführend, denn er suggeriert, dass man irgendwann wie eine wachsende Pflanze in einem Zimmer an eine Decke stossen würde, die das Wachstum begrenzt. Doch die «Grenzen des Wachstums», mit denen wir es zu tun haben, sind von vollkommen anderer Art. Sie gleichen eher einem tief schlafenden Drachen, dem man mit Lärm zu Leibe rückt. Bis zu einem bestimmten Punkt wird nichts passieren ausser vielleicht ein verschlafenes Knurren oder Zucken. Doch wenn ein bestimmter Kipppunkt überschritten ist und der Drache erwacht, gibt es kein Zurück mehr zum vorherigen Zustand.
Viele dieser Kipppunkte werden derzeit – von der breiten Öffentlichkeit bestenfalls am Rand bemerkt – überschritten und setzen langfristige Verwerfungen in Gang, die um viele Grössenordnungen gravierender sind als die Coronapandemie. Das Abschmelzen des westantarktischen Eisschilds etwa, das allein einen langfristigen Meeresspiegelanstieg um etwa sieben Meter verursachen wird, ist möglicherweise schon unumkehrbar. Der Amazonasregenwald steht durch Abholzung, Brände und globale Erwärmung vor dem Kollaps und kann sich rasch von einem der wichtigsten CO2-Speicher der Erde in eine gigantische Emissionsquelle verwandeln. In den nördlichen Polarregionen schmelzen die Permafrostböden und setzen immer mehr des extrem starken Treibhausgases Methan frei. Ab einem bestimmten Punkt wird dieser Prozess unumkehrbar sein.
Panik, Ad-hoc-Aktionen, Ignoranz
Die Coronakrise hat eine strukturelle Schizophrenie in unserem ökonomischen und politischen System offenbart: Während zur Eindämmung von Covid-19 so gut wie jedes Mittel recht war – sogar eine vorübergehende Lahmlegung der Wirtschaft –, ist in Bezug auf die Klimakrise seit vier Jahrzehnten so gut wie nichts geschehen. Weder liegen verbindliche Reduktionsziele vor, die auch nur im Entferntesten mit dem Zwei-Grad-Ziel vereinbar sind, noch gibt es einen ernst zu nehmenden Plan für einen schnellen Umbau der Infrastrukturen und der Ökonomie.
Und das, obwohl es einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, dass fortschreitendes Klimachaos unvergleichlich viel gefährlicher ist als das Coronavirus. Die politischen Systeme reagieren auf kurzfristige Krisen mit Panik und Ad-hoc-Massnahmen, langfristige Verwerfungen dagegen werden – von gelegentlichen Sonntagsreden abgesehen – de facto ignoriert. Die viel beschworene Wissensgesellschaft erweist sich an dieser Stelle als Schimäre: Denn gerade dort, wo prognostisches Wissen am relevantesten für das Überleben der Menschheit ist, nämlich in der Klimafrage, bleibt es politisch folgenlos.
Das liegt zum einen daran, dass der Biosphärenkollaps ein langfristiges Problem ist, während unsere politischen Systeme kurzfristig ausgerichtet sind. Wenn ein Drittel von Bangladesch in einigen Jahrzehnten überschwemmt sein wird, wenn grosse Teile des Nahen und des Mittleren Ostens und Afrikas durch Überhitzung nicht mehr bewohnbar sein werden und wenn auch die europäischen Wälder vollends vertrocknen, dann sind fast alle PolitikerInnen, die heute die Weichen stellen (oder eben nicht stellen), längst nicht mehr im Amt und die meisten schon tot.
Zum anderen sind die Eingriffe in die Wirtschaft während der Coronakrise zeitlich begrenzt, und grosse Kapitalgesellschaften wie Autohersteller und Fluggesellschaften werden mit grosszügigen Subventionen, Abwrackprämien und Kurzarbeitsgeldern gerettet. Einige Konzerne, wie etwa Amazon, haben sogar massiv von der Coronakrise profitiert, weil ihre Konkurrenz vom Markt gefegt wurde. Das Ergebnis ist das, was ÖkonomInnen euphemistisch eine «Marktbereinigung» nennen: Die monopolistischen oder oligopolistischen Strukturen werden weiter verfestigt. Vor diesem Hintergrund ist klar, warum sich der Widerstand von Wirtschaftslobbys gegen den Coronashutdown trotz gelegentlicher Einsprüche in Grenzen gehalten hat.
Ganz anders sieht es dagegen mit der Krise der globalen lebenserhaltenden Systeme aus. Denn sie zwingt uns, wenn wir sie ernst nehmen, dazu, die Grundpfeiler unseres Wirtschaftssystems infrage zu stellen: die endlose Expansion und Geldvermehrung. Das betrifft auch die tieferen Ursachen von Pandemien: Um ihre Entstehung und ihre Verbreitung zukünftig zu verhindern, müssten die wirtschaftliche Expansion und die daraus folgende Zerstörung von Naturräumen gestoppt werden.
In Krisenzeiten tun sich immer wieder plötzlich unerwartete Abzweigungen auf, an denen Gesellschaften unterschiedliche Pfade einschlagen können. In der gegenwärtigen Krise etwa gibt es durchaus die Möglichkeit, die billionenschweren Rettungsgelder nicht wieder in destruktive Branchen wie die Flugzeug- und die Autoindustrie zu kanalisieren, sondern in zukunftsfähige Bereiche wie den öffentlichen Transport und eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung für alle.
Die Chancen für den Umbau
Die Coronakrise hat gezeigt, dass Staaten, wenn sie wollen, durchaus handlungsfähig sind und sehr schnell weitreichende gesellschaftliche Entscheidungen treffen können, einschliesslich massiver Interventionen in die Wirtschaft und sogar in die Eigentumsstrukturen. Jahrzehntelang wurden Forderungen nach wirkungsvollen Klimaschutzmassnahmen mit dem Verweis abgeschmettert, dass man nicht in die «freien Marktkräfte» eingreifen könne oder dürfe. Doch angesichts des Virus war plötzlich fast alles möglich. Der Flugverkehr wurde ganz einfach per Dekret stillgelegt. Geld, das für einen sozial-ökologischen Umbau angeblich nie da war, floss auf einmal in beinahe unbegrenzten Mengen. Der Mythos des schwachen, handlungsunfähigen Staates ist endgültig zusammengebrochen, und es ist eine der dringlichsten Aufgaben der Zivilgesellschaft, diese Erkenntnis in politisches Handeln umzumünzen und ein umfassendes Umbauprogramm zu entwickeln.
Pandemien, Finanzkrisen und vor allem der Zusammenbruch von lebenserhaltenden Ökosystemen werden die Ökonomien in den reichen Ländern des Nordens langfristig unweigerlich zu einer Kontraktion zwingen. Die Coronakrise könnte eine wichtige Lernerfahrung sein, um mit schrumpfenden Ökonomien umzugehen: Wie müssen Institutionen umgebaut werden, wie müssen Reichtum, Einkommen und Arbeit umverteilt werden, um mit stagnierender oder reduzierter Wirtschaftsleistung ein würdiges Leben für alle zu ermöglichen? Was ist notwendig, um Resilienz zu entwickeln und die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen aus den globalen Kapitalverwertungsketten herauszulösen? Die Notwendigkeit, diese Fragen zu stellen und in der Praxis zu erproben, ist durch die rasche Folge von wirtschaftlichen Zusammenbrüchen seit 2008 (Finanzkrise, «Eurokrise», Coronakrise) und die sich zuspitzenden ökologischen Katastrophen immer mehr Menschen unmissverständlich klar geworden.
Das Krisenpanoptikum, das sich global entfaltet, kann nicht mehr, wie bisher in den meisten westlichen Ländern, bequem von der Couch aus am Fernseher verfolgt werden, sondern bricht in unsere Realität ein.
Fabian Scheidler ist Autor, Dramaturg und Mitbegründer des unabhängigen Fernsehmagazins «Kontext TV». Von Scheidler erschienen sind unter anderem die Bücher «Das Ende der Megamaschine: Geschichte einer scheiternden Zivilisation» (2015), «Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen» (2017) und «Die volle und die leere Welt» (2019).