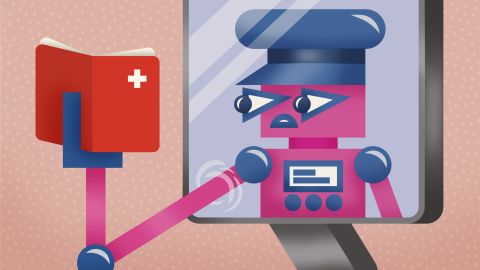Elektronische ID: Die Schweiz will auch digital ein Sonderfall sein
Mit dem E-ID-Gesetz sollen in der Schweiz Private das Zepter bei den elektronischen Identitäten übernehmen. Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt: Die Schweizer Lösung ist eigenwillig und gegen den europäischen Trend.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter findet, dass private Anbieter bei der E-ID die Führung übernehmen sollen. «Wenn der Staat das machen würde, müsste er sich für eine bestimmte Technologie entscheiden, die in kurzer Zeit vielleicht bereits überholt wäre», sagte sie kürzlich der «Coopzeitung». André Golliez von der Swiss Data Alliance sieht es ähnlich: «Man hat in anderen Ländern mit solchen gemischtwirtschaftlichen Lösungen einfach gute Erfahrungen gemacht», sagte der Präsident des wirtschaftsnahen Thinkthanks gegenüber Swissinfo.
Ein Blick in europäische Länder zeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, wie Keller-Sutter und Golliez es darstellen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zählte rund hundert E-ID-Angebote. Manche basieren auf einer vom Staat ausgestellten Identitätskarte, andere befinden sich auf dem Smartphone. Viele erlauben digitale Behördengänge, einige gar die elektronische Unterschrift auf Dokumenten. Federführend sind mal Banken, mal privatwirtschaftliche Konsortien – und nicht zuletzt der Staat. In fast allen von der Studie erfassten Ländern gibt es mittlerweile staatlich ausgestellte E-IDs.
Über siebzig Prozent mit E-IDs
Von den BefürworterInnen der E-ID-Gesetze wird gerne das «skandinavische Modell» als Vorbild herangezogen. Hier entwickelten führende Grossbanken verschiedene nationale E-ID-Systeme, die sich rasch in der Gesellschaft etablierten. Gemäss einer Studie der Beratungsfirma Arkwright von 2019 besitzen in Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark weit über siebzig Prozent der Bevölkerung E-IDs. In Dänemark nutzt fast die ganze Bevölkerung die Nem-ID der Banken, mit der sich E-Banking und digitale Behördengänge abwickeln lassen. Allerdings gibt es hier auch seit 2012 die gesetzliche Vorgabe, dass die gesamte behördliche Kommunikation digital abgewickelt werden muss. Auch in Norwegen funktioniert ohne die Bank-ID in der digitalen Welt kaum etwas. Die von den Banken ausgestellte E-ID dient als Zugang zu staatlichen Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, Finanzen und Soziales. Dass dafür ein Bankkonto bei einer Grossbank nötig ist, stört die Mehrheit der NutzerInnen offenbar nicht.
Doch anders als in der Schweiz überlassen in Skandinavien die Regierungen das Feld keineswegs den privaten Anbietern. So wird in Dänemark die Herausgabe der E-ID staatlich ausgeschrieben und genehmigt. Und während in Finnland bislang mit der E-ID Tupas eine Bankenlösung dominiert, etabliert sich nun mit der Fine-ID auch dort eine staatliche Alternative. In Schweden ist der von der Steuerbehörde ausgestellte AB Svenska Pass gar die einzige E-ID mit der höchsten Sicherheits- und Vertrauensstufe.
Noch stärker ist der Staat im digitalen Vorzeigeland Estland eingebunden. Nur zwei Prozent der Bevölkerung besitzen dort keine «ID-kaart». Diese gibt automatisch Zugriff auf die diversen staatlichen Digitalleistungen. So nutzen zwei Drittel die E-ID regelmässig, um sich im Internet zu identifizieren, ihre Steuererklärungen einzureichen oder abzustimmen. Genutzt werden kann diese E-ID auch mit dem Smartphone, und auch wegen einer umfassenden Digitalisierung der Behörden ist sie ein Erfolgsmodell.
Schwedisches Konto mit deutscher ID
Auch in Deutschland gibt es seit 2010 mit dem Personalausweis eine Identitätskarte mit E-ID-Funktion. Nur nutzt diese Funktion kaum jemand. Neben der Skepsis beim Datenschutz sind vor allem die fehlenden Nutzungsangebote ausschlaggebend. Das soll sich nun ändern. Mit dem Projekt Optimos 2.0 fördert das Bundeswirtschaftsministerium die Bemühung, die E-ID vom Personalausweis mit einer App aufs Smartphone zu bringen und damit die Nutzung zu vereinfachen. Für die nötige Sicherheit sollen sogenannte «sichere Elemente» in der Hardware verwendet werden, um die sensiblen Daten dezentral und verschlüsselt auf den Geräten zu speichern. Eine Idee, die auch den GegnerInnen des E-ID-Gesetzes gefällt. Denn je weniger Daten zentral gespeichert und verarbeitet werden, desto kleiner sind die Sicherheitsrisiken und die Verführungen der Kommerzialisierung. Noch ist das deutsche E-ID-Update nicht einsatzbereit, es soll aber dieses Jahr lanciert werden.
Derweil ist Belgien bereits einen Schritt weiter und hat im vergangenen Jahr mit der mobilen E-ID Itsme bereits über zwei Millionen NutzerInnen erreicht. Wie bei der neuen deutschen Variante baut sie auf der staatlichen Identitätskarte auf, nutzt jedoch bisher eine weniger sichere App zur Identifikation im digitalen Raum. Die E-ID Itsme wird auch in Luxemburg eingesetzt und soll demnächst auch in den Niederlanden verfügbar sein.
All diese Entwicklungen werden durch die europäische Eidas-Verordnung gesteuert. Diese regelt die elektronische Identifizierung im europäischen Binnenmarkt und sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Systeme miteinander kommunizieren können und einheitlichen Standards genügen. So soll eine deutsche E-ID auch verwendet werden können, um in Portugal Steuern zu zahlen oder in Schweden ein Bankkonto zu eröffnen. Nun steht die Revision der Eidas an. Dabei liess EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende Januar verkünden: «Die EU-Kommission wird bald eine sichere europäische E-ID vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die jeder Bürger überall in Europa nutzen kann.» Dabei sollen die NutzerInnen selber bestimmen können, «welche Daten und wie diese Daten verwendet werden», so von der Leyen.
Wie in Estland, Deutschland oder Belgien gewinnen staatliche E-IDs auf Basis der Personalausweise an Bedeutung. Denn sie ermöglichen den BürgerInnen einen einfachen Zugang zu den digitalen staatlichen Dienstleistungen.
Passt es zur europäischen Lösung?
Auch in der Schweiz wäre eine solche Lösung möglich. Das beweist eine kürzlich veröffentlichte Studie der Berner Fachhochschule aus dem Jahr 2013. Sie sollte für das Bundesamt für Polizei die technische Machbarkeit einer auf dem biometrischen Pass aufbauenden E-ID prüfen und wurde bis jetzt unter Verschluss gehalten. Obwohl die ForscherInnen einen funktionierenden Prototyp bauten, wurde die Variante verworfen – politisch war sie nach der denkbar knappen Annahme des biometrischen Passes 2009 zu brisant.
Stellt sich die Frage, ob der nun eingeschlagene Weg über private E-ID-Anbieter mit dem europäischen Kurs vereinbar ist. Der Bundesrat glaubt, dass das Gesetz mit der Eidas-Verordnung grundsätzlich kompatibel sei. Das mag sein. Doch ob die Schweizer Lösung auch mit der revidierten Eidas vereinbar ist, ist alles andere als klar. Mindestens zwei Gründe sprechen dagegen: Zum einen sind fast alle E-IDs, die der aktuell gültigen Verordnung entsprechen, staatliche Lösungen. Zum anderen bietet der Staat in Europa den für das System nötigen Vertrauensanker. Er soll für die E-IDs auch haften. So etwas ist im Schweizer Gesetz nicht vorgesehen und müsste erst geändert werden.
Statt den Anschluss zu verpassen, sollte die Schweiz also eher darauf achten, nicht auf den falschen Zug aufzuspringen.