Auf allen Kanälen: Selbst ist das Amt
Das Staatssekretariat für Migration produziert neuerdings einen Podcast. «Willkommen im Bundesasylzentrum» soll einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.
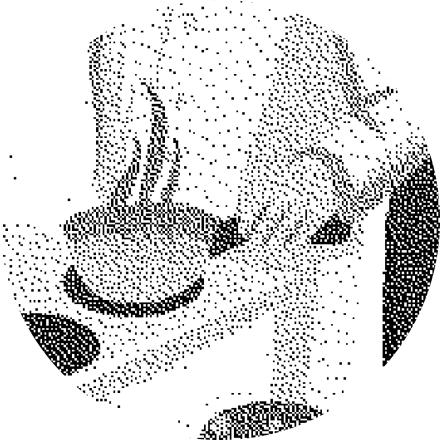
Es gebe Asylsuchende, die ihn als «Richter» bezeichneten. Das erzählt ein Fachspezialist Asyl, der unter dem Pseudonym Andreas Pfister in der ersten Folge von «Willkommen im Bundesasylzentrum» zu Gast ist. Pfister findet es «lustig», dass sie ihn so nennen, ja sogar «absurd». Denn eigentlich, so der Mann, der dafür verantwortlich ist, Asylentscheide zu fällen, sei er ja einfach Sachbearbeiter. Wobei wir im neuen Podcast des Staatssekretariats für Migration (SEM) erfahren, dass Andreas Pfister eigentlich vor allem eines ist: Mensch.
Und hier, auf der Couch des Gastgebers Erik Thurnherr, der für die Kommunikationsabteilung der Migrationsbehörde arbeitet, darf er das auch sein. Er darf erzählen von den Schwierigkeiten seiner Arbeit, von den Sorgen, die ihn vor dem Einschlafen plagen, und von den Freuden des Alltags – er möge es, über das Schicksal einer anderen Person zu entscheiden, sagt er.
Irgendwie kritisch
Sechs Folgen des Podcasts über die Schweizer Bundesasylzentren (BAZ) sind bislang erschienen. Gemäss Medienmagazin «Persönlich» hatte das SEM bei der Lancierung angekündigt, damit «ein facettenreiches Bild» einer Institution, die medial sehr präsent sei, deren Funktionsweise aber dennoch die wenigsten kennen würden, vermitteln zu wollen.
Wie Pfister zu Gast im Studio sind in anderen Folgen etwa eine Dolmetscherin, eine Seelsorgerin und eine Sozialpädagogin. Erik Thurnherr weiss gut, wie man so ein Interview führen muss. Er ist gelernter Journalist, arbeitete früher unter anderem für das Schweizer Fernsehen und für 3sat. Man merkt ihm an, dass er Erfahrung mitbringt: Er stellt interessierte Fragen, bemüht sich darum, dass seine Gäste sich auch zu kontroverseren Themen äussern. Etwa dann, wenn er die Dolmetscherin fragt, ob sie wirklich neutral bleiben könne, wenn sie Anhörungen übersetze. Oder wenn er den Asylentscheider nach seinem Verhältnis zu den Rechtsvertreter:innen der Asylsuchenden befragt.
Was zunächst als Stärke des Podcasts daherkommen mag, ist sein grösstes Problem: dass er irgendwie kritisch wirken will, das aber nicht einlösen kann. Andreas Pfister, der Asylentscheide fällt, erzählt zwar von seinen bisweilen heftigen Diskussionen mit den Rechtsvertreter:innen. Die Medienberichte, wonach in manchen Regionen diese Rechtsvertreter:innen derart überlastet sind, dass sie ihre Klient:innen gar nicht mehr an die Anhörungen begleiten können, bleiben aber unerwähnt.
Die reformierte Seelsorgerin erzählt, dass es ihr wichtig ist, nicht vom SEM bezahlt zu werden. Dass der Bundesrat im Frühling bekannt gemacht hat, Seelsorger:innen direkt anstellen und mit der «Konfliktprävention» beauftragen zu wollen – nicht der Rede wert.
Die Sozialpädagogin erzählt von der Schwierigkeit, die im Studium erlernten Konzepte im Alltag umsetzen zu können. Aber wäre es nicht auch relevant, darüber zu reden, dass ein Grossteil der Betreuer:innen in Bundesasylzentren in diesem Bereich kaum ausgebildet sind?
In «Willkommen im Bundesasylzentrum» entsteht durchwegs der Eindruck, man höre sich hier ein journalistisches Format an. Der Unterschied zwischen Journalist:innen und der Kommunikationsabteilung der Behörde besteht allerdings auch darin, dass der Zutritt zu den gefängnisähnlichen Bundesasylzentren Ersteren weitgehend verwehrt bleibt.
PR, die sich einmischt
Der Podcast des SEM ist kein singuläres Phänomen. Medienstellen entdecken die digitalen Kanäle für sich, um ihren eigenen Content unter die Leute zu bringen. Die deutsche Bundesregierung beispielsweise hat laut «Spiegel» in den vergangenen Jahren Hunderttausende Franken für PR-Podcasts ausgegeben.
Auch die staatlichen Schweizer Medienstellen gehen vermehrt in die kommunikative Offensive. So ist zuletzt etwa das Finanzdepartement damit aufgefallen, sich mithilfe von «Richtigstellungen» in mediale Debatten einzumischen – jedem Departement seine eigene kleine Redaktion. Wobei diesen finanzielle Mittel zur Verfügung stehen dürften, von denen so manche:r echte Journalist:in nur träumen kann.
Neu ist das, was als innovatives Kommunikationskonzept daherkommen mag, freilich nicht. Ein «facettenreiches Bild des Alltags in den Schweizer Bundesasylzentren»? Früher nannten wir das Propaganda.


