Essay: Geht jetzt die Welt unter?
Fast alle haben jetzt Angst vor der Zukunft. Was hilft? Eine Erkundung, die zurück ins Jahr 1986 führt, in einen Kunstworkshop und zu Menschen, die einen aktiven Umgang mit ihrer Angst suchen.
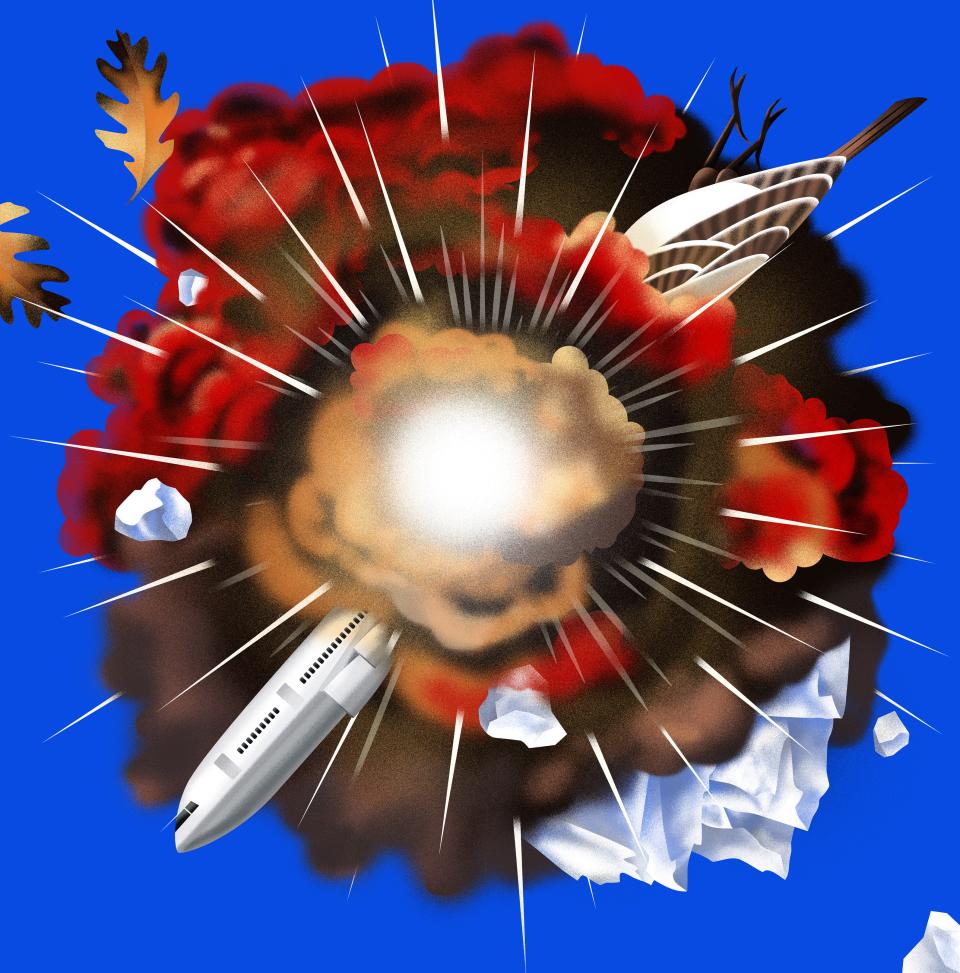
Heute Abend sollen wir in die Zukunft reisen. Ein Beamer projiziert dieses ikonische Bild an die Wand: die Erde, gesehen aus dem All. «Wie wollt ihr in zwanzig Jahren leben?», fragt eine der beiden Workshopleiterinnen. Hier gehe es darum, Antworten auf diese Frage zu finden. Damit aus «climate angst» vielleicht «climate happiness» werden könne.
«Climate happiness»? Ich kann das nicht ernst nehmen. Die naturwissenschaftlichen Fakten sind klar und düster. Wie soll eine Veränderung in meinem Kopf daran etwas ändern? Und was soll das bedeuten, wir seien hier in einem «process of exploring potentiality spaces»?
Rund zwanzig Menschen sind an den Workshop gekommen. Eine Kuratorin aus Taiwan. Ein deutscher Wissenschaftshistoriker. Ein Choreograf und mehrere Künstler aus Indien. Ein Stadtplaner der Zürcher Hochschule der Künste. Eine Schweizerin, die sagt, sie beschäftige sich mit «business and human rights». Die meisten haben in irgendeiner Form mit Kunst zu tun, wir sind hier ja auch im Raum für «Awareness in Art» im Zürcher Löwenbräu-Areal. Wir sprechen englisch mit diversen Akzenten. Die Workshopleiterinnen haben unsere Namen auf Haselnussstrauchblätter geschrieben, die intensiv nach Gerbstoff riechen.
Wir stehen auf, positionieren uns im Raum, um zwei Fragen zu beantworten: Wie positiv sehe ich die Zukunft in zehn Jahren? Und wie stark kann ich sie beeinflussen? Fast alle sind optimistischer als ich. Sie suche nach Möglichkeiten, politisch zu handeln, die sie nicht komplett überforderten, sagt die Frau, die am nächsten bei mir steht. Das kenne ich.
Der Sommer 2018 war seltsam. Das Gras wurde gelb, dann zerfiel es zu Staub. Viele Bäume verloren ihre Blätter schon im August. Im Rhein suchten die Fische die kältesten Winkel bei den Bachmündungen oder starben. «Geht jetzt die Welt unter?», fragte ein WOZ-Kollege am Telefon. Ironie war das nicht mehr.
Das Jahr, in dem die Ökoangst mit voller Wucht zurückkam, irritierte mich. Als würden fremde Leute auf der Strasse aus meinem Tagebuch vorlesen. Plötzlich hatten fast alle um mich herum Angst, nicht nur ich. Plötzlich wurde es möglich, darüber zu diskutieren, ob Ferienreisen mit dem Flugzeug unmoralisch sind. Plötzlich gingen richtig viele Leute für das Klima auf die Strasse.
Ich kenne diese Angst schon lange. Seit 1986. Im Januar explodierte damals die Raumfähre Challenger kurz nach dem Start, alle sieben Astronaut:innen starben. Im April explodierte im ukrainischen Tschernobyl ein Atomreaktor, eine radioaktive Wolke zog über Europa. Im November brannte auf dem Gelände der Chemiefirma Sandoz in Schweizerhalle bei Basel eine Lagerhalle ab, mit dem Löschwasser flossen dreissig Tonnen Pestizide in den Rhein und töteten die Fische bis hinunter nach Mannheim. Der technische Fortschritt schien endgültig zum Fluch geworden. In Basel – in Basel! – demonstrierten Tausende gegen die Chemie- und Pharmaindustrie.
1986 kam ich in die erste Klasse. Zu Hause lief das Radio dauernd, Nachrichten, Hörspiele, Hintergrundsendungen. Die Erwachsenen hatten Angst, ich hörte es ihnen an. «Der Weltuntergang, meine Damen und Herren, hat schon begonnen», sagte Franz Hohler am Radio. Viele gingen davon aus, dass es in zwanzig, dreissig Jahren keinen Wald mehr geben würde. Auch im «Silva-Familienbuch Wald» in meinem Kinderzimmer stand das so. Also hatten auch die wilden Wälder im Wallis keine Zukunft, in denen ich am liebsten für immer geblieben wäre. In den Ferien, finanziert von der Dieselmotorenfirma Sulzer.
Ein Vierteljahrhundert lang, vom «Stummen Frühling» der US-Biologin Rachel Carson, die 1962 vor dem Aussterben der Vögel warnte, bis in die achtziger Jahre, vermischte sich die Angst vor einem dritten Weltkrieg mit der Angst vor der ökologischen Katastrophe. Die Atombombe, die beides zugleich symbolisierte, stand als dunkler Hintergrund vor den Aufbrüchen der Hippies und der Neuen Linken. In meiner Kindheit war die Kriegsangst, Michail Gorbatschow sei Dank, in den Hintergrund getreten. Mit dem Mauerfall 1989 und dem Ende der Sowjetunion 1991 schien ein neues Zeitalter des kapitalistischen Friedens anzubrechen.
Zuerst wurde die Schweiz aber noch einmal durchgeschüttelt. Man stritt heftig für oder gegen das Militär; offene Drogenszenen mit ihrer Beschaffungskriminalität prägten die Städte; und Michael E. Dreher, der Chefrabauke der Autopartei, schimpfte über die «Waldsterbelüge» und wollte Linke und Grüne «an die Wand nageln und mit dem Flammenwerfer drüber». Dann stagnierte auch noch die Wirtschaft. Eine Zeit, mindestens so polarisiert wie heute.
Dann verschwand das alles.
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurde die Schweiz allmählich zu diesem seltsam entrückten Expatparadies mit schönen Bergen im Hintergrund. Heroin out, Kokain in. Die Krawalle hin und wieder, am 1. Mai oder am Wef, beschäftigten nur kleine Minderheiten und schienen den Eindruck des Unwirklichen noch zu verstärken. Nach der Kriegsangst verschwand auch die Ökoangst: Sie wurde ausgelagert. Mit der Globalisierung verliessen die letzten dreckigen Industriezweige die Schweiz. Die Zersiedlung ging zwar weiter, die Autos wurden grösser, das Artensterben schritt still voran. Aber die Luft wurde sauberer, die Flüsse waren es schon länger, der quälende Sommersmog nahm ab. Die materiellen Grundlagen des Überflusses waren endgültig unsichtbar geworden.
Und die junge Generation hatte anderes zu tun, als darüber nachzudenken. «‹Ernsthaftigkeit› war für die Gen X die höchste Beleidigung. Emotionen, Aufrichtigkeit und Sentimentalität waren tabu, und die Idee einer moralischen Haltung war einfach nur peinlich.» Ausgerechnet ein «Tages-Anzeiger»-Artikel über den 50. Geburtstag von Kate Moss fasst sehr schön zusammen, wie die Generation der zwischen 1965 und 1980 Geborenen mehrheitlich drauf war. Sie vergass die verseuchten Flüsse, die waren jetzt in China. Sie vergass die Grenzen des Wachstums. Sie vergass, dass es Atombomben gibt.
Ich wäre gern ein Millennial, Teil der Generation Y, da ist die Frage schon im Namen enthalten. Aber ich gehöre noch ganz knapp zu dieser blöden Generation X. Und ich fühlte mich darin immer wie ein Alien. Weil ich 1986 nicht vergessen konnte?
Der Workshop findet im September 2023 statt. Geleitet wird er von der Künstlerin Sonja Schenkel, die die «Bibliothek zur glücklichen Zukunft» kuratiert, und Eva-Maria Spreitzer, die sich Transformationsforscherin nennt.
Wir schliessen die Augen, denken uns hinaus ins All – und landen wieder auf der Erde, im Jahr 2043. Unser Auftrag: ein Objekt zu bauen. Spreitzer und Schenkel stellen uns diverse Materialien zur Verfügung: Baustoff aus Pilzmyzel, Rinde, Bambus, Kork, Erde, Chilischoten, natürliche Farbstoffe wie Kurkuma. Aber auch einige Dinge aus der Vergangenheit, die 2043 längst out sind, wie Karton, Wolle (Tierausbeutung!), Plastik. Wir teilen uns in drei Gruppen. Die Zukunft unserer Gruppe soll «unified», also vereint, sein. Wir stellen uns eine Welt ohne Grenzen, ohne Pässe vor, eine Gesellschaft, die sich um Gerechtigkeit und Ausgleich bemüht. Doch dann kippt unsere Zukunft ins Zwiespältige: Es gibt auch keine Privatsphäre mehr, kein Bargeld, es herrscht die totale Kontrolle, invasive Neophyten überwuchern alles (dieses Detail stammt von mir). «Alle Bücher sind erhältlich, aber in allen steht dasselbe», sagt der Wissenschaftshistoriker.
Das Objekt, das wir bauen, ist eine Art primitive Actionfigur: der «unifier». Augen aus Veloschläuchen, Haare aus orangen Pflanzenfasern. Auch er trägt den Zwiespalt in sich: Er findet jede Ungerechtigkeit und beseitigt sie, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Eine Art Rächerroboter, der platt walzt, was er für unfair hält.

Und jetzt? Wir reisen weiter, dieses Mal hundert Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2123. Nun sind wir Kunsthistoriker:innen, die einander erklären, was diese achtzig Jahre alten Objekte bedeuten. Das Jahr 2043 ist also schon wieder lange her. Ein simpler Trick, doch ich staune, was er auslöst. Die Welt in zwanzig Jahren ist nun so weit weg wie von unserer Zeit aus gesehen der Zweite Weltkrieg. Es leben kaum noch Menschen, die davon erzählen können. Was hat die Gruppe, die 2043 den Auftrag hatte, eine «liebende Zukunft» darzustellen, wohl mit ihrem Objekt bezweckt? Sie hat eine begehbare Installation geschaffen, die sich zwischen dem «Pol des Individualismus» und dem «Pol der Community» aufspannt. Man kann sich auf einer Yogamatte hineinlegen. Blumengeschmückte Wollfäden hängen zwischen den Polen. 2043 habe man einen neuen Gott der Liebe verehrt, erklärt der Choreograf. Es sei eine kriegerische Krisenzeit gewesen, die Menschen hätten dringend eine utopische Vision gebraucht.
Wir stellen einander Fragen: Wer schrieb die Geschichte des Objekts? Hatte es eine religiöse Funktion? Wurde der Künstler, die Künstlerin bezahlt? «Mit Kaffee», witzelt jemand.
Wie unsere Gegenwart 2123 aussieht, beschreiben wir nicht. Es wird nur implizit klar aus dem, was wir sagen. Das Schlimmste scheint vorbei, jedenfalls war 2043 schlimmer als jetzt. Oder?
Auch die Gruppe der «open-minded future» erzählt Ähnliches. 2043 seien die Leute verzweifelt gewesen, hätten genug gehabt von der Jagd nach immer mehr. Sie hätten verstanden, dass es nötig sei, «vom Wissen zur Weisheit» zu kommen. Ist das nun einfach pathetisch und banal? Oder doch mehr? Ich schwanke – wie so oft. Ich war schon in vielen Diskussionen die Spielverderberin, weil ich immer noch mehr deprimierende ökologische Fakten weiss. Aber ich plädiere an jeder Redaktionssitzung für eine hoffnungsvollere Zeitung.
Wir kommen zu unserem Objekt, dem «unifier» mit den orangen Haaren, und jemand fragt: «Remember Donald Trump?» Es ist lange her, vor hundert Jahren gab es doch diesen seltsamen Typen … Jetzt ist er nur noch eine Erinnerung. Irgendwie hilft mir das.
Ich weiss seit 1986, dass die Welt bedroht ist und die Zukunft schwierig wird. Trotzdem erschrecke ich immer noch, immer wieder. Ich sehe in einem Dokfilm einen abgemagerten Eisbären, den es in die russische Bergbaustadt Norilsk verschlagen hat, viel zu weit nach Süden. Leute machen grinsende Selfies mit ihm im Hintergrund. Die kollabierenden Permafrostböden bilden braune Krater, die wie Braunkohletagebaue aussehen. Die Gegenwart klingt wie ein dystopisches Jugendbuch von 1986.
Ich muss nicht fürchten, dass mir das Trinkwasser ausgeht, meine Ernte verdorrt oder Milizen mein Quartier überfallen. Sogar meine Angst ist privilegiert. Ich weiss. Aber sie kommt näher. Die Angst vor der Zukunft ist jetzt die Angst vor den US-Wahlen im November. Vor der Wahl von Trump und ihren Folgen, vor Putins Reaktion darauf, vor den eskalierenden Konflikten im Nahen Osten, vor dem Faschismus. Wieder vermischen sich Kriegs- und Ökoangst, etwa wenn der ukrainische Autor Sergei Gerasimow in der NZZ warnt, die wachsende Unzufriedenheit in Russland könnte «zum Zusammenbruch des russischen Zentralstaates und in der Folge zu einer unkontrollierten Verbreitung von Atomwaffen in der ganzen Welt führen». Bei einem atomaren Schlagabtausch zwischen Russland und dem Westen gäbe es in wenigen Stunden über neunzig Millionen Tote, schätzt eine Studie der Universität Princeton.
Zurück in die Achtziger, in fast allem. Sogar die offenen Drogenszenen sind wieder da. Der Alltag in der Schweiz ist immer noch sehr weit weg von der globalen Realität, aber anders als in den Globalisierungsboomjahren können wir nicht mehr ganz so tun, als ginge uns das alles nichts an.
Annika Lutzke vermisst Lützerath. Die 21-jährige Zürcherin mit den kurzen hellen Haaren und dem ernsten Gesicht war eine der Mediensprecher:innen der Bewegung, die versuchte, das deutsche Dorf gegen den Braunkohleabbau zu verteidigen. Über ein Jahr lang organisierte sie sich dort. «Ich wünsche mich oft nach ‹Lützi› zurück – dort hatte ich eine klare Aufgabe, es hatte schon einen Sinn, einfach dort zu sein. Wir lasen zusammen Bücher, diskutierten über jeden zweiten Satz. Das Leben in ‹Lützi› hat mir Sinnhaftigkeit gegeben.» Nach der Räumung im Januar 2023 kam sie zurück nach Zürich. «Hier ist alles viel schwieriger, individualisiert, ich muss mir selbst aussuchen, wogegen ich kämpfe und wie, muss mich um Lohnarbeit und Krankenkasse kümmern …»
Als 2018 die Klimastreiks begannen, war Lutzke noch am Gymnasium Rämibühl. Die erste Zeit hat sie als «magisch» in Erinnerung. «Ein Gefühl: Wir können alles machen.» Seither ist für sie klar: «Ich teile nicht ein, was Aktivismus ist und was nicht. Das ist einfach mein Leben. Ich möchte in Dinge investieren, die mir guttun und die notwendig sind.» Sie arbeitet in der Lebensmittelkooperative Rampe 5. «Ökologische Landwirtschaft ist neben anderer Sorgearbeit das Einzige, was nicht Teil des zerstörerischen Systems ist. Lebensmittel brauchen wir, sie produzieren ist sicher nicht falsch. Und ich kann das, mein Körper ist in der Lage dazu.»
Die Angst vor der Zukunft kennt sie gut. «Die Ohnmacht ist das Schlimmste, ich muss ihr aus dem Weg gehen, um leben zu können.» Die praktische Arbeit helfe ihr, gesund zu bleiben. Die Lohnarbeit limitiert sie bewusst. «Ich kann nicht hundert Prozent arbeiten, sonst nehmen meine Depressionen überhand.» Gut tue ihr eine Mischung aus Alleinsein und Aktivismus, Rückzug und Offensive. «Das Gefühl, wirkmächtig zu sein, ist hilfreich. An den Machtverhältnissen kratzen, kollektive Macht spüren. Aktivismus geht für mich aber nur, wenn er auch für sich selbst emanzipatorisch ist.» Es sei wichtig, sich umeinander zu kümmern, Solidarität zu leben. Sie hat Bekannte, die bei den Zapatistas in Mexiko waren. Mitgebracht hätten sie «eine Hoffnung, die nicht aufhört».
Annika Lutzke hat sich auf eine lange Zeit eingestellt: «Viele kommen in einen grossen Stress, ein Gefühl von ‹Jetzt oder nie›. Aber der Kampf ist nicht übermorgen vorbei.»
Ich habe die Zeit der Wef-Proteste in einem linksradikalen Umfeld verbracht, in dem «Psychologisieren» als Schimpfwort gebraucht wurde. Psychologie als Inbegriff des Unpolitischen. Wenn es eine Entwicklung der letzten Jahre gibt, für die ich extrem dankbar bin: Heute ist es in den meisten linken Szenen (wieder) Konsens, dass Psychologie politisch ist.
«Angst ist berechtigt, solange es Typen gibt, die einfach so schnell ein Land überfallen können», sagt Bruno Wiederkehr. Er ist siebzig, Psychotherapeut, empfängt immer noch an zwei Tagen pro Woche Patient:innen bei sich zu Hause im Appenzeller Dorf Rehetobel. In jungen Jahren war er Seiltänzer, heute wirkt er ein bisschen wie ein buddhistischer Mönch. Der Eindruck täuscht nicht. Meditation bedeutet ihm viel, weil sie eine Form sei, «nicht in die Leistung zu gehen»: «Nicht teilnehmen am Bessermachen, Regulieren, Therapieren. Einfach bei vollem Bewusstsein da sein und nicht-tun.»
Wiederkehr sucht oft lange nach Worten. Vor zwanzig Jahren hat er eine schwere Krebserkrankung überlebt. Was damals geschehen sei, habe ihm einen grossen Teil seines heutigen Lebens geschenkt, sagt er. «Man muss akzeptieren, dass man jederzeit sterben kann. Bevor wir nicht unser Leben aufgeben, gibt es keine echte Lebendigkeit.»
Was tun mit der Angst? Kann er Übungen empfehlen? «Vielleicht eben gerade nicht. Natürlich – wenn du etwas hast, was dir hilft, mach damit weiter!» Aber er will keine Tipps geben. Suchend bleiben, das ist ihm wichtig. Das Suchen aushalten. «Unsicherheit ist ein Wert, genauso wie Fröhlichkeit. Wir haben es doch nicht im Griff.» Beim Meditieren erlebe er manchmal «en u huere Schmerz», einen Niedergang: «Ich tue ja nichts mehr.» Gleichzeitig wachse etwas, das sehr stark und stimmig sei. «Weil wir nicht ins Handeln gehen, eine Blume eine Blume sein lassen. Lebendigkeit zulassen. Wir sind die Lebendigkeit der Natur.»
Tobias Adam habe ich letztes Jahr an einer Podiumsdiskussion über die evangelische Theologin und Friedensaktivistin Dorothee Sölle (1929–2003) kennengelernt. Ein Satz von ihm blieb mir besonders in Erinnerung: «Ich habe mir eine hochreligiöse Jugend gegönnt.»
Adam ist Klimaaktivist und studiert evangelische Theologie. Er will Pfarrer werden. Die dunkelblonden Haare an den Seiten rasiert, hinten zusammengebunden, das Kreuz unübersehbar über dem Pulli. Er strahlt eine ruhige Freundlichkeit aus, wirkt älter als seine 25 Jahre. Wir treffen uns in der Zürcher Citykirche am Stauffacher, wo er ein Praktikum gemacht hat. In einer Kirche, die für politische Ausstellungen genauso offen ist wie für Yoga.
«Es gibt Zeiten, in denen ich die Zukunft verdränge», sagt Adam. «Und Zeiten, in denen ich versuche, mich bewusst drauf einzulassen. Den Schmerz zuzulassen, mit aller Härte der Fakten. Dass die Klimaprognosen vielleicht sogar zu optimistisch waren, dass wir plus 1,5 Grad letztes Jahr schon erreicht haben …» Er spricht davon, einen «bedingungslosen Raum» zu schaffen, in dem Angst Platz hat, ohne bewertet zu werden. «Das Bild vom weiten Raum finde ich schön. Darum mag ich auch den Kirchenraum hier, ohne Bänke. Oder die Hardbrücke. Sie ist einer meiner Lieblingsorte in Zürich, weil man mitten in der Stadt in die Weite sieht.»
Er könne Aktivismus und Spiritualität nicht trennen, sagt Adam. «Eine Demo ist für mich eine Art von Gebet. Spiritualität muss für mich einen körperlichen und politischen Ausdruck haben.» Die Klischees und Missverständnisse, die Religiosität in einem linken Umfeld auslösen kann, sind ihm bewusst. Ein «Papa wirds schon richten»-Gott sei nichts für ihn, sagt er. Lieber bezieht er sich auf «God as power in relation», Gott als Kraft in Beziehung – eine Formulierung, die Dorothee Sölle gebraucht hat. Etwas vom Schönsten, was er bisher erlebt habe, sei ein interreligiöses Gebet gegen die geplante Lobau-Autobahn bei Wien gewesen (siehe WOZ Nr. 9/22). «Ich durfte den protestantischen Teil leiten.»
Adam ist ein Initiant der Schöpfungsinitiative, die verlangt, dass die evangelischen Zürcher Kirchgemeinden bis 2035 netto null erreichen und das Klima auch in Gottesdiensten und Schulungen thematisieren. Er glaube nicht an einen grossen Wurf, eine technische oder politische «Lösung» der Klimaerhitzung, sagt er. Doch das sei kein Grund zur Resignation: «Für meine Bachelorarbeit habe ich mit einem Physiker gesprochen, der sagte: ‹Jedes Zehntelgrad Erwärmung, das wir vermeiden, macht einen Unterschied.› Wir können immer noch beeinflussen, wie schlimm es wird.»
Sorgen macht ihm die Gewalt an den Grenzen Europas. Er hofft, dass die Religionen ein Teil des Widerstands sein können. «Dass es immer wieder Menschen wie den Flüchtlingshelfer Paul Grüninger oder das religiös-soziale Ehepaar Ragaz gibt, die sich einsetzen gegen Abschottung. Die die Utopie real werden lassen.»
Hilft es, von weit weg zu schauen? In langen Zeiträumen zu denken? Es kann eine Form der Distanzierung sein, ein Rezept für Zynismus: In der Erdgeschichte sind schon so viele Arten ausgestorben, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an. Aber in letzter Zeit merke ich, dass der weite Blick auch etwas anderes auslösen kann. Der Horizont von hundert Jahren im Workshop oder 198 Millionen Jahre alte Versteinerungen in den Ferien in Südfrankreich. Vielleicht ist es das, was Tobias Adam «bedingungslosen Raum» nennt. Vor dem Hintergrund von unvorstellbarer Zerstörung bekommt jedes Lebewesen Bedeutung, jede Tier- und Pflanzenart, jede Person.
Ich kann Grosses und Kleines nicht mehr unterscheiden. Ich sage zu einer Freundin, dass ich dieses Gewicht, das heutige queerfeministisch-ökologische Bewegungen auf einen sorgfältigen Umgang miteinander legen, nie mehr verlieren möchte. Und sie sagt: «Wie wir miteinander umgehen – das sind die Menschenrechte.» Die Friedensaktivist:innen in Israel und Palästina tun etwas scheinbar Kleines: Sie reden mit den Nachbar:innen. Es ist wahrscheinlich das Grösste, was sie momentan tun können.
Statt sich an Countdowns zu klammern («Wir haben noch zehn Jahre, um die Katastrophe zu verhindern»), üben manche Klimaaktivist:innen die bewusste Auseinandersetzung mit Angst und Trauer. Etwa die über neunzigjährige US-amerikanische Umweltaktivistin Joanna Macy, die ihre Methode «active hope» nennt. Um aktive Hoffnung zu üben, müsse man nicht optimistisch sein, schreibt sie. Es sei eine bewusste Entscheidung, kein Gefühl.
Ich glaube, sie meint dasselbe wie Annika Lutzke: «Es ist viel hoffnungsloser, nichts zu tun, als etwas zu tun.»
