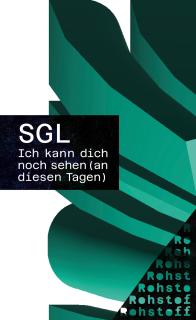Literatur: Austauschbare Körper
Sie findet Worte für das Unfassbare: Simoné Goldschmidt-Lechner schreibt in ihrer zweisprachigen Novelle gegen sexuelle Gewalt, Rassismus und Polizeigewalt an.

Mit den Fingern die Tasten aus den Steinways herausreissen, ein Mahnmal aus Klaviertasten vor seinem Haus errichten, sodass die Tür versperrt wird, und ihn verhungern lassen, während sie im Garten Jollofreis kocht. Das sind die Rachefantasien von Rahel, die in einem Polizeirevier sitzt und eine Vergewaltigung anzeigt. In der Realität verläuft die Gewalt aber diametral, und so hatte sich die Stadt, in der die Hauptfigur in Simoné Goldschmidt-Lechners Novelle «Ich kann dich noch sehen (an diesen Tagen)» lebt, in Zonen aufgeteilt: jene, von denen sie denkt, dass sich der Mann, dessen Tat gerne dadurch verharmlost wird, dass man doch «Lovers und Friends» gewesen sei, nicht darin aufhalten würde; und jene, in denen sie ihn vermutete. Letztere dehnen sich immer mehr aus: «rote Linien überall, die gesamte Stadt eine längst entzündete, brennende Wunde, die gesamte Stadt ein Angstort».
Ein Angstort ist für Rahel auch die Polizeistation, zu oft wurde ihr Umfeld durch Beamte rassifiziert und kriminalisiert. Vor dem Eintreten hat sie ein Stossgebet Richtung Himmel gesendet: «I need you now, Polizei!» Rahel ist aufgefordert, ganz genau zu erzählen, was «vorgefallen» sei, im Sommer vor einem Jahr – zur Seite steht ihr der beste Freund Finn.
Wenn sie sich nicht auf ihre Aussage konzentriert, verwandeln sich die undefinierbaren Klänge im Korridor des Polizeipräsidiums in Symphonien Rachmaninows: Der Täter ist Pianist. An manchen Stellen wird er direkt angesprochen und zum «du» im Text. Etwa wenn die Protagonistin feststellt, dass sie unfähig ist, das Wort zu artikulieren, dessentwegen sie hier ist: «Vergewaltigung». So heisst es einmal: «So gesehen hast du natürlich schon gewonnen, weil du mich berührt hast, als ich es nicht wollte, und ich nicht einmal das Wort anfassen kann oder die Sache oder dich. Unantastbar.»
Ein Chor von Versehrten
Wie Simoné Goldschmidt-Lechners Romandebüt «Messer, Zungen» (2022), das anhand verschiedenster Figuren vom Fortwähren kolonialer Strukturen und dem Aufwachsen in einer Community von Cape Coloureds in Südafrika erzählt, kommt auch «Ich kann dich noch sehen (an diesen Tagen)» mehrstimmig daher. Die zweisprachig erschienene Novelle der Autorin, Podcasterin und Übersetzerin kann umgedreht und von beiden Seiten gelesen werden: einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
Dabei weist Rahels Geschichte weit über ihre eigene hinaus. Ihre Gedanken schweifen immer wieder zum Tag zurück, an dem Finn in der Schule von der Polizei abgeholt und mehrere Stunden verhört wird. Eine Verwechslung, wie sich die Polizei später zu rechtfertigen versucht. «Ich glaube, ich verstehe an dem Tag und in den Tagen danach das erste Mal, wie austauschbar unsere Körper sind», stellt Rahel fest. Auch reale Vorfälle von Gewalt schieben sich in den Text, etwa die Tötung des Sechzehnjährigen Mouhamed Dramé aus Dortmund durch die Polizei oder Anschläge des rechtsextremen NSU.
Sally Challen und Sansa Stark
Goldschmidt-Lechner verbindet die Episoden von Rahels Tag im Polizeirevier darüber hinaus mit unzähligen transnationalen, mythologischen und popkulturellen Ereignissen. So fragt sie, wie sich wohl die Engländerin Sally Challen gefühlt haben muss, als sie ihren Ehemann nach jahrelangem Missbrauch mit einem Hammer erschlug. Über die Seiten huscht auch Persephone aus der griechischen Mythologie, die von Hades, ihrem Onkel, vergewaltigt wurde. «Dass der ewige Patriarch Zeus der Vergewaltigung seiner Tochter durch seinen Bruder zustimmte, ist kaum bekannt», schreibt Goldschmidt-Lechner.
Selbst Sansa Stark, eine Figur aus dem Fantasyepos «Game of Thrones», nimmt sich die Autorin zur Brust – oder vielmehr ihren Schöpfer George R. R. Martin sowie jene, die Stark zur feministischen Figur hochstilisieren. In der Hochzeitsnacht vergewaltigt, gelingt Stark die Flucht, später wird sie sich an ihrem Peiniger rächen. Goldschmidt-Lechner analysiert, dass sie ihr «feministisches Awakening» aber erst erlebe, nachdem sie von der Geschichte genügend bestraft worden sei und nur, weil ihre Bestrafung der Charakterentwicklung eines männlichen Protagonisten diene.
All diese weiblich gelesenen Körper verwebt die Autorin zu einem Chor von Versehrten. Sie stellt klar, dass sexuelle und rassistische Gewalt allgegenwärtig sind, und findet für diese eine poetische, unbeschönigte Sprache. Das liest sich rauschhaft. Hartnäckig stellt die Autorin immer wieder die Frage in den Raum, wie die Gesellschaft mit Taten umgeht, die mit dem irreführenden Begriff «Beziehungsdelikt» gelabelt werden. Und sie zeigt, dass auf das Anzeigen einer Vergewaltigung nicht per se ein Gefühl der Befreiung für die Betroffenen folgt, sondern zuerst eine weitere Gewalterfahrung: die des Ermittlungsverfahrens.
Im Epilog wird Rahel während einer Nachvernehmung immer wieder gefragt, wie sich denn die Erregung des Täters angefühlt habe. Und sie antwortet irgendwann gezwungenermassen detailreich: «Hart. Warm. Ist es das? Sind das die richtigen –? Die Eichel wie klebrige Seide, wie das, was Seidenraupen auf Maulbeerblättern spinnen, oder eigentlich wie die Seidenraupen selbst oder so.»