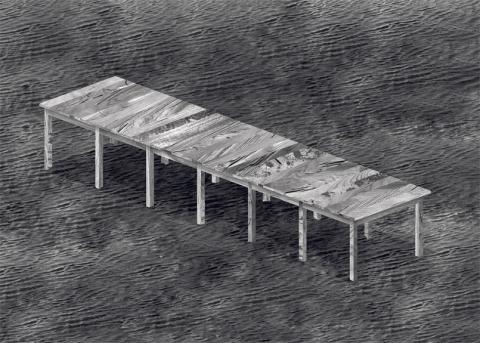Essay: «Wer die Selbstbestimmung als höchste Errungenschaft der Gegenwart feiert, dürfte gegen die Suizidkapsel Sarco nichts einzuwenden haben»
Gibt es das wirklich, ein selbstbestimmtes Sterben? Eine Spurensuche auf dem Balkon einer Sterbenden, bei Exit, in Kanada und im Gesundheitssystem der Schweiz.

Sarco verstört. Aber warum eigentlich? Wer von eigener Hand aus dem Leben scheiden will, verfügt nun über eine neue Methode. Nicht betreut von einer Sterbehelferin, die bis zum letzten Atemzug am Bett des Sterbenden ausharrt, sondern allein in einer Kapsel im Wald, am Strand, unter einem Sternenhimmel, ganz nach Belieben. Stickstoff strömt in das Gehäuse und bringt den Tod angeblich sanft wie Natriumpentobarbital, das Mittel, das ein Sterbewilliger schluckt, wenn er sich von Exit oder einer anderen Organisation helfen lässt. Nicht brutal wie durch einen Sprung vor den Zug oder einen Schuss in den Kopf. Warum also die Aufregung?
Der Bedenken sind viele: Dass ein Knopfdruck das Leben beende, banalisiere das Sterben. Indem die Macher:innen ihre Kapsel mit Bildern einer schneebedeckten Bergkette im Sonnenuntergang bewerben, ästhetisierten sie den Tod. Sie versprächen einen schönen Abschied, dabei sei es alles andere als schön, die Welt zu verlassen. Vor allem könne nicht die Hände seiner Liebsten halten, wer in der verschlossenen Kapsel ersticke. Und bei Exit heisst es: Wir brauchen Sarco in der Schweiz nicht, die Sterbehilfevereine sind etabliert, es drohen Regularien, wo wir bisher doch gut ohne auskamen.
«Der Tod ist nicht selbstbestimmt, nie.» Vor Jahren hat mir eine Frau in ihren Fünfzigern, unheilbar krebskrank, diesen Satz gesagt. Sechs Monate später war sie tot. Wenn sie wüsste, was sie ausgelöst hat. Wir sind uns begegnet, weil ich über Exit geschrieben hatte. Sie fühlte sich davon angesprochen, schickte mir einen Brief, ich rief sie an, sie lud mich ein. Es war Sommer, wir sassen auf ihrem Balkon, mehrere Vormittage lang. Sie erzählte, ich hatte unzählige Fragen. Seither denke ich über wenig so intensiv nach wie über das Sterben – und habe noch mehr Fragen. Viele entspringen dem Gespräch mit ihr. Nicht verlassen hat mich vor allem eine: Sterben wir jemals selbstbestimmt?
Nina Streeck
Die Philosophin Nina Streeck ist auf biomedizinische Ethik spezialisiert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialethik der Universität Zürich und forscht zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit seltenen Krankheiten und dem Lebensende. 2020 erschien bei Campus ihr Buch «Jedem seinen eigenen Tod. Authentizität als ethisches Ideal am Lebensende».

Meine Gesprächspartnerin, nennen wir sie Frau Weber, bestätigte meine Zweifel. Bisweilen sann sie über einen assistierten Suizid nach, zugleich nannte sie Exit einen Fluch: Nur weil es die Organisation gebe, komme man auf den Gedanken, sich selbst zu töten. Sie trauerte, litt, verzweifelte, stets mit der Möglichkeit vor Augen, ihr Leiden umstandslos zu beenden – und fühlte sich schrecklich allein. Bisweilen meinte sie zu spüren, was ihr Umfeld dachte: dass sie all den Schmerz doch freiwillig ertrage, sie müsste schliesslich nicht, Exit böte einen Ausweg. Selbst schuld, wenn du leidest. Wie selbstbestimmt wäre in dieser Situation ein assistierter Suizid? Gerät unter Druck, sich selbst das Leben zu nehmen, wer unter einer unheilbaren Krankheit leidet? Wer dement ist, gebrechlich, pflegebedürftig?
Es fällt nicht schwer, sich ein qualvolles Sterben auszumalen. Die grösstmögliche Angst dürften Fantasien über ein Lebensende mit Demenz verströmen. Ich verlöre meine Persönlichkeit, wäre nicht mehr Herrin meiner selbst und erinnerte mich an niemanden, nicht einmal an meine Allerliebsten. Eines Tages schöbe man mich ins Pflegeheim ab, wo ich mich bestenfalls peinlich verhielte, mich vielleicht auf dem Gang entblösste. Oder es käme schlimmer, ich kämpfte mit Hand und Fuss dagegen an, mich waschen zu lassen, weshalb zwei Pflegepersonen mich gewaltsam festhielten und eine dritte mich pflegte.
Es hilft wenig, versöhnlichere Erzählungen zu kennen, etwa die von Walter Jens, dem berühmten Intellektuellen. Jens machte sich in den neunziger Jahren dafür stark, dass Sterbehilfe in Deutschland legalisiert wird, nicht zuletzt getrieben von der Furcht, entmenschlicht als «zuckendes Muskelpaket» zu enden, wie er sagte, und seine Angehörigen nicht mehr zu erkennen. Wenige Jahre später erkrankte er an Alzheimer. Sein Arzt versprach ihm Sterbehilfe, Ehefrau und Sohn waren einverstanden. Als seine Urteilsfähigkeit schwand, erinnerten sie ihn, dass er bald handeln müsse, aber Jens winkte ab: Es sei noch nicht so weit. Schliesslich war es zu spät. Eine Betreuerin kam ins Haus, die Jens auf Spaziergänge zu einem Bauernhof in der Nähe mitnahm. Er streichelte Ziegen, blätterte in der Bauernstube in Kinderbüchern und wirkte zufrieden. «Nicht totmachen», sagte er immer wieder zu seiner Frau. Er starb 2013.
Wie schlimm ist Demenz? Oder ein «Dahinvegetieren wie ein Gemüse»? Dass ihr das bevorstünde, befürchtete Frau Weber, als sie die Diagnose erhielt: ein unwürdiges Leben. Als wir uns einige Jahre später kennenlernten, zweifelte sie, ob es würdelos sei, sediert durch Morphium nur noch im Bett zu liegen, denn wer entschiede darüber? Was macht die Würde eines Menschen aus? Wann ist es besser, tot zu sein? In einer Studie aus den USA antworteten mehr als die Hälfte der Befragten, sie stürben lieber, als inkontinent zu sein. Nichts sei schlimmer, nicht Bettlägerigkeit, nicht eine künstliche Beatmung, nicht dauerhafte Verwirrtheit.
Im Mitgliedermagazin von Exit erzählen Hinterbliebene schöne, mitunter süssliche Geschichten über das Sterben. Wie der letzte Abend zelebriert wird, alles ist haarklein geplant: Die Familie trifft ein, das Lieblingsessen kommt auf den Tisch, man lacht und tauscht Erinnerungen aus. Bevor der Sterbehelfer am nächsten Vormittag eintrifft, schlüpft die Mutter in ihre hübscheste Bluse, die Kinder betten sie aufs Sofa in der Stube, neben ihr stehen ein Röschen in einer Vase und Apfelsaft, um später das Sterbemittel hineinzurühren. Ist der Suizidbegleiter da, versammelt sich die Familie am Sofa, und die Tochter ergreift die Hand ihrer Mutter. Es ist so weit, der Mann von Exit reicht das Mittel, die Mutter setzt den Becher an die Lippen und schluckt tapfer das bittere Getränk. Nach kurzen Abschiedsworten tut sie ihren letzten Atemzug und schläft mit entspanntem Gesichtsausdruck ein.
Sehr anders als die blumigen Worte in den Werbeprospekten für Sarco klingt das nicht. Warum wird die Suggestion eines schönen Sterbens vor spektakulärer Alpenkulisse als Ästhetisierung des Sterbens missbilligt, die tröstlichen Bilder, die Exit heraufbeschwört, jedoch nicht? Der Sarco-Erfinder erschafft ein Gerät, das einzig dazu dient, den Tod herbeizuführen. Im Jahr 1980 kam die pensionierte Lehrerin Hedwig Zürcher auf die Idee, eine Organisation mit dem Zweck zu gründen, Menschen dabei zu helfen, sich den Tod zu geben: Exit. Worin liegt der grosse Unterschied? Lieber läge ich allein in einer Kapsel, blickte in den Sternenhimmel und atmete Stickstoff ein, nachdem ich mich von den Meinen verabschiedet hätte, als mir von einer fremden Person einen Giftbecher reichen zu lassen.
Was soll es überhaupt, dafür zu werben, einen bestimmten Weg zu wählen, um aus dem Leben zu gehen? Weshalb hängt Exit Papptafeln in Trams, auf denen es heisst: «Mit Würde zum Schluss»? Oder: «Selbstbestimmt am Ende»? Bestimme ich nicht selbst, wenn ich mich dafür entscheide, geschehen zu lassen, was immer kommen mag – seien es Schmerzen, der Verlust meiner Unabhängigkeit oder Pflegebedürftigkeit? Oder wenn ich bis zuletzt einen aussichtslosen Kampf dagegen ausfechten will, bald nicht mehr zu sein? Mir ist schleierhaft, weshalb den «Selbstbestimmungsorganisationen», als die sich Exit, Dignitas und Co. bezeichnen, die Souveränität fehlt, auf Werbung zu verzichten, wo kaum mehr jemand sie kritisiert.
Niemand entzieht sich diesen Narrativen – was unsere Autonomie nicht zerstört, aber gefährdet. Freilich kommt nicht bloss Sterbehilfe zur Sprache, wenn es ums Lebensende geht. In Zeitungsartikeln und Dokumentarfilmen wird beides gern geschildert: wie Sterbenskranke sich beim Suizid assistieren lassen oder wie sie palliativ versorgt friedlich in einem Hospiz entschlafen, was ein nicht minder schönes Lebensende verspricht. Allerdings ist nicht ohne Belang, was erzählt wird.
In Kanada stehen Geschichten über Sterbehilfe längst unter einem anderen Vorzeichen: Geld. Im Gesundheitswesen lässt sich viel einsparen, wenn kranke, alte, behinderte und arme Menschen Sterbehilfe beanspruchen. Sehr viel. Die kanadische Regierung rechnet es aus.
Im Jahr 2016 legalisierte das Parlament das ärztlich assistierte Sterben. Sowohl Suizidbeihilfe als auch die Tötung auf Verlangen waren nun erlaubt, sobald sich ein baldiges natürliches Ableben abzeichnete. Seit einer Gesetzesänderung 2021 genügt es, unerträglich an einer schweren, unheilbaren Krankheit oder an einer Behinderung zu leiden, unabhängig davon, wie lang die Lebenserwartung ist. Zudem – und das ist der Clou – muss der Sterbewunsch darauf beruhen, dass der oder die Sterbewillige keine akzeptable Möglichkeit findet, das eigene Leiden zu lindern. Wem etwa das Geld fehlt, einen Pflegedienst zu bezahlen, der erhält die tödliche Spritze, falls er keinen anderen Weg sieht, sich helfen zu lassen.
Die kanadische Regierung kommunizierte die finanziellen Vorteile der neuen Regelung in aller Offenheit, bevor das Gesetz verabschiedet wurde: Dank Sterbehilfe fielen die Gesundheitskosten bereits um umgerechnet 54 Millionen Franken niedriger aus, und komme der Gesetzesentwurf durch, liessen sich weitere 39 Millionen Franken einsparen. Der Staat zahlt für den Tod, die Kosten für Arztrechnungen, Sterbemittel und Aufsichtsbehörden sind einkalkuliert. Die Autor:innen des Berichts erwarteten, dass sich nun viele Menschen mit Behinderungen das Leben nähmen, und vermuteten 7630 Todesfälle im Jahr 2021. Tatsächlich starben 10 064 Menschen, ein Jahr später waren es 13 241. Noch mehr Geld gespart. Was keinesfalls der Zweck des neuen Gesetzes sei, beteuert die Regierung in ihrem Bericht über das Sparpotenzial.
«Why is Canada euthanising the poor?» (Warum tötet Kanada die Armen?) titelte im April 2022 die britische Wochenzeitung «The Spectator» und entfachte damit eine Debatte, ob der kanadische Staat das ärztlich assistierte Sterben nicht bloss gestatte, sondern sogar fördere. Mittlerweile finden sich in den Medien unzählige Berichte von Menschen, die Sterbehilfe erwogen oder in Anspruch nahmen, weil es ihnen an Geld mangelte, Therapien oder eine Bleibe zu bezahlen. Wer krank ist oder eine Behinderung hat, bekommt bisweilen sogar ausdrücklich den Rat, um Sterbehilfe zu ersuchen.
Da ist die Geschichte einer Frau mit chronischen Schmerzen, die ihre Physiotherapie und wirksame Naturheilmittel nicht mehr bezahlen konnte, als ihre Kredite ausliefen. Oder diejenige einer 51-Jährigen aus Ontario, die eine Wohnung brauchte, in der ihre Allergien nicht ausbrachen, aber keine finanzierbare fand. Breit durch die Presse ging, was der 54-jährige Amir Farsoud erlebte. Als er seine Wohnung verlor, sorgte er sich, obdachlos zu werden. Weil er sich nicht vorstellen konnte, auf der Strasse zu leben, suchte er einen Arzt auf, schilderte ihm seine chronischen Rückenschmerzen und erhielt widerspruchslos die Bestätigung, die Voraussetzungen für ein ärztlich assistiertes Sterben zu erfüllen. Auf dem Papier standen die Rückenschmerzen, während Farsoud klar sagte, ohne seine Wohnsituation dächte er im Traum nicht an Sterbehilfe. Die Geschichte fand ein glückliches Ende: Er sammelte auf der Plattform «GoFundMe» umgerechnet 37 000 Franken und verwarf seinen Plan.
Aus hiesiger Warte mag frivol anmuten, was Kanada treibt. Was hat die Schweiz damit zu tun? Jedenfalls können diejenigen Exit danken, die sich wegen hoher Gesundheitskosten oder der AHV sorgen, und hoffen, dass die rührseligen Sterbegeschichten und die Werbeaktionen verfangen. Im Jahr 2022 verursachten Personen ab 61 Jahren mehr als die Hälfte der Gesundheitskosten. Vor allem das letzte Lebensjahr schlägt zu Buche: So kurz vor dem Tod kostet die Versorgung zehnmal mehr als im Durchschnitt aller vorausgehenden Jahre. Menschen mit Demenz kommen besonders teuer zu stehen. Sich um sie zu kümmern, belastet das Gesundheitswesen mit 6,3 Milliarden Franken jährlich. Weitere 5,5 Milliarden tragen die Angehörigen, die ihre kranken Familienmitglieder unbezahlt pflegen. Der – nicht umsonst so genannte – Freitod gehorcht einer neoliberalen Logik. Selbst wenn hierzulande niemand fürchten muss, unerträgliche Schmerzen zu leiden, weil sich die Krankenkasse weigert, eine Behandlung zu finanzieren, folgt er demselben Kalkül wie in Kanada.
Wir reden vom selbstbestimmten Sterben, vor allem ist es ein eigenverantwortliches Sterben. Finde ich keinen Weg mehr, ein Leben zu führen, das mir lebenswert erscheint? Es gibt Exit. Glaube ich, meiner Familie zur Last zu fallen, weil sie fürs Pflegeheim aufkommt? Dito. Sehe ich nichts, was mein Leiden so lindern könnte, dass mein Lebensmut zurückkehrt? Warum dann kein assistierter Suizid? Es ist eine Abwägung von Nutzen und Kosten. Die Inkontinenz, die schlimmer ist als der Tod. Die Geschichten eines schönen Sterbens. Die Horrorstorys über Demenz. Der Fluch, von dem Frau Weber gesprochen hat. Den Staatsfinanzen kommt zugute, dass es Sterbehilfeorganisationen gibt. Warum spricht niemand darüber?
Wer zu Coronazeiten im Pflegeheim lebte, bekam die Frage gestellt: «Haben Sie eine Patientenverfügung? Wollen Sie eine abfassen?» Jede:r wusste aus den Medien um die Risiken einer Covid-Infektion. Die Angst ging um, bei einer Erkrankung auf der Intensivstation zu landen und künstlich beatmet zu werden, weshalb es nicht schwierig war, überzeugende Gründe zu nennen, sich um eine Patient:innenverfügung zu kümmern. Niemand hält in einem solchen Schriftstück fest, dass er oder sie das volle Programm zur Lebenserhaltung will, denn das bekommt, wessen Wünsche unbekannt sind. Patientenverfügungen dienen der Abwehr medizinischer Massnahmen. Auch sie lassen die Gesundheitskosten sinken. Das Bundesamt für Gesundheit hat 2021 die Arbeitsgruppe «Gesundheitliche Vorausplanung» ins Leben gerufen, um Vorschläge zu erarbeiten, wie sich mehr Menschen motivieren lassen, eine Vorausverfügung zu erstellen.
Wer eine Patientinnenverfügung verfasst, zeichnet das Lebensende zwangsläufig in schwarzen Farben. Wenn ich zu Papier bringen will, ob ich lebenserhaltende Massnahmen wünsche, falls sich erwarten lässt, dass ich nie wieder reden kann, komme ich nicht umhin, albtraumhafte Szenarien zu entwerfen: Den Körper voller Schläuche, liege ich komatös in einem kalten Raum mit vielen piepsenden Geräten, und sollte ich ihn je wieder verlassen, verbringe ich den Rest meines Lebens im Bett, brauche Hilfe beim Essen, und mir fehlt die Sprache. Ich stelle mir vor, was geschehen könnte, aber nicht geschehen soll. Imaginiere eine katastrophische Zukunft – und beuge mit der Patientenverfügung vor, damit sie sich nie verwirklicht: eine Präventionsmassnahme.
Auch über Patientinnenverfügungen kursieren Geschichten. Im Nachbarland wirbt der Verein Advance Care Planning Deutschland damit, sich beim Verfassen einer Vorausverfügung beraten zu lassen. Verschiedene Personen schildern in Kurzfilmen, was sie keinesfalls erleben möchten, etwa ein bärtiger Mann in Motorradkluft, der nicht «perspektivlos an Schläuchen hängen» will. Die Patientenverfügung verspricht Abhilfe.
Eine rechtzeitige Selbsttötung auch. Nicht jeder Sterbewunsch entspringt gegenwärtigem Leid, viele sind vom Präventionsgedanken motiviert: Besser heute sterben als eine furchterregende Zukunft erleben. Der Schauspieler Gunter Sachs liess sich davon leiten, als er sich im Mai 2011 im Alter von 78 Jahren in seinem Haus in Gstaad erschoss. In seinem Abschiedsbrief hielt er fest, dass er vermute, an Alzheimer erkrankt zu sein, und ein würdeloses Lebensende fürchte. Deswegen schritt er präventiv zur Tat.
Viele Präventionskampagnen zielen darauf, die Gesundheit zu erhalten und Erkrankungen zu verhindern. Wir sollen nicht rauchen, wir sollen Kondome benutzen – denn so sinkt das Risiko, dass wir dereinst teure Therapien brauchen. Vorbeugen ist billiger. Prävention kommt meist in Form von Appellen daher: Übernehmt Verantwortung für eure Gesundheit! Nicht Zwang steuert das Handeln, sondern moralisches Pflichtgefühl und die vernünftige Einsicht, dass es uns ohne einen präventiven Lebenswandel eines Tages schlecht erginge. Wir müssen keine fürchterliche Zukunft ertragen, sondern tun es freiwillig, wenn wir keine Vorkehrungen treffen.
Der Tod von eigener Hand schliesst sich dem konsequent an: Altersbedingte Krankheiten sollen nicht existieren, das Dasein mit gesundheitlichen Gebrechen nur eine kurze Weile dauern, denn einzig ein gesundes Leben ist ein gutes Leben. Geht es verlustig, tritt man besser ab. Selbst schuld, wenn du leidest. Der Zwang ist zwanglos, nur: Wie selbstbestimmt fällt die Entscheidung zur Prävention?
Beginnend in den siebziger Jahren, bildeten sich weltweit Bewegungen, die für eine Legalisierung der Sterbehilfe demonstrierten. In den USA gab Karen Ann Quinlan 1975 – ungewollt – den Anstoss. Auf einer Party nahm die Neunzehnjährige Drogen und trank zu viel, erlitt einen Kreislaufstillstand und fiel ins Koma. Rasch zeigte sich, dass ihr Gehirn schwerst geschädigt war, weshalb sie nie wieder in der Lage wäre, zu kommunizieren. Ihre Eltern verlangten, die künstliche Beatmung zu stoppen, die behandelnden Ärzt:innen lehnten ab, woraufhin die Quinlans klagten und sich ein Jahr später durchsetzten. Damit traten sie eine Debatte los, die bald auch die Schweiz erreichte: Wer hat das Recht, über das Leben einer Person zu verfügen? Wie weit reicht die Autonomie einer Patientin, wenn sie nicht mehr selbst entscheiden kann? In verschiedenen Ländern entstanden «Right to Die»-Organisationen, deren Vertreter:innen überall gleich argumentierten: Es kommt jeder und jedem selbst zu, über den eigenen Tod zu bestimmen.
Aber was bedeutet das eigentlich: selbst bestimmen? Niemandem dürfte missfallen, eigenständig darüber zu entscheiden, wie er sein Leben gestalten möchte. Indem sich Exit und die anderen Organisationen auf ein unstrittiges individualistisches Ideal berufen, wissen sie ihr Anliegen als weithin anerkannt und befürwortet. Nur zeigt sich derweil eine widersprüchliche Entwicklung: Im Namen der Selbstbestimmung wird dieselbe gerade verhindert.
Als die Sterbehilfebewegung antrat, kämpfte sie für Freiheit im Sterben. Sie setzte sich durch, wuchs und wuchs, etablierte sich, normalisierte den assistierten Suizid als eine Sterbeoption unter anderen – und verkaufte ihr eigenes Ideal. «Sei selbstbestimmt!» lautet das paradoxe Gebot, das auf den Papptafeln in den Trams prangt, und entfaltet seine selbstdestruktive Dynamik. Das Phänomen lässt sich nicht bloss bei der Sterbehilfe beobachten. Wer auf dem Arbeitsmarkt hervorstechen will, stellt sein einzigartiges Selbst zur Schau und unterwirft sich einem Ideal der Authentizität. Hier wie dort fügt sich der Imperativ in eine neoliberale Logik: Übernimm Verantwortung für dein Leben, stirb eigenverantwortlich!
Und Sarco? Wer die Selbstbestimmung als höchste Errungenschaft der Gegenwart feiert, dürfte gegen diese neue Option des Suizids nichts einzuwenden haben. Im Gegenteil, denn der Tod in der Kapsel entspricht weitaus mehr dem Ideal eines selbstbestimmten Sterbens als ein assistierter Suizid. Zwar klären in beiden Fällen Ärzt:innen ab, ob die sterbewillige Person urteilsfähig ist, doch nur bei Exit beglaubigt ausserdem eine Begleiterin den Sterbewunsch – und fällt damit unweigerlich ein Werturteil: Ja, ich bestätige es, dein Leben ist nicht lebenswert. Ich helfe dir, damit du es nicht länger ertragen musst. Eine Person, die irgendwelche Geschichten gelesen hat, wie schlimm es ist, schwer krank zu sein oder mit einer Behinderung durchs Leben zu gehen. Nicht so beim Suizid durch Sarco: Die sterbewillige Person kauft sich Stickstoff zum Preis einer Zugfahrt von Zürich nach Basel mit Halbtax – das wars.