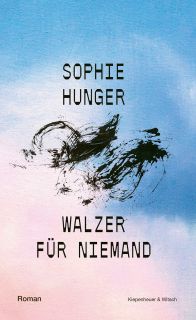Literatur: Aus der Glasglocke
In Sophie Hungers abgründigem Coming-of-Age-Roman bietet einzig die Musik etwas Halt. Zu den Leser:innen bleibt eine merkwürdige Distanz.

Sie ist bekannt für ihre dunkle Stimme und ihre bedeutungsschweren Songtexte. Als Tochter eines Schweizer Diplomaten und einer Politikerin wuchs Sophie Hunger in Bern, London, Bonn und Zürich auf. Seit fast zwanzig Jahren legt sie eine tadellose internationale Karriere hin.
Auf der Bühne inszeniert sie sich zuweilen weltfremd – in Interviews mal rätselhaft verworren, dann wieder direkt und pointiert. 2008 veröffentlichte Hunger das Lied «Walzer für Niemand» auf ihrem ersten Studioalbum «Monday’s Ghost». Ein melancholisches Stück Folkjazz, in dem sie singt: «Niemand, ich habe Geschenke für dich / Was wäre ich geworden, gäb es dich nicht / Meine gesammelten Werke, bitte sehr / Alles gehört dir.»
Nun hat Sophie Hunger diesen Song zur Grundlage ihres Debütromans gemacht. Und dafür grosse Resonanz erfahren. Die Veröffentlichung flankieren Porträts und Interviews, während die Literaturkritik in Superlative verfällt. «Walzer für Niemand» ist in kurze Kapitel gegliedert, die meist nach Song- oder Albumtiteln benannt sind – einige davon aus Hungers eigenem Repertoire. Damit enden die Parallelen zu ihrer Person zwar nicht, gegenüber SRF stellte sie aber klar, alles in ihrer Geschichte sei erfunden. Um kryptisch hinterherzuschieben, dass sich sowieso nur das Erfundene der Wahrheit nähern könne.
«Dass nur Erfundenes sich der Wahrheit nähern kann, wolltest Du nicht glauben», sagt auch die Ich-Erzählerin in Hungers Roman. Sie ist Tochter von Militärattachés und lebt in England, Düsseldorf und in Spiegel bei Bern. Das Du in der Geschichte und stets an ihrer Seite: der titelgebende Niemand. Ein nicht näher beschriebener bester Freund, auch seine Eltern sind Offizier:innen.
Singen im Curling-Club
Stundenlang hören die Ich-Erzählerin und Niemand Musik vom Plattenspieler. Sie überschreiben Orte auf dem Weltatlas mit Namen von Bands. Die Protagonistin verballhornt Wörter, erfindet eigene Lieder – und Niemand hört zu. Dabei bedient sich Hunger mitunter einer sinnlichen Sprache: «Manchmal spielten wir hungrige Rattenwelpen, leckten an den kalten Eisenscharnieren und kratzten am Glas.» Regelmässig verkommen die beiden Kinder aber auch zu blossen Trägern gescheiter Gedanken und wirken entrückt. Dann, wenn die bretonische Cousine der Ich-Erzählerin behauptet, Vinylplatten würden mit jedem Hören «sukzessive abgetragen», und die beiden von einer existenziellen Wucht erfasst werden, sich gar mit einer «ersten Sterbeerkenntnis» konfrontiert sehen.
Anziehend, fast schon kathartisch mutet der Auftritt der neurotischen Klavierlehrerin Ladina Salis an. Mit ihr brüllt das Duo Dezibelzahlen heraus und wird hierfür auch mal in einen Skiraum des «Curling Clubs Belp-Moos» verlagert. Als die psychotische Lehrerin ein Klavier in den Kircheninnenhof stürzt, ist der Kontakt zur Aussenwelt wieder aufs Nötigste heruntergefahren. Durch die hermetische Abriegelung fällt es den Figuren schwer, Intimität zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Und auch die Leser:innen bleiben ausserhalb der Glasglocke; zu den Figuren entsteht eine spürbare Distanz.
Den zweiten Strang des Romans bildet eine Art Forschung. Jene zu den Walserinnen, diesem alemannischen und sagenumwobenen Bergvolk, von dem die Ich-Erzählerin abstammt. Und auch Autorin Sophie Hunger. Zeichnungen und Texte, im generischen Femininum verfasst, ziehen sich durch den Roman wie ein feministisch-archaisches Manifest: Es ist der in sich gekehrte Niemand, der die Walserinnen erkundet und die Beiträge verfasst.
Gegen rote Fäden
Dramaturgische Entscheidungen schlagen sich in der Erzählung nieder, die von der Jugend bis ins junge Erwachsenenalter reicht – und unter dem Gewicht literarischer Ambitionen ächzt. So wird eine bruchstückhafte Erzählweise mit der Haltung der Protagonist:innen erklärt, die keine stringenten Geschichten mögen: «Ein schauriges Gefühl erfüllte uns, wenn jemand versuchte, rote Fäden zu spannen, plausible Vergangenheiten und Zukünfte zu konstruieren.» An einer anderen Stelle lässt sich das Pathos der Sprache an ihrer Adoleszenz festmachen, in der sie «in einer prätentiösen Formulierungssucht gefangen» sind.
Dabei sind Hungers Sprachbilder eigentlich dann am schärfsten, wenn sie auf bedeutungsschwere Sätze einen plötzlichen Bruch in der Realität folgen lässt. In Form der erwachsenen Ich-Erzählerin, die mit Niemand auf Immobilienportalen ein Traumhaus sucht, mit «Mauern aus pflanzlicher Membran», die sich in ihrem «Gesamtvolumen» der Entwicklung der beiden anpassen würden. Und dann in eine dunkle Zweizimmerwohnung in Zürich Wiedikon zieht.
Längst bestreitet die Protagonistin jetzt Auftritte, sitzt mit Gitarre auf der Bühne, eine Öffnung zur Welt hin durch die Musik. Auch ein Auftritt im Club Bataclan in Paris steht bevor. Dort, wo auch Sophie Hunger am Anfang ihrer Karriere gespielt hat. Und der stille Begleiter? Magert ab, verkommt zum Schatten. Dass es mit dieser bröckelnden Beziehung nicht gut ausgehen kann: Daran zweifelt niemand. Daran, dass «Walzer für Niemand» einiges an enthusiastischem Beifall dem Hype um seine berühmte Autorin zu verdanken hat, auch nicht. Eines ist der Musikerin mit ihrem Künstlerinnenroman sicherlich gelungen: Sie hat erfolgreich den eigenen Mythos weitergeschrieben.