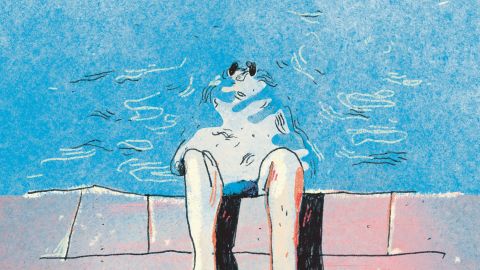Solidarität statt Leistung
Jede Gesellschaft braucht ihre Rechtfertigung, warum es Ungleichheit gibt. Während es zu Zeiten der Könige und des Adels der Wille Gottes war, glauben wir heute daran, dass wir Leistungsgesellschaften seien – und somit jede ihres Glückes Schmiedin. Doch dies ist ein Irrglaube. Und wichtiger noch: Es ist eine falsche Aspiration.
Das Narrativ der Leistungsgesellschaft individualisiert die Lebensgeschichte und macht uns dabei blind für wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen. Gleichzeitig finden all die historisch und sozial erwachsenen Ungleichheiten – wie etwa rassistische Zuschreibungen oder das Geschlecht – in der Leistungserzählung keinen Platz.
Privilegien oder Diskriminierungen, Glück oder Pech – all das gerät schnell in Vergessenheit. So werden die «Gewinner» überheblich, während die «Verlierer» in unsäglich schwierigen, oft unverschuldeten Situationen nichts weiter als Scham empfinden. Diese Überzeugungen sind falsch und zersetzen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn es macht einen himmelweiten Unterschied, ob ich Ungleichheit als ein strukturelles Phänomen begreife – ob ich anerkenne, dass jemand unverschuldet in Armut lebt – oder aber ob ich annehme, die «Verlierer» hätten sich einfach etwas mehr anstrengen müssen. Wer so denkt und fühlt, empfindet weniger Mitgefühl, die Solidarität schwindet. Genau das, so sagt der Philosoph Michael Sandel, macht die Leistungsgesellschaft zur Tyrannei.
Die Vorstellung einer Leistungsgesellschaft war ursprünglich eine dystopische Idee und basiert auf dem 1958 erschienenen Roman «The Rise of the Meritocracy» von Michael Young. Young zeichnet darin eine eiskalte und grausame Gesellschaft, in der es einzig auf die Intelligenz und die Anstrengung ankommt. 2001 äusserte der Autor seine Enttäuschung: «Das Buch war als Satire gemeint, die eine Warnung sein sollte. Vieles, was vorhergesagt wurde, wurde bereits Realität […] Mit einer erstaunlichen Anzahl von Zertifikaten und Abschlüssen hat die Bildung ihr Gütesiegel auf eine Minderheit gelegt und ihr Missbilligungssiegel auf die vielen, die von dem Zeitpunkt an, in dem sie im Alter von sieben Jahren oder früher auf die untersten Ränge verwiesen werden, nicht glänzen.»
Ferdinand von Schirach beschreibt treffend, dass wir als Gesellschaft «eine Ethik erschufen, die nicht den Stärkeren bevorzugt, sondern die Schwächeren schützt». Wenn wir aber konkurrieren, statt füreinander einzustehen, «fallen wir wieder zurück ins Dumpfe und Dunkle». Was uns im tiefsten Sinne menschlich macht, ist nicht die Leistung, sondern es ist unsere Solidarität – die schützende Hand über all jene, die Teil unserer Gesellschaft sind.
An dieser Stelle lesen Sie immer freitags einen Text von Martyna Berenika Linartas. Linartas forscht zu Vermögensverteilung und Umverteilung. Dazu lehrt sie in Berlin und in Koblenz. 2022 hat sie die Wissensplattform ungleichheit.info mitgegründet. Im Frühjahr 2025 erscheint ihr Buch «Unverdiente Ungleichheit. Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann».