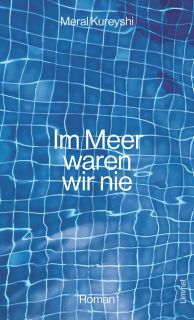Verschwinden, Verblassen, Lachen
Der Mann im Zugabteil nebenan, der sie offensichtlich interessiert und der ihr vor dem Aussteigen seine Nummer geben wird, ist dabei, ein Buch über das «mimetische Begehren» zu lesen. Die vom französischen Literaturwissenschaftler René Girard geprägte Theorie besagt, dass Begehren nicht etwas Ureigenes ist, sondern stets bei anderen abgeschaut und imitiert wird.
Tatsächlich kommt die namenlose Protagonistin dieser Geschichte erst auf die Idee, sie könnte dem Mann schreiben, als auch ihre beste Freundin Sophie einen neuen Lover hat. Doch da gerät sowieso wieder etwas in Bewegung in ihrem Leben. Sie bricht aus einer Art Limbus aus, einem Zustand ohne klares Begehren.
Meral Kureyshi, 1983 im Kosovo geboren und ausgebildet am Literaturinstitut in Biel, erzählt die Geschichte dieser Ich-Erzählerin in ihrem dritten Roman, «Im Meer waren wir nie». «Ich lebe zwischen den Sprachen in meinem Kopf», sagt die Erzählerin, deren Migrationsgeschichte angedeutet wird, aber nicht die zentrale Rolle spielt wie in Kureyshis gefeiertem Debüt «Elefanten im Garten» (2015).
Kureyshis neuer Roman handelt von Beziehungen, die sich der trennscharfen Unterteilung in familiär-zugefallene und freundschaftlich-gewählte entziehen. Die Protagonistin ist Ende dreissig und wohnt im selben Haus wie Sophie und deren Sohn Eric, den die Freundinnen ohne den gewalttätigen Vater aufziehen. Die andere wichtige Beziehung ist die zu Sophies Grossmutter Lili, die über neunzig ist und im Altersheim lebt.
Sophies Mutter Klara bezahlt die Protagonistin dafür, Lili Gesellschaft zu leisten. Das Arrangement ist zunächst rein ökonomisch, doch die Erzählerin entwickelt bald viel Liebe für die mit ihrem ständigen Klagen ziemlich anstrengende und doch sehr liebenswerte Lili – die bald sterben wird, wie der Roman zu Beginn verrät.
Es ist nur einer der Schatten, die auf dieser Geschichte liegen. Kureyshi erzählt von diesen Sorgebeziehungen nicht als einem feministischen Care-Utopia. Die Männer tauchen, wenn überhaupt, nur als zurückgelassene Liebhaber oder verstorbene Väter auf. Die Beziehung der Erzählerin zu Sophie ist angespannt, in ihre Gespräche mischen sich kleine Aggressionen. «Meinst du, wir wären noch befreundet, wenn wir Eric nicht hätten?», fragt sie Sophie einmal. Neben dem Kind hat eine lebendige Freundschaft kaum Platz.
Beziehungen geraten hier von ihrem Ende her in den Blick, es geht ums Verblassen und Verschwinden, um Entfremdung und Abschied. Trotzdem liest sich das nicht schwer. Die Sprache ist unaufgeregt poetisch, die Beobachtungen schimmern beiläufig. Es wird zudem auch viel gelacht, nur schon in diesem liebevoll geschilderten Altersheim und der Cafeteria als umkämpftem Dorfplatz. Da ist auch die verschobene Erna, die im Protest wieder mal ihre Medikamente abgesetzt hat – und Lili mit ihren sprunghaften Gedanken und Stimmungen, die ja manchmal fast etwas Psychedelisches haben.
Die Autorin liest in Solothurn am Sa, 31. Mai 2025, 13 Uhr, im Konzertsaal.