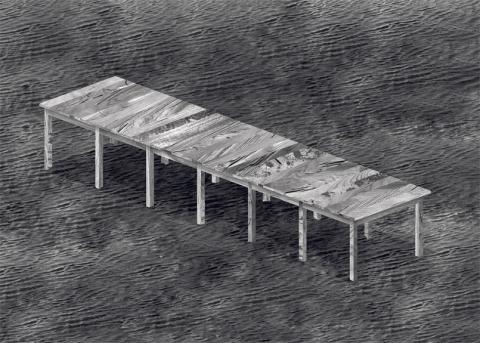Ethik: Selbstbestimmt bis zuletzt – im Sterben wie im Leben
In der Debatte um Sterbehilfe geht es meist um Autonomie und Freiheit. Doch was ist mit jenen, die im Leben nicht genug Unterstützung für ein lebenswertes Dasein erhalten?

Im März dieses Jahres sorgte das Sterben des Psychologen und Wirtschaftsnobelpreisträgers Daniel Kahneman für mediales Aufsehen – ein Jahr nach seinem Tod. Ein Artikel im «Wall Street Journal» machte publik, was zuvor nur engsten Vertrauten bekannt gewesen war: dass der damals Neunzigjährige in der Schweiz Suizidhilfe beanspruchte, obwohl er bei relativ guter Gesundheit war. In einem Abschiedsmail hatte Kahneman ihnen seine Beweggründe dargelegt: «Meine Nieren gehen auf dem Zahnfleisch, die Häufigkeit meiner mentalen Aussetzer nimmt zu, und ich bin neunzig Jahre alt. Es ist Zeit zu gehen.»
Kahneman war weder auf Dialyse angewiesen, noch erkannten Nahestehende beim bis zuletzt produktiven Wissenschaftler Anzeichen eines stärkeren kognitiven Verfalls. Dass ihnen der Zeitpunkt verfrüht erscheinen musste, war ihm bewusst. Er habe ihn aber gerade deshalb gewählt, um einen Zustand zu vermeiden, in dem er sein Leben als nicht mehr «verlängerungswürdig» erachtet hätte. Schon als Teenager sei er der Ansicht gewesen, dass «die Qualen und Demütigungen der letzten Lebensjahre überflüssig sind», nun handle er entsprechend: Er sei «noch immer aktiv, geniesse viele Dinge im Leben», schrieb Kahneman, und werde «als glücklicher Mensch sterben».
Was gilt als «vollendetes Leben»?
Seinen Suizid erachtete Kahneman als rein persönliche Angelegenheit und verbat sich eine politische Vereinnahmung. Sicherlich war ihm klar, wie sehr sich die «letzte Entscheidung des weltweit führenden Denkers über Entscheidungen» (so der Titel im «Wall Street Journal») dafür anbieten würde. In einem Meinungsartikel für die «New York Times» orteten die utilitaristischen Philosoph:innen Katarzyna de Lazari-Radek und Peter Singer denn auch «eine Lektion», die es aus seinem Tod «zu lernen» gebe: «Wenn wir gut bis zum Ende leben wollen, müssen wir offen darüber sprechen können, wann ein Leben als vollendet gilt.» Komme eine Person «nach reiflicher Überlegung» für sich zu diesem Schluss und bleibe über längere Zeit davon überzeugt, sei «sie selbst am besten in der Lage, zu beurteilen, was gut für sie ist». Eine solche «Wahl» sei zu «respektieren», und es solle dieser Person erlaubt sein, ihr Leben «in Würde zu beenden».
Kahnemans Fall fügt sich damit in eine Debatte ein, die in den Niederlanden seit den neunziger Jahren über den Begriff «vollendetes Leben» («voltooid leven») geführt wird. In der Schweiz brachte die Sterbehilfeorganisation Exit das Thema 2008 und verstärkt ab 2014 unter dem Label «Altersfreitod» aufs Tapet. Gemeint ist das Recht betagter Menschen, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand Suizidhilfe zu erhalten, wenn ihr Leben ihnen subjektiv keine Perspektive mehr bietet. Dieses neue Sterbehilfeparadigma speist sich aus einem spätmodern-neoliberalen Subjektverständnis: Im Zentrum stehen die Prinzipien Autonomie und Freiheit, aus denen die Vorstellung erwächst, dass alle Aspekte des Lebens gestaltbar sein sollten – getrieben vom Impuls, bis zuletzt die Kontrolle zu behalten. Dem Suizid liegt dabei eine utilitaristische – ein Freund Kahnemans nannte sie «hedonistische» – Abwägung zugrunde: zwischen einer Perspektive, die als lebenswert gilt, und einer solchen, die als schlimmer als der Tod erscheint. Überwiegt Letztere, soll der assistierte Suizid vorsorglich als Dienstleistung bereitstehen.
Dieses Selbstbestimmungsnarrativ dominiert auch in literarischen und filmischen Werken zum Thema. Bereits ein Jahr nachdem Exit die Debatte um den Altersfreitod lanciert hat, erscheint Ueli Oswalds autobiografisches Buch «Ausgang. Das letzte Jahr mit meinem Vater» (2009). Der Autor möchte darin Verständnis für den assistierten Suizid seines nicht schwer kranken Vaters schaffen, indem er ihn als rationalen Schritt eines «lebenssatten» Menschen darstellt. Der prominente frühere Manager Heinrich Oswald (Knorr, Ringier) war im selben Alter wie Kahneman, litt körperlich aber bereits stärker unter den «Qualen und Unwürdigkeiten», die dieser vermeiden wollte.
Ausweitung des Rechts
Auch wenn Exit die Begleitung kerngesunder Menschen ethisch befürwortet, übt die Organisation diesbezüglich noch Zurückhaltung – weil die gesellschaftliche Bereitschaft dafür noch nicht gegeben sei. Dies betonte Exit-Präsidentin Marion Schafroth unter anderem in der SRF-«Club»-Diskussion im Anschluss an die Erstausstrahlung von «Gott» (2020), der Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Ferdinand von Schirach. Darin fordert der völlig gesunde 78-jährige Protagonist das Recht auf Sterbehilfe, da er sein Leben nach dem Tod seiner Frau als vollendet betrachtet. Die Publikumsabstimmung im Anschluss an die zahlreichen Aufführungen des Stücks gab seinem Ersuchen in der Regel klar statt – zumindest ein Indiz für die wachsende gesellschaftliche Akzeptanz des Altersfreitods.
Angesichts der Tatsache, dass der assistierte Suizid zunehmend als Ausdruck autonomer Persönlichkeitsentfaltung verstanden wird, erscheint die Ausweitung des Rechts konsequent. Doch das Autonomie- und Freiheitsverständnis, das den Debatten zugrunde liegt, ist ideologisch konstruiert und reduktionistisch. Individuelle Entscheidungen entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern im Wechselspiel mit sozialen, materiellen und kulturellen Faktoren. Zu Letzteren gehören auch Erzählungen, die den Altersfreitod als nachvollziehbaren Entscheid zur Vermeidung eines nicht «verlängerungswürdigen» Lebens inszenieren. Abstrahiert man vom Einzelfall, transportieren sie ein klares Werturteil: Nur ein beschwerdefreies, selbstständiges und aktives Leben gilt als lebenswert.
Tatsächlich fällt die Zustimmung zum Recht gesunder Menschen auf Sterbehilfe deutlich höher aus, wenn es sich um ältere Personen handelt. Dahinter stehen tief verankerte ageistische Vorurteile und Stereotype: das Alter als Phase des Defizits, der Abhängigkeit und der fehlenden Produktivität. Solche Bilder werden im Lauf des Lebens verinnerlicht. Die Vorstellung etwa, eine Last für Familie und Gesellschaft zu sein oder mit dem Verlust der Selbstständigkeit auch die eigene Würde zu verlieren, kann als internalisierter Ageismus das Suizidrisiko erhöhen.
Der privilegierte Blick
Kahneman, Heinrich Oswald und von Schirachs Protagonisten verbindet nicht nur ihr Alter, sondern auch ihre hohe Bildung und ihre privilegierte sozioökonomische Position. In ihrem Fall lässt sich der assistierte Suizid durchaus als Ausdruck persönlicher Autonomie begreifen – sie verfügten über Wahlfreiheit in Bezug auf ihr Lebensende. Was jedoch ausgeblendet wird in den Debatten, die meist auf individuelle Freiheit fokussieren, sind soziale und materielle Ungleichheiten. Wahlfreiheit setzt voraus, zwischen gleichermassen realisierbaren Optionen zu entscheiden. Wie selbstbestimmt aber ist ein Sterben, wenn die Alternative – das Leben – durch gesellschaftliche Bedingungen unerträglich wird? Wenn Betroffene nicht jene Unterstützung erhalten, die ein lebenswertes Dasein ermöglichen würde? Während der assistierte Suizid bei einem subjektiv unerträglichen Leiden zugänglich ist, gibt es keinen Rechtsanspruch auf angemessene Pflege- und Unterstützungsleistungen, die das Leiden womöglich lindern könnten. Gerade in diesen Bereichen herrscht zudem ein chronischer Spardruck – und besonders betroffen sind vulnerable Gruppen, darunter nicht nur Betagte, sondern auch Menschen mit Behinderung.
In der Schweiz ist es seit Jahrzehnten so, dass eine «unzumutbare Behinderung» zum assistierten Suizid berechtigt. Die Gefahr jedoch, die sich aus mangelnder Versorgung und ableistischen Werturteilen ergibt, wird im Diskurs kaum thematisiert. Anders im angelsächsischen Raum, wo zwei Menschen mit Behinderung diese Perspektive jüngst durch Dokumentarfilme in die Debatte einbrachten: «Better Off Dead?» (2024) von Liz Carr und «Life After» (2025) von Reid Davenport. Durch verschiedene Fallgeschichten aus den USA und Kanada zeigen sie auf, dass Menschen mit Behinderung immer wieder Sterbehilfe wählen, weil sie unzureichende Unterstützung erhalten, sich gesellschaftlich isoliert und als Last fühlen.
Beide Filme legen auch ableistische Narrative in Kunst und Medien offen. «Better Off Dead?» nimmt etwa die Romanverfilmung «Me Before You» (2016) in den Blick. In diesem Spielfilm entscheidet sich ein junger Tetraplegiker, sein Leben trotz Reichtum, bestmöglicher Pflege und Liebe zu beenden. Durch das hinterlassene Vermögen ermöglicht er der nichtbehinderten Protagonistin ein Leben in Freiheit. Liz Carr, die mit der seltenen Erkrankung Arthrogryposis multiplex congenita geboren wurde, erkennt darin ein Beispiel für eine «Glorifizierung unserer Wahl, zu sterben».
Jenseits der medialen Zerrbilder
Wie wenig eine solche Glorifizierung auf die Fiktion beschränkt bleibt, zeigt Davenports Film, der am diesjährigen Sundance Festival mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde. Eine der Geschichten in «Life After» ist diejenige von Jerika Bolen aus Wisconsin, die an spinaler Muskelatrophie erkrankte. Für die Vierzehnjährige fand dann ein ganzes Städtchen zusammen, um einen Abschlussball zu veranstalten – nicht etwa, um ihren Abgang von der Highschool zu feiern, sondern die Beendigung ihres Lebens, in dem ihr soziale Teilhabe sowie vermutlich auch eine angemessene Schmerzbehandlung fehlten. Während der Tod junger Menschen normalerweise als Tragödie gilt, offenbart die Feier das zutiefst ableistische Vorurteil, dass ein früher Tod weniger schwer wiegt als ein Leben mit Behinderung.
Ausgangspunkt und Haupterzählstrang von «Life After» ist der Fall der Kalifornierin Elizabeth Bouvia, die wie der Regisseur mit infantiler Zerebralparese lebte. Die Medien begleiteten ihren Kampf für das Recht auf Suizidbegleitung in den achtziger Jahren verständnisvoll bis bewundernd und reduzierten ihn auf ihre Behinderung. So hiess es wiederholt, sie sei «gefangen in einem nutzlosen Körper».
Davenport zeichnet ein differenzierteres Bild jenseits der medialen Figur der entschlossenen Sterbewilligen. Im Film zeigt er Bouvia als lebensbejahende junge Frau, die medizinische Sozialarbeiterin werden wollte, das College aber desillusioniert verliess, nachdem ein Professor ihr die Eignung abgesprochen hatte. Sie heiratete und wurde schwanger, verlor das Kind jedoch und trennte sich nach unglücklicher Ehe. Erst danach schwand ihr Lebenswille. Der Film offenbart auch, welchen strukturell-ableistischen Verletzungen Elizabeth Bouvia bereits als Kind und Jugendliche ausgesetzt war: ein medikalisierter Blick auf Behinderung als zu korrigierendes Defizit, schmerzhafte und nutzlose Operationen, die daraus folgten, sowie die Einweisung in eine Institution für Menschen mit Behinderung und damit die Trennung von ihrer Familie.
Inklusion statt Segregation
Den letzten Punkt greift Davenport eindringlich auf, wenn er «Segregation» als Teil des Traumas von Menschen mit Behinderung bezeichnet – und Institutionalisierung bedeute «absolute Segregation». Das daraus resultierende Leiden illustriert er auch mit dem Fall des Kanadiers Michal Kaliszan, der durch seine spinale Muskelatrophie auf Vollzeitpflege angewiesen ist. Diese wurde hauptsächlich von seiner Mutter geleistet, die ihm dadurch ein Leben im eigenen Haus ermöglichte. Mit ihrem Tod entfiel diese Care-Leistung, die Kosten für eine professionelle Pflege zu Hause hätten die finanziellen Möglichkeiten des damals 39-jährigen Softwareentwicklers bei weitem überstiegen. Was das Gesundheitssystem ihm 2023 offerierte: elf Stunden Pflege – pro Woche. So stand Kaliszan vor der Wahl, für den Rest des Lebens in eine Einrichtung eintreten und seine Selbstständigkeit aufgeben zu müssen oder Sterbehilfe zu beanspruchen – Letzteres nennt er «das kleinere Übel». Glück im Unglück: Sein Gesuch auf Sterbehilfe konnte wegen der Überlastung durch zu viele Anträge monatelang nicht bearbeitet werden. Zwei provisorische Finanzierungsprogramme für häusliche Pflege ermöglichen ihm seit letztem Jahr zumindest vorläufig ein selbstbestimmtes Leben mit sozialer Teilhabe. Nun kann er nur hoffen, dass diese Unterstützung dauerhaft wird.
Wie die Dokumentarfilme «Better Off Dead?» und «Life After» zeigen, ist es oft nicht primär die Behinderung, die zum Sterbewunsch führt, sondern eine Verschlechterung der Lebensumstände. Während bei nichtbehinderten Menschen hier in der Regel Suizidprävention greift, weil etwa der Verlust der Partnerin oder des Arbeitsplatzes nicht als legitimer Grund für Suizidhilfe gilt, qualifizieren sich Menschen mit Behinderung in jeder Lebensphase dafür – auch in akuten Krisen. Liz Carr, die selbst Zeiten der Perspektivlosigkeit durchlebt hat, beschreibt dies als «permanentes Damoklesschwert». Auch Reid Davenport erinnert sich an dunkle Momente in seinem Leben. Vor der Kamera füllt er probeweise den Antrag auf Sterbehilfe in Kanada aus – und erfüllt die Kriterien «mit Bravour». Er fragt sich, wie er sein Leben heute beurteilen würde, wenn er nicht über stabile Unterstützung, eine Familie, eine Partnerin und Freund:innen verfügte. Die Sterbehilfe jedenfalls stünde ihm offen.
Im Einzelfall mag der assistierte Suizid eine legitime Möglichkeit sein, nach einem selbstbestimmten Leben auch den Zeitpunkt zu dessen Beendigung zu wählen – wie im Fall von Daniel Kahneman, der seinen Suizid wohl auch deshalb als Privatsache verstand. Für andere jedoch birgt die zunehmende gesellschaftliche Normalisierung der Sterbehilfe eine reale Gefahr: dann nämlich, wenn ein Leben mit Einschränkungen immer weniger als lebenswert gilt – und diese Vorstellung als internalisierter Ableismus oder Ageismus wirksam wird.
Besonders kritisch wird es dort, wo zugleich die materiellen Voraussetzungen für ein gutes Leben fehlen. Und so stellt sich die Frage: Besteht der höchste Ausdruck von Autonomie und Selbstbestimmung des spätmodernen Menschen tatsächlich darin, den Zeitpunkt des eigenen Sterbens zu wählen? Oder liegt die eigentliche Vision nicht vielmehr in einem Leben, das für alle gleichermassen barrierefrei möglich ist? Erst wenn echte Wahlfreiheit bis zum Ende des Lebens besteht, kann auch das Lebensende wirklich selbstbestimmt sein.
Marc Keller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt «Assisted Lab» an der Universität St. Gallen. Der Germanist hat an der Universität Bern über «Sterbehilfe als Liebestod in Literatur und Film der Gegenwart» promoviert.
Haben Sie Suizidgedanken? In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die für Menschen in solchen Krisen da sind. Für Erwachsene: Die Dargebotene Hand, Telefon 143. Für Kinder und Jugendliche: Telefon 147 und www.147.ch.
Inklusions-Initiative: Was die Statistik verschleiert
Auch in der Schweiz ist für Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben nicht garantiert. Zwar besteht auf Bundesebene ein Anspruch auf einen Heimplatz, die Unterstützungsleistungen für das Leben zu Hause sind dagegen kantonal geregelt – und zumeist unzureichend.
«Weil Menschen mit Behinderung nicht die freie Wahl haben, ein Leben nach ihren Vorstellungen zu führen wie alle anderen Bürger:innen, kann der Leidensdruck sehr hoch sein», sagt Raphaël de Riedmatten, Geschäftsführer von Agile, dem Schweizer Dachverband der Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen. Zudem seien die administrativen Hürden für den Assistenzbeitrag für viele zu hoch, der Beitrag selbst oft zu niedrig. Die Inklusions-Initiative will das nun ändern: Sie fordert, den Anspruch auf angemessene Unterstützung und Wahlfreiheit der Wohnform gesetzlich zu verankern. Die Initiative wurde im September 2024 eingereicht, der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats befindet sich derzeit in der Vernehmlassung.
Tatsächlich sollte sich eine Gesellschaft, die ein «selbstbestimmtes Sterben» ermöglicht, ebenso dazu verpflichten, Selbstbestimmung im Leben zu gewährleisten – und verhindern, dass Menschen in Situationen geraten, die ihnen im äussersten Fall den Lebenswillen nehmen; Menschen, die gleichzeitig potenziell unter dem Radar der Suizidprävention bleiben. Denn entscheidet sich eine Person mit Behinderung für Sterbehilfe, führt die Statistik ihre Beeinträchtigung als Motiv – nicht die Barrieren, die das Leben überhaupt erst unerträglich gemacht haben.