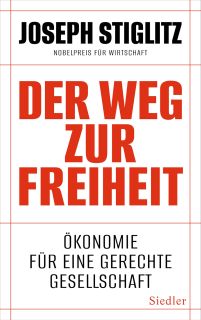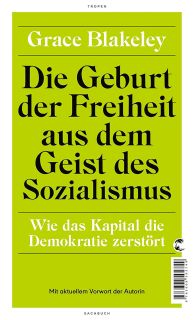Politische Ökonomie: Von Freiheit keinen Plan
Der US-Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz und die englische Publizistin Grace Blakeley schlagen Schneisen in die libertäre Begriffsvernebelung.
Ökonomisch stehen die Zeichen seit dem Amtsantritt Donald Trumps auf Sturm: Die Zollpolitik des US-Präsidenten sowie seine Steuersenkungspläne trotz hohen Haushaltsdefizits haben an den Börsen für Turbulenzen und vergangene Woche auch zur Herabstufung der Kreditwürdigkeit Washingtons geführt. US-Anleihen sind keine «Triple A»-Ware mehr – ein Imageschaden für die Weltmacht oder auch Vorbote einer baldigen Krise.
Dass es so weit gekommen ist, wird Joseph Stiglitz kaum überraschen. Der US-Ökonom zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Kritiker:innen des Neoliberalismus, also einer marktradikalen Wirtschaftspolitik. Noch immer kommentiert der mittlerweile 82-jährige Nobelpreisträger eifrig das Tagesgeschehen; an Trump und dessen Clique lässt er dabei erwartungsgemäss kein gutes Haar. Deren Klientelpolitik könnte gar zu einer Stagflation führen, warnte er neulich, also zum Einbruch des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Inflation. Dieses Szenario ist unter Ökonom:innen gefürchtet, weil ihm mit gängigen Massnahmen nur schwer beizukommen ist.
Rechtsliberaler Fetisch
Stiglitz zuletzt auf Deutsch erschienenes Buch kreist jedoch nicht primär um den Trumpismus, sondern arbeitet die längerfristigen Ursachen der aktuellen Misere heraus. Der Titel deutet es an: «Der Weg zur Freiheit» ist eine Anspielung auf Friedrich August von Hayeks Schrift «Der Weg zur Knechtschaft» (1944), einen der Grundlagentexte des Neoliberalismus, der in der «New Deal»-Ära staatliche Eingriffe in die Wirtschaft per se als freiheitsfeindlich verwarf. Längst ist «freedom» für die US-Rechte (und für Rechtsliberale überall) zum Fetisch geworden, dies allerdings in einer speziellen Auslegung. Dagegen will Stiglitz das Konzept für ein sozialdemokratisches Projekt, das eine solidarische und damit wirkliche Freiheit ermöglichende Gesellschaft anstrebt, zurückgewinnen.
Ins Visier gerät also der Kern der Ideologie Rechtslibertärer: Sie setzen individuelle Freiheit absolut, etwa wenn es um das Recht auf Waffenbesitz oder freie Meinungsäusserung geht. Letztere wird in den USA mittlerweile so grosszügig ausgelegt, dass darunter selbst Grossspenden an Parteien fallen – was die Frage aufwirft, ob Vermögende nicht deutlich mehr Freiheiten geniessen, politische Wirksamkeit zu entfalten, als etwa prekär Beschäftigte.
Entsprechend beginnt Stiglitz mit einem Satz des britischen Philosophen Isaiah Berlin: «Die Freiheit der Wölfe hat oftmals den Tod der Schafe bedeutet.» Dass die Rechte nicht begreifen wolle, «dass die Freiheit des einen die Unfreiheit des anderen ist», sei deren «grundlegendster philosophischer Fehler». «No man is an island, entire of itself», zitiert er eine schöne Zeile des frühneuzeitlichen Dichters John Donne, Freiheit müsse «im sozialen Zusammenhang gesehen werden». Was folgt, ist aber nicht eine philosophische Abhandlung, Stiglitz bedient sich einschlägiger Positionen (derjenigen von John Rawls etwa) eher strategisch. Seine Stärke liegt im Ökonomischen.
Vieles von dem, was der Wirtschaftswissenschaftler dabei zusammenträgt, ist bekannt. Trotzdem ist das Buch in der Summe ein hervorragendes Argumentarium wider die gängigen Behauptungen Wirtschaftsliberaler. Im Zentrum steht der Nachweis, dass Märkte keineswegs so effizient sind, wie es neoliberale Ökonom:innen unterstellen. Empirisch zeigt sich dies etwa durch wiederkehrende Krisen.
Diese sind ein schlagendes Beispiel für das Versagen des Markts, ein weiteres wäre ein eingeschränkter Wettbewerb, sobald Firmen so viel Marktmacht erlangt haben, dass sie Preise setzen können. Gerade in der Techindustrie lassen sich die Folgen von ungezügelter Marktmacht beobachten: Es ist mittlerweile klar, dass Google Abstriche bei der Qualität seiner Suchmaschine macht, um Werbegewinne zu maximieren. Ein chronisches Problem ist zudem, dass die Grösse von Plattformen wie Facebook das Auftreten neuer Mitbewerber von vornherein verunmöglicht.
«Progressiver Kapitalismus»
Stiglitz’ Buch bietet noch viel weiteres Rüstzeug für die Debatte. Beispielsweise wenn er daran erinnert, dass schon der liberale Säulenheilige Adam Smith skeptisch war, was politische Ratschläge von Geschäftsleuten angeht: Diese seien stets von ihrem Eigeninteresse gesteuert. Oder wenn er hinsichtlich des Austeritätsdogmas vorrechnet, dass schuldenfinanzierte Investitionen oftmals enorm renditeträchtig sind, eine Sparpolitik folglich ein Land verarmen lässt. Oder auch wenn er die Patentierung geistigen Eigentums als «Einhegung intellektueller Allmenden» zum Schaden der Gesellschaft interpretiert.
Unterm Strich läuft Stiglitz’ Gegenentwurf auf einen «progressiven Kapitalismus» hinaus, in dem der Wohlfahrtsstaat ausgebaut wird, die Rechte von Beschäftigten gestärkt und Konzerne sowie Banken streng reguliert werden. Das soll die «Machtverhältnisse in allen Dimensionen unserer Gesellschaft» neu ausbalancieren und die Freiheit der Durchschnittsbürgerin auf Kosten derjenigen Vermögender erweitern.
Dieses Programm ist sicher nicht neu, was aber nichts an der Vermutung ändert, dass wir alle besser dran wären, würden die Regierenden mehr auf Fachleute vom Schlage des Nobelpreisträgers hören. Dieser Eindruck wiederum deutet darauf hin, dass auch in dessen Analysen etwas im Argen liegt: Er betrachtet die gesellschaftliche Entwicklung tendenziell durch die Brille des Technokraten. Vielsagend daher, dass Stiglitz nirgends von Klassen und deren Kämpfen spricht.
Ganz anders sieht das bei Grace Blakeley aus. Von der britischen Publizistin ist ebenfalls ein neues Buch auf Deutsch erschienen. In «Die Geburt der Freiheit aus dem Geist des Sozialismus» versucht sie wie Stiglitz, den neoliberalen Begriffsnebel zu lichten. Ihr geht es um den Nachweis, dass die gängige Gegenüberstellung von Markt- und Planwirtschaft in die Irre führt: Vielmehr seien kapitalistische Ökonomien «Hybridsysteme aus Markt- und Planwirtschaft».
Zwar sei die Existenz von Märkten «zwingender Bestandteil jeder kapitalistischen Gesellschaft», definiert werde diese aber dadurch, dass es auf der einen Seite Kapitaleigentümer:innen gebe und auf der anderen diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssten. Klassenauseinandersetzungen sind für Blakeley also gerade der Dreh- und Angelpunkt des Kapitalismus. Die entscheidende Frage laute daher nicht: Markt oder Staat? Sondern: Wer hat die Macht, den Wirtschaftsprozess zu steuern, und wer nicht?
Dass seit jeher kapitalistische Planung existiert, zeigt allein schon, dass es in Unternehmen keinen internen Markt gibt. Blakeley zitiert eine Studie zum US-Supermarktriesen Walmart: Dieser sei ein «faszinierendes Beispiel» dafür, «wie neue Technologien zentralisierte Planung in grossem Massstab innerhalb von marktwirtschaftlichen Gesellschaften ermöglichen». Bei Firmen wie Amazon dürfte das kaum anders sein.
Zugleich ist auch makroökonomisch «freier» Wettbewerb viel weniger bedeutend als gern behauptet. Da sind zum einen enorme Konzentrationsprozesse, die Marktmechanismen ausser Kraft setzen. Zum anderen sind Konzerne oft eng mit dem Staat verzahnt, was Blakeley anhand der Beispiele Boeing oder Ford demonstriert. Ein weiterer Beleg wäre die protektionistische Politik Washingtons in Sachen Mikrochips und KI.
Autoritäre Freiheitsfreunde
Wie Stiglitz schafft Blakeley damit mehr Klarheit in der Debatte. Am Ende stellt sich allerdings die Frage, ob der Wirkmächtigkeit einer solchen Kritik mittlerweile nicht enge Grenzen gesetzt sind. Immerhin dürften sich die autoritären Freiheitsfreunde von heute – Leute vom Schlage Trumps oder des argentinischen Präsidenten Javier Milei – wenig um den «zwanglosen Zwang des besseren Arguments» scheren.
Auch deswegen unterstreicht Blakeley anhand zahlreicher, teilweise historischer Beispiele, wie bedeutend Initiativen sind, sich zu organisieren – von der Gewerkschaft über die Genossenschaft bis hin zum Zusammenschluss für lokale Anliegen. Freiheit ist nicht nur ein theoretisches Problem. Die Schafe müssen sie sich gemeinsam gegen die Wölfe erstreiten.