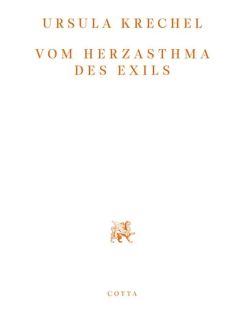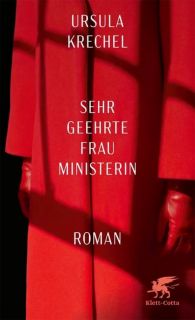Literatur: Anschreiben gegen die «verheerte Welt»
Die Autorin Ursula Krechel wird für ihr Lebenswerk mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.

und rebellische Texte. Foto: Heike Steinweg
«Ein Nein zur Migration ist ein Ja zum Rassismus.» Das ist das Fazit des diesen Sommer erschienenen Essays von Ursula Krechel. Dessen Titel «Vom Herzasthma des Exils» deutet an, dass es der Autorin nicht nur um die Haltung des Einwanderungslands geht. Sie will auch begreiflich machen, wie sich Exilant:innen in der Fremde fühlen. Sie erzählt von Karl Marx, von vertriebenen Künstlern, aber auch von den vielen Armutsmigrant:innen, die im 19. Jahrhundert Deutschland (und auch die Schweiz) verliessen. Krechel schildert eindringlich das Elend der Flüchtenden damals und heute; sie zählt die Toten und widerlegt falsche Behauptungen der aktuellen Migrationspolitik. Ihre Haltung ist klar: Das Menschenrecht auf Asyl ist nicht verhandelbar.
Ursula Krechel ist eine politische Autorin. 1947 in Trier geboren, studierte sie Theaterwissenschaft in Köln und arbeitete zunächst als Dramaturgin. 1974 veröffentlichte sie ihr Theaterstück «Erika», das von einem missglückten Ausbruchsversuch einer Frau aus einer bedrückenden Existenz handelt. Die Empörung über die Unterdrückung der Frauen zieht sich durch ihr Werk. 1975 erschien «Selbsterfahrung und Fremdbestimmung. Bericht aus der neuen Frauenbewegung»; vierzig Jahre später «Stark und leise. Pionierinnen», eine Sammlung von Porträts starker Frauen von Christine de Pizan bis Annemarie Schwarzenbach. In ihrem Anfang Jahr erschienenen Roman «Sehr geehrte Frau Ministerin» erzählt sie von Gewalt gegen Frauen in der Antike und heute, von brutalem Mord, aber auch von der Entmündigung, wenn einer Person die Möglichkeit genommen wird, für sich selbst zu sprechen.
Nicht mit Schalldämpfer husten
Immer schon war Ursula Krechel auch Lyrikerin. Fünfzehn Gedichtbände sind von ihr erschienen, der erste 1977. «Nach Mainz!» versammelt neben Auseinandersetzungen mit ihrer Herkunft auch witzige und rebellische Texte. So heisst es etwa in «Umsturz»:
«[…] ich hust nicht mehr mit Schalldämpfer / hab keinen Bock / meine Tinte mit Magermilch zu verwässern / ich hock nicht mehr im Nest, versteck / die Flatterflügel, damit ihr glauben könnt / ihr habt sie mir gestutzt. Den leeren Käfig / stellt mal ins historische Museum / Abteilung Mensch weiblich.»
Die «verheerte Welt» nach dem Nationalsozialismus wurde zu Krechels zentralem Thema. Der Begriff verweist auf ein Gedicht von Ingeborg Bachmann. Auch die Jury des Georg-Büchner-Preises 2025, der Krechel am 1. November in Darmstadt verliehen wird, greift das Wort in ihrer Begründung auf: «Mit ihr zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung eine Autorin aus, die in ihren Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen, Romanen und Essays den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegensetzt.»
Den grössten Bekanntheitsgrad erreichte Ursula Krechel mit den Romanen ihrer Exiltrilogie. 2008 erschien «Shanghai fern von wo» über deutsche und österreichische jüdische Geflüchtete, die es nach Südchina verschlug. Das Buch basiert auf jahrelanger Recherche, Gesprächen mit Überlebenden sowie deren eigenen Aufzeichnungen. Ebenso ihr erfolgreichster Roman, «Landgericht», der 2012 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und später verfilmt wurde. Der Jurist Richard Kornitzer, dem 1933 vom NS-Staat jede Arbeitsmöglichkeit entzogen wurde, kehrt 1945 aus dem Exil nach Deutschland zurück. Die französische Besatzungsmacht beruft ihn ans Landgericht Mainz, eine Art Wiedergutmachung. Aber er wird von seinen in Deutschland gebliebenen Kollegen geschnitten, die Vermieter neiden ihm seine erhöhte Kohlenzuteilung, die Kinder, die nach England in Sicherheit gebracht wurden, wollen nicht mehr zu ihren Eltern zurückkehren: Nichts wird wieder gut.
Lebenswege im Widerstand
Die Situation der Rückkehrer:innen, ihre Nichtzugehörigkeit und Einsamkeit ist auch in Krechels aktuellem Essay ein wichtiges Thema. Meistens sind sie nicht willkommen, oft wird ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie es «draussen» ja leicht gehabt hätten. Die von Hitler verfügten Ausbürgerungen wurden nicht etwa automatisch rückgängig gemacht. Von den gezwungenermassen Staatenlosen wurde ein Einbürgerungsantrag verlangt, den sie bezahlen mussten. Wenn es sich bei den Exilant:innen um Sinti:zze handelte, wurden sie zunächst manchmal auch abgewimmelt.
Das Schicksal der Sinti:zze und Rom:nja im Nationalsozialismus ist schliesslich Thema in Krechels drittem Exilroman, «Geisterbahn». Darin schildert sie am Beispiel der Schaustellerfamilie Dorn, wie die Sinti:zze zuerst ausgegrenzt, dann verfolgt, viele auch in Vernichtungslagern umgebracht wurden. Parallel dazu zeichnet die Autorin Lebenswege von Menschen im Widerstand nach und von jenen, die dem System dienten. Nach dem Krieg treffen die Überlebenden auf die Täter, die sich eifrig reinwaschen, und erleben wieder die alte Ausgrenzung.
In den Romanen der Exiltrilogie wie auch im neuen Essay zeigt sich beeindruckend Ursula Krechels Kunst, Detailgenauigkeit und Atmosphärisches, Polemik und empathische Figurenzeichnung zu verbinden.