Auf allen Kanälen: Bittere Pointe
Donald Trump hat den US-Auslandssendern die Gelder gekürzt. Auch einem geschichtsträchtigen Kanal, der einst eine Stimme der Hoffnung hinter dem Eisernen Vorhang war.
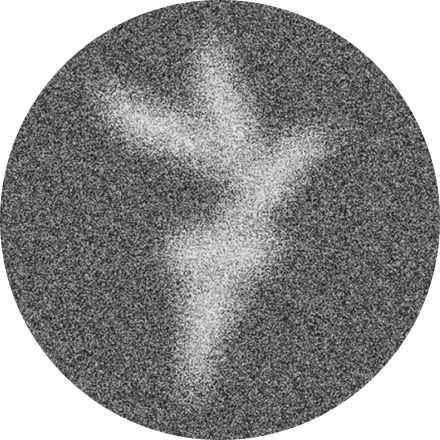
Das Bild gehört zu meinen frühsten Kindheitserinnerungen: mein Vater, wie er in unserer Moskauer Küche so lange am Regler des Weltempfängers schraubt, bis das Rauschen des Störsenders einer Stimme weicht. Ende der Achtziger war das, in einer Zeit, als viele in der Sowjetunion vom Aufbruch träumten. Der Sender, für den mein Vater immer wieder aufs Neue die Zensur überlistete, nannte sich Radio Swoboda (Radio Freiheit). Damals galt er als «Stimme des Feindes», weil er von den USA finanziert wurde. Für viele im sowjetischen Raum war er vor allem eine Stimme der Hoffnung – und eine des Protests.
75 Jahre nach seiner Gründung steht der geschichtsträchtige, heute aus Prag sendende Kanal vor dem Aus. Am Wochenende verfügte US-Präsident Donald Trump die Kürzung der Gelder für die United States Agency for Global Media – die Behörde, der alle staatlich finanzierten Auslandssender unterstehen, darunter auch der Doppelsender RFE/RL, zu dem Radio Free Europe (RFE) und Radio Liberty (RL) verbunden sind. Dessen Kanäle umfassen heute längst auch TV-Sender, Youtube-Kanäle, Onlinebeiträge und Podcasts. Sie berichten nach eigenen Angaben in 27 Sprachen und erreichen so wöchentlich knapp 50 Millionen Menschen in 23 Ländern im östlichen Europa und dem Kaukasus, in Zentralasien und dem Nahen Osten. Nachrichten für Länder, in denen die Pressefreiheit unter Druck, freie Berichterstattung kaum möglich ist.
Elon Musk nennt das Medienunternehmen «linksradikal»; in Trumps Augen ist es bloss «radikale Propaganda». Der Chef von RFE/RL sprach nach dem Präsidialerlass von einem «grossen Geschenk an die Feinde Amerikas»: «Die iranischen Ajatollahs, Chinas kommunistische Führer und die Autokraten in Moskau und Minsk können sich über das Verschwinden nur freuen.»
Unzensiertes Gegenprogramm
Ihren Anfang nahmen die beiden Sender zu Beginn des Kalten Krieges, finanziert vom damals noch jungen Geheimdienst CIA. Als der Eiserne Vorhang Europa entzweite, strebten die USA weiter nach Einfluss im Osten. Ab 1951 sendete RFE von München aus per Kurzwelle in fünf Länder Ostmitteleuropas. Zwei Jahre später nahm RL mit Fokus auf die Länder der Sowjetunion seinen Betrieb auf.
Geflüchtete aus diesen Ländern, so die Idee, sollten ihre Landsleute mit einem unzensierten Gegenprogramm zur staatlichen Propaganda versorgen: berichten, was die Mächtigen unter dem Teppich halten wollten, aber auch westliches Gedankengut verbreiten. Dazu kamen Musik oder Texte prominenter Autor:innen, die in ihrer Heimat einem Publikationsverbot unterlagen. Seit den Siebzigern finanziert nicht mehr die CIA, sondern der US-Kongress die Kanäle.
Ein Radio als Werkzeug im Kampf gegen den verhassten Kommunismus? Oder Fenster in die Aussenwelt für Menschen in den sozialistischen Ländern, die zwar nicht einverstanden waren, aber nicht fliehen konnten und deshalb so häufig innerlich emigrierten? Zutreffend ist wohl beides. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verloren die beiden Sender jedenfalls etwas von ihrer Strahlkraft. Bis Russlands Krieg gegen die Ukraine ihnen wieder zu Relevanz verhalf.
Fenster aus dem Exil
Schon 2014 hatte der russischsprachige Ableger mehrere Regionalprogramme eingerichtet: für die Krim und den Donbas, Sibirien oder den Fernen Osten. 2017 erklärte das russische Regime RL zum «Auslandsagenten», im Februar 2024 dann auch noch zur «unerwünschten Organisation». Waren die Journalist:innen im Kalten Krieg vom KGB und anderen östlichen Geheimdiensten verfolgt worden, müssen sie heute fürchten, für ihre Arbeit inhaftiert zu werden. Viele sind deshalb ins Exil gegangen – und berichten von dort über den Krieg. Dass diesem Medium nun ausgerechnet ein US-Präsident den Stecker ziehen will, ist eine ironische Pointe, die kaum bitterer sein könnte.
Für meinen Vater weitete RL übrigens nicht nur im Kalten Krieg den Blick über die miefigen Verhältnisse des Realsozialismus hinaus. In den Jahrzehnten danach war der Sender ein Fenster aus dem Exil in die einstige Heimat. Wann immer ich meine Eltern besuchte, dröhnten (meist männliche) Stimmen aus dem Küchenradio, die stundenlang höchst kenntnisreich das Wesen des russischen Autoritarismus verhandelten.

