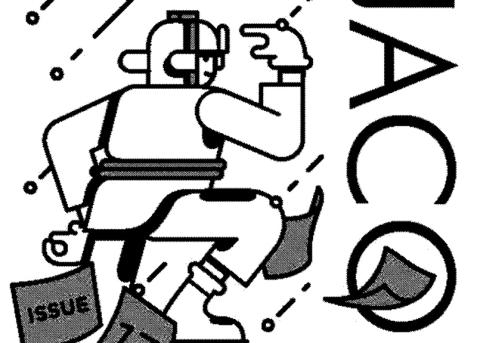Medientagebuch: Mr. Marx auf Hochglanz
Roman Berger über eine neue marxistische Zeitschrift in den USA.
«Junger Verleger bringt Marx zu den Massen»: Publiziert die seriöse «New York Times» unter dieser Überschrift eine ironische Glosse? Nein. Sie meint es durchaus ernst: Ein 21-jähriger US-amerikanischer Intellektueller hat eine Zeitschrift gegründet, als ob es kein Zeitschriften- und Zeitungssterben gäbe. Und seine Publikation soll darüber hinaus «neomarxistisches Denken unter die Leute bringen (…), aber frei von doktrinärem Jargon, mit Humor, Ironie, aber dennoch radikal».
Das antizyklische Projekt hat offenbar Erfolg. Beim Gespräch in einer Bar in Brooklyn überreicht mir Bhaskar Sunkara die neunte Ausgabe seiner Vierteljahreszeitschrift «Jacobin»: «Natürlich brauchte es viel kreative Ignoranz, um so etwas zu beginnen, und wahrscheinlich noch mehr Naivität, um an einen Erfolg zu glauben», meint der Sohn einer Einwandererfamilie aus Südostasien. Die erste Nummer von «Jacobin» veröffentlichte Sunkara im September 2010, als «Occupy Wallstreet» gerade Schlagzeilen machte. Inzwischen ist Occupy von der Bildfläche verschwunden, aber «Jacobin» hat eine AbonnentInnenzahl von 2000 (Print und digital) und erreicht online monatlich 250 000 Hits.
Die Zeitschrift überlebt ohne grosse SponsorInnen. Sunkara und seine vier Koredaktoren, ebenfalls in den Zwanzigern, arbeiten selbst ehrenamtlich, zahlen aber Honorare (maximal 500 US-Dollar pro Essay). Was besonders auffällt: «Jacobin» erscheint auf teurem Hochglanzpapier, für das anspruchsvolle Layout sorgt ein Art-und-Design-Team. «Damit wollen wir uns auch äusserlich von den grauen, langweiligen Zeitschriften der alten ‹liberals› unterscheiden», sagt Sunkara.
Eine besonders gelungene Nummer (Sommer 2012) zeigt auf dem Cover, wie Lincoln und Marx im Auto durch Amerika fahren. Eine Annäherung der beiden hat tatsächlich stattgefunden. Der britische Historiker Robin Blackburn berichtet, dass Marx dem US-amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln zum Sieg über die Sklavenhalter gratuliert habe, den er als eine «Niederlage der reaktionärsten Kapitalisten» feierte. Marx sei so begeistert gewesen, dass er an eine Ausreise nach Texas gedacht habe.
Es sei falsch, immer nur die von Werner Sombart 1906 publizierte These «Warum es in den USA keinen Sozialismus gibt» zu zitieren, schreibt James Livingston im selben Heft. In Wirklichkeit gebe es in den USA sehr wohl Sozialismus zu entdecken, auch an ungewöhnlichen, scheinbar rückständigen Orten, meint der Geschichtsprofessor aus New Jersey: zum Beispiel bei Irving Kristol (1920–2009). Dieser Vordenker der US-amerikanischen Neokonservativen habe immer den Grundsatz vertreten: «Menschen können nur in einer freien Gesellschaft leben, wenn sie überzeugt sind, dass sie in einer gerechten Gesellschaft leben.» Und schon die Gründerväter der USA hätten verstanden, dass Individualismus und Freiheit nur in einer solidarischen Gemeinschaft existieren können.
«Wir müssen die Amerikaner bei ihrem höchsten Wert, der Freiheit, abholen», sagt «Jacobin»-Gründer Sunkara. «Es gibt nicht nur die Freiheit, sich auf Kosten der Schwächeren zu bereichern, es gibt auch die Freiheit von Ausbeutung. Diesen Freiheitsbegriff müssen wir durchsetzen, dann stehen wir auf der richtigen Seite der Geschichte.» Und nie den Humor vergessen! In einem Editorial ermuntert Sunkara auch reiche AmerikanerInnen, «Jacobin» zu abonnieren. Er verspricht dafür, «mit ihnen nett zu sein, auch nach der Revolution».
Roman Berger war Korrespondent in Washington und Moskau und schreibt für die WOZ über Medien.