Auf allen Kanälen: Perfekt inszenierte Leere
Die neue, selbstherrliche Netflix-Doku über Michelle Obama umschifft jede relevante politische Aussage. Angesichts von Donald Trump ist das eine obszöne Unterlassung.
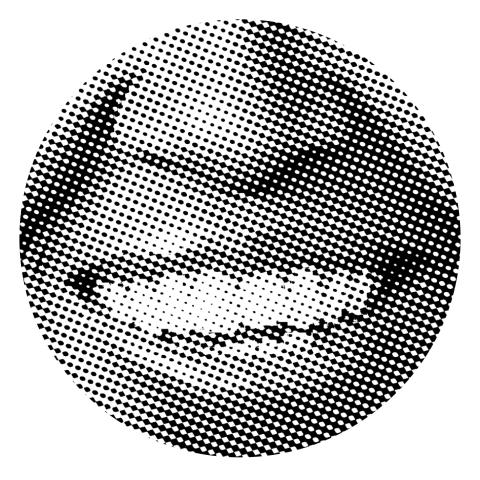
Die Kritik meinte es nicht gut mit «Becoming». «Yes, We Cash In» übertitelte die «Wirtschaftswoche» ihre Abrechnung mit der neuen Netflix-Dokumentation über Michelle Obama. Die Kinozeitschrift «Variety» nannte den Film «ein verlängertes Promovideo» für die vormalige First Lady. Immerhin das Fazit «watchable» – sehenswert – rang sich der «Guardian» ab. Die «New York Times» wollte nett sein und machte alles nur noch schlimmer: «Was Michelle Obama tut, wird immer von Interesse sein, sogar wenn es nicht interessant ist.» Tatsächlich fällt es schwer, etwas Freundliches über «Becoming» zu sagen.
Die notdürftig als Dokumentarfilm verpackte Huldigung trägt denselben Titel wie schon Michelle Obamas autobiografisches Buch von 2018. Hauptschauplatz ist ihre Promotour quer durch die USA, auf der sie sich von Showbizgrössen wie Oprah Winfrey oder Stephen Colbert interviewen liess, um ihre Memoiren unters Volk zu bringen. Bei ihrer Inszenierung als eine Art Heiligenfigur fliegt Michelle Obama vom Publikum so viel sichtlich echte Bewunderung entgegen, dass es wehtut. Neben Auftritten vor Tausenden spricht Frau Obama im kleinen Rahmen Studentinnen und alten afroamerikanischen Kirchgängerinnen Mut zu. Auch dieses Wechselspiel zwischen Masse und intimer Runde wirkt genau berechnet. Ebenso wie die «Blicke hinter die Kulissen».
Abgezirkelte Slogans
Dort treffen wir ihre Mutter, ihren Bruder und kurz die beiden Töchter Malia und Sasha. Barack Obama kommt nur am Rand vor. Spürbar ist das Bemühen, Michelle Obama als Superstar, aber eben auch als bodenständige Frau zu zeigen; wobei Letzteres weitgehend Behauptung bleibt angesichts der Bodyguards, Designerkleider und glänzenden schwarzen SUV-Kolonnen, in denen sie und ihre Entourage herumchauffiert werden.
Allem Bling-Bling zum Trotz: Natürlich hat Michelle Obama Charme, Stil und Humor. Was für jeden Hollywoodstar mehr als genug charismatisches Kapital wäre, macht im Fall der an den Eliteunis Harvard und Princeton ausgebildeten Anwältin aber etwas ratlos. Ist sie doch kein x-beliebiges Celebritysternchen, sondern die Frau, deren Name jedes Mal fällt, wenn jemand fragt, wer Donald Trump im November schlagen könnte. Für viele wäre sie eine ideale Vizepräsidentin, die Joe Bidens altväterliche Gestrigkeit mit etwas Elan von heute aufpolieren würde.
Und genau das ist es, was an der dröhnenden Inhaltsleere von «Becoming» am meisten bestürzt: der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die USA befinden sich in einer monströsen politischen Sackgasse. Trumps Chancen, wiedergewählt zu werden, sind intakt, trotz seiner Lügen und seines erratischen «Krisenmanagements». Und eines der letzten unbestrittenen Kraftzentren der Demokratischen Partei hat nichts Besseres im Angebot als eine eitle Selbstfeier? Wir sehen neunzig Minuten lang einer Frau zu, die abgezirkelte Slogans und Plattitüden des amerikanischen Traums absondert. Die selbst wie ein perfekt durchgestylter Brand wirkt. Und die sich an der dreckigen politischen Gegenwart offenbar nicht die Finger schmutzig machen mag.
Dass das mal anders war, zeigt einer der seltenen erhellenden Momente des Films: In den Anfängen von Barack Obamas Präsidentschaftskampagne hielt Michelle Obama ein paar spontane Reden, die kantig genug waren, dass ihr die Presse postwendend mangelnden Patriotismus vorwarf. Man unterzog sie einer rigorosen Umschulung, bis sie nur noch Phrasen parat hatte, wenn sie vor ein Mikrofon trat: Rassismus ist schlecht, investieren wir in die Jugend, glauben wir an die Hoffnung – und an die Kraft der Geschichten. Die Prozedur scheint bis heute nachzuwirken. Obwohl sie nun ja wieder frei reden könnte. Könnte.
Lukrativer Deal
2018 heuerten Michelle und Barack Obama mit einem höchst lukrativen Deal beim Streamingriesen Netflix an. Von den angekündigten Filmprojekten wurden bis jetzt zwei umgesetzt: ein Dokumentarfilm über einen chinesischen Fabrikanten in Ohio und einer über ein utopisches Sommercamp. Und nun eben «Becoming», der nicht Teil der Vorschau war. Die Obamas und Netflix: eine schwindelerregende Bündelung von Einfluss, Geld und einem weltweiten Millionenpublikum. Auch mit ihren Buchdeals haben Obamas den alten Vorschusskönig Bill Clinton locker überrundet. Und doch wird diese geballte Macht und Aufmerksamkeit politisch kaum genutzt.
Dabei gab es doch im November 2008 diesen unglaublichen Moment, als die Geschichte einer Nation neu geschrieben wurde. Als die Nachfahrin von SklavInnen mit ihrem soeben zum Präsidenten gewählten Mann auf die Bühne schlenderte. Auch dieser Auftritt ist Teil von «Becoming». Man kann sich seiner epochalen Wucht bis heute nicht entziehen. Warum setzt der Film solche brachliegenden politischen Emotionen nicht schlagkräftiger ein?
Wie sehr die Öffentlichkeit auf klare Worte wartet, zeigte gerade die Aufregung um Barack Obamas Uniabschlussrede. Corona habe offengelegt, dass viele Verantwortliche nicht wüssten, was sie täten, sagte er. Manche würden nicht mal vorgeben, zuständig sein. Wir meinen: Da geht noch mehr.