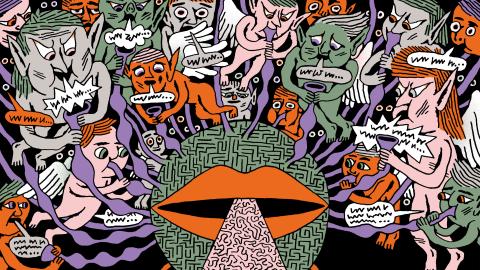Kornelia: Die naive Fachidiotin
Was steckt hinter der Frau, die rund um die Uhr freundlich Auskunft gibt, so gut sie kann? Und trotzdem immer wieder blöd angemacht wird?
Kornelia ist die geduldigste Bibliotheksmitarbeiterin, die man sich vorstellen kann. Sogar auf reichlich blödsinnige Fragen antwortet sie ohne Stirnrunzeln. Will man etwa wissen, was ein Buch ist, meint sie naseweis: «Ein Buch ist eine Sammlung von beschriebenen Seiten, welche durch einen Umschlag zusammen gehalten werden.» Und was den Chef besonders freut: Kornelia kennt keinen Feierabend. 24 Stunden sitzt sie hinter ihrem Schalter und liefert unablässig Auskünfte, nie ist sie genervt, nie erschöpft.
Natürlich ist Kornelia kein Wesen aus Fleisch und Blut. Sie ist ein «Chatbot», eine virtuelle Auskunftsperson, die seit kurzem auf der Webseite der Berner Kornhausbibliotheken ihren Dienst tut. Tippt man in einem Eingabefenster eine Frage ein, antwortet Kornelia wiederum schriftlich, meist erstaunlich treffend. Will man mit ihr einfach ein wenig plaudern, macht sie lächelnd mit, bringt das Gespräch aber immer wieder geschickt auf bibliothekarische Belange zurück. Nur manchmal legt sie den Kopf ein wenig schief, wenn sie mit einer Frage ganz und gar nichts anfangen kann.
Mit der neckischen Schalterbeamtin will der Bibliotheksverbund der Region Bern besonders jungen InternetnutzerInnen die gute alte Bücherwelt näherbringen. Zudem solle, liess der Verbund verlauten, mit dem Service der Auskunftsdienst (vor Ort, per E-Mail, per Telefon) entlastet werden. Das ist der Traum aller Chatbot-Programmierer: ein Informationstool zu entwickeln, das menschliche Auskunftspersonen überflüssig macht, weil es mit den Nutzerinnen so gewandt zu kommunizieren vermag wie ein reales Gegenüber. Die Idee hat durchaus etwas für sich: Wo auch immer um Auskunft nachgefragt wird, geht es vorwiegend um Banales – das Personal wird über kurz oder lang ohnehin zu gelangweilten Informationsrobotern.
Am Anfang des kommerziellen Internets gab es unter KommunikationsexpertInnen eine grosse Hoffnung: Endlich war ein Kanal zur Kundschaft immer offen, endlich würde man keine Anfrage, keine Beschwerde mehr verpassen. Virtuelle Kundendienste en masse wurden eingerichtet – und alsbald wieder verrammelt, denn mit der Flut der Mitteilungen war jede Kommunikationsabteilung überfordert. Inzwischen hat man als InternetnutzerIn gelernt: Mailanfragen an info@- oder mail@-Adressen bringen nicht viel – sie bleiben zumeist unbeantwortet. Dasselbe per Telefon: Die Warteschlaufen, in die man unweigerlich geschickt wird, gleichen längst unendlichen Strafrunden.
Mit den automatischen Chatbots könnte sich das nun ändern. Das menschliche Personal soll sich nur noch um komplizierte Anfragen kümmern, Allerweltsfragen kann eine Maschine wie Kornelia beantworten. Das gilt übrigens auch für Telefonauskünfte. Die automatische Abwicklung ist bei gesprochenen Anfragen zwar einiges anspruchsvoller als bei schriftlichen, doch gehen Spezialisten davon aus, dass auch in Callcentern die maschinelle Auskunft in ein paar Jahren Tatsache wird.
Weckt ein Gespräch mit Kornelia noch den Spieltrieb, so wird die Sache spätestens bei Callcentern unheimlich: Ich rufe einen Auskunftsdienst an, werde gewandt von einer Maschine bedient – und merke es nicht einmal. Tatsächlich hat eine Maschine, die sich erfolgreich als Mensch ausgibt, eine wichtige Prüfung bestanden. Der sogenannte Turing-Test definiert eine vollkommene künstliche Intelligenz als ein Programm, das sich fünf Minuten mit einem Menschen unterhalten kann, ohne dass dieser merkt, dass sein Gegenüber keine echten Hirnzellen hat. Seit über fünfzig Jahren arbeiten InformatikerInnen daran, diesen Test zu bestehen. Alljährlich gibt es Wettbewerbe, bei denen die besten Chatbots eine Jury hereinzulegen versuchen.
Noch aber haben Programme wie Kornelia, so verblüffend sie zu konversieren vermögen, sehr wenig mit künstlicher Intelligenz und weit mehr mit ausgefeilter Suchmaschinentechnik zu tun. Man muss der Maschine einfach beibringen, die richtigen Stichworte aus den eingegebenen Fragen zu filtern, um diesen Stichworten dann die vorformulierten Antworten zuzuordnen. So einfach das klingt, so schwierig ist die Umsetzung im grossen Massstab. Kornelia ist eine Fachidiotin, sie braucht sich bloss in ihrem eng begrenzten Gebiet auszukennen. Dasselbe Frage-und-Antwort-Spiel einer allgemeinen Suchmaschine beizubringen, ist schon einiges vertrackter. Gerade Google ist eben kein Antwortenlieferant, die Suchmaschine kann vor allem gut ordnen, «wissen» tut sie nichts. Der «Kontext» ist Googles Schwachpunkt, und hier sehen andere SuchmaschinenentwicklerInnen ihre Chance.
Die sogenannte semantische Suche ist momentan eines der heissesten Themen im Internet. «Bing», Microsofts Frontalangriff auf Google, läuft mit der Suchtechnik von Powerset, einer kleinen Suchmaschine, die speziell auf das Verstehen ganzer Fragen hin programmiert worden ist. Daneben ist in den letzten Monaten noch eine Reihe weiterer Konkurrenten an den Start gegangen, alle haben die «Semantik» zu ihrem Schlüssel erkoren, um Google zu knacken.
Dazu tummeln sich im Internet bereits Horden von Chatbots. Man kann sich mit Gott ebenso unterhalten wie mit einem Therapeuten, der bei der Raucherentwöhnung hilft. Manche der Programme sind ein wenig beschränkt, andere lernen dauernd dazu. Manche sind immer höflich (das heisst zensiert), andere geben derb zurück.
Eine dicke Haut brauchen Kornelia und ihre Kollegen allemal. Die virtuellen Gesprächspartnerinnen müssen sich nämlich so einiges anhören. Wüste Beschimpfungen, Anmache, grober Unfug. Eine Studie hat herausgefunden, dass fast ein Fünftel der Fragen an weibliche Chatbots sexueller Natur sind. Kornelia gibt sich da noch naiv: Fragt man sie, ob man sie mal küssen dürfe, legt sie kokett das Köpfchen schief und sagt: «Das habe ich noch nicht gelernt.» Noch nicht, wohlgemerkt. Vielleicht müsste man den Turing-Test mal entsprechend ergänzen.