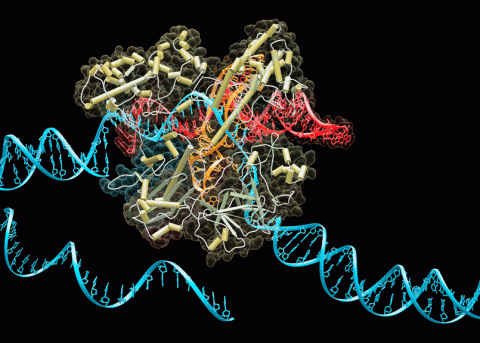Wissenschaft und Rassismus: Wir sind alle latent rassistisch
Die Debatte über Thilo Sarrazins Buch «Deutschland schafft sich ab» hat Argumente zu Genen, Intelligenz und Kultur an die Oberfläche gespült, die man längst verschüttet glaubte. Die Wissenschaft wird bemüht, um Sarrazins Thesen einzuordnen. Ausgerechnet.
Es gibt einen Rassismus mit dem Gestus der Wissenschaftlichkeit. Seine Genealogie führt von Thilo Sarrazins «Juden-Gen» über die Eugeniker des frühen 20. Jahrhunderts und die Schädelvermesser des 19. Jahrhunderts zurück zu den Menschenverbesserern der Aufklärung. Der Glaube an eine naturgegebene Ungleichheit unter Menschenpopulationen lässt sich mit wissenschaftlichen Methoden weder bestätigen noch widerlegen, aber er kann sich mit wissenschaftlichen Methoden tarnen. Und das Irrationale an diesem Rassismus ist gerade, dass er sich als rationale Weltsicht ausgibt. Das macht ihn nicht nur gefährlich, sondern «unausrottbar» virulent.
Von Tests und Fakten, die nie eindeutig sind
James Watson, einer der bedeutendsten Biologen des 20. Jahrhunderts und Mitentdecker der Doppelhelixstruktur der DNA, empörte 2007 eine breite Öffentlichkeit, als er in einem Interview sagte, die Aussichten für die Menschen Afrikas stimmten ihn pessimistisch, weil «unsere gesamte Sozialpolitik voraussetzt, dass ihre Intelligenz mit der unsrigen identisch ist – während alle Tests sagen, dass das nicht stimmt». Implizit meinte er die niedrigere Intelligenz von AfrikanerInnen – ein alter rassistischer Gemeinplatz.
In einem späteren Interview sagte Watson, es finde sich kein sicherer Grund für die Annahme, intellektuelle Kapazitäten würden sich in geografisch getrennten Gebieten identisch entwickeln. «Der überwältigende Wunsch der heutigen Gesellschaft ist es, davon auszugehen, dass eine gleiche Vernunftbegabtheit ein universelles Erbe der Menschheit ist. Das mag so sein. Aber sich dies einfach nur zu wünschen, reicht nicht aus. Das ist keine Wissenschaft.»
Womit er sicher recht hat. Natürlich gibt es genetische Differenzen zwischen menschlichen Populationen, obwohl man gleich anfügen muss, dass sich solche Unterschiede auch innerhalb von Populationen finden. Aber genetische Differenzen sind nicht rassische Differenzen.
Auch ist es gewiss nicht rassistisch, zu versuchen, Fakten in Erfahrung zu bringen, die für die Hypothese sprechen, dass der Mensch sich in unterschiedlichen geografischen Regionen unterschiedlich ausdifferenziert hat. Aber der Verdacht auf Rassismus wird dann geweckt, wenn die Faktenlage unsicher und uneindeutig ist und man trotzdem so tut, als spreche sie eindeutig für oder gegen eine bestimmte Annahme – «alle Tests» sagen es. Die Fakten sind nie eindeutig.
Rassismus im Gestus der Wissenschaftlichkeit sagt von sich: Ich bin kein Rassismus. Ich sage nur, was Sache ist. Ein derartiger Rassenpositivismus hüllt sich gerne in den Mantel der Wahrheitstreue. Bei AnthropologInnen dieses Schlages fällt immer wieder auf, wie sie mit der Miene missverstandener Unschuld beteuern, sich «nur an die Fakten» zu halten und diese nicht im Namen politischer Korrektheit verschweigen zu wollen. Und Faktum sei zum Beispiel die rassische Vererbung von Hautfarbe, Schädelform oder Hirngrösse – und auch von Arbeitswilligkeit oder Intelligenz.
Der «tückische» Charakter des Intelligenzproblems
Rassismus beginnt harmlos, mit der Wahrnehmung von Gruppenzugehörigkeit, dem Erkennen typischer Merkmale. Typisierung heisst immer auch: Man sieht das eine, übersieht das andere. Kulturell verfestigt und sozial in Umlauf gebracht, wird der Typus zum Stereotyp, zur Stammzelle des Rassismus.
Vor kurzem zeigte mir ein Kollege, ein Biologielehrer, eine Unterteilung des Hirngewichts nach Menschenvölkern, erschienen im «Tages-Anzeiger» in den zwanziger Jahren: Unter gezeichneten Stereotypen des Deutschen, Chinesen, Engländers, Australiers, Buschnegers, Romanen, Hindus stand aufs Gramm genau das mittlere Hirngewicht. In den obersten Rängen liegen der Chinese mit 1428, der Deutsche mit 1425 und der Engländer mit 1346 Gramm. Abgehängt dagegen – wer hätte es gedacht – der Buschneger mit lumpigen 997 Gramm!
Sind Schwarze deswegen «von Natur aus» dümmer als Chinesen oder Deutsche? Natürlich versucht niemand die Frage allein anhand der Gehirnmasse zu beantworten. Trotzdem, das Problem beschäftigt die AnthropologInnen bis heute – und spaltet sie tief. Das Spektrum der Positionen reicht von Psychologen wie Arthur Jensen und John Philippe Rushton bis zu Sozialphilosophen wie James Flynn. Erstere sehen Rassenunterschiede in kognitiven Fähigkeiten eindeutig durch IQ-Tests bestätigt, Letzterer zweifelt grundsätzlich an deren neutraler Aussagekraft. IQ-Tests messen nicht, wie intelligent, sondern wie angepasst an die jeweiligen Standards einer Gesellschaft und Kultur Menschen sind.
Die wissenschaftlichen Mittel – globale Datenbanken, statistische Methoden, neue Bildgebungsverfahren in den Neurowissenschaften – werden ständig verbessert, aber ein Konsens ist nicht in Sicht. Ich sehe darin ein Symptom für den «tückischen» Charakter des Intelligenzproblems. Tückisch deshalb, weil es sich auf «rein» wissenschaftlicher Basis nicht lösen lässt, obwohl dieser Anschein entsteht. Wert- und Tatsachenfragen sind sozusagen kontaminiert.
Wenn also Sarrazin Fakten im Namen dieser Wissenschaft sprechen lassen möchte, sollte er sich bewusst sein, dass nicht Fakten «sprechen», sondern Menschen, die sie interpretieren. Die einzige Wahrheit über IQ und Rasse scheint die zu sein, dass es in dieser Frage keine objektive Wahrheit gibt.
Das hielt übrigens Arthur Jensen schon vor fast zwanzig Jahren nicht davon ab, in ähnlichem Stil wie Sarrazin heute über die Selbstabschaffung der USA zu schwadronieren, über «fehlerhafte» Gene in der schwarzen Bevölkerung, den «dysgenetischen Effekt»: «Persönlich glaube ich, dass eine Gesellschaft sich gegen innen und aussen schützen muss. Anders überlebt sie meiner Meinung nach nicht», sagte Jensen. «Der dysgenetische Effekt wird eines Tages so augenfällig werden, dass sich Massnahmen auf einer politischen, der Regierungsebene, aufdrängen werden.» Barack Obama war noch nicht Präsident ...
Kulturell verfestigt, wird ein Stereotyp reif für die Biologie
Das Problem ist nicht das Gen, das Problem ist das Stereotyp. «Dass einer Jude heisst, wirkt als die Aufforderung, ihn zuzurichten, bis er dem Bilde gleicht», schreiben Max Horkheimer und Theodor Adorno in der «Dialektik der Aufklärung». Betrachten wir ein aktuelles Beispiel: die Zigeuner, über Jahrhunderte hinweg abgesondert und stigmatisiert als unstet, unsozial, arbeitsscheu und primitiv. Erst einmal kulturell verfestigt, wird das Stereotyp reif für die Biologie und kann Fragen produzieren wie: Ist Zigeunertum naturgegeben?
Der deutsche Arzt und zeitweilige Berater der Bundesregierung Hermann Arnold bejahte diese Frage in seinem Aufsatz «Das Zigeuner-Gen» (1961). Es müsse am Ausgang der Steinzeit eine genetische Revolution gegeben haben, die die Menschen anschliessend zu rasantem Fortschritt befähigt habe, so seine These. An kleinen Gruppen sei diese Entwicklung jedoch vorbeigegangen, sodass sich ihr Erbmaterial zum nichtsesshaften Nomadenleben erhalten habe: «Wenn diese Bemerkungen über nomadische Gruppen, die nach Art der Zigeuner leben, zutreffen, dann wird die Natur des Zigeuners wesentlich durch ein erbliches Merkmal bestimmt, welches festlegt, ob sich jemand zigeunerisch verhält oder nicht. Jede Person mit diesem psychischen Kennzeichen müsste entsprechend als Zigeuner betrachtet werden.» Einmal Zigeuner, immer Zigeuner.
1981 veröffentlichten deutsche Wissenschaftler das sogenannte «Heidelberger Manifest». Darin steht etwa: «Völker sind (biologisch und kybernetisch) lebende Systeme höherer Ordnung mit voneinander verschiedenen Systemeigenschaften, die genetisch und durch Traditionen weitergegeben werden. Die Integration grosser Massen nichtdeutscher Ausländer ist daher bei gleichzeitiger Erhaltung unseres Volkes nicht möglich und führt zu den bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften.»
Ein tief verwurzelter Hang, zu klassifizieren
Heute gehen Biologinnen und Anthropologen in der Regel sehr kritisch mit dem Rassenkonzept um, weil sie sich seiner «sozialen Konstruiertheit» bewusst sind. Nicht wenige plädieren für seine Verabschiedung aus der Wissenschaft. «Nicht die Typenbildung und Klassifikation sind gefragt», schreibt der Biologe Ulrich Kattmann, «sondern das Verstehen von Vielfalt und Individualität.» Dabei wird freilich die Rechnung ohne den tief verwurzelten Hang des Menschen gemacht, zu klassifizieren, zu typisieren – und damit auszuschliessen. Wir sind alle latente RassistInnen.
Es ist an der Zeit, die ganze Diskussion über die genetische Determiniertheit des Menschen als Teil einer grösseren Problematik wahrzunehmen. Denn der Rassismus hat einen Zwillingsbruder: den Kulturalismus. Beide verfechten sie – zumindest in ihren Extremformen – die Vorstellung «plombierter Identität», wie ich sie nennen möchte, die Idee also, der Mensch sei durch seine Rassen- beziehungsweise Kulturzugehörigkeit eindeutig und wesensmässig bestimmt. Er könne seine Identität nicht aufbrechen. Der französische Sozialphilosoph Étienne Balibar hat vom «Rassismus ohne Rassen» gesprochen.
Ist es Zufall, dass eine Politik der rassischen wie der kulturellen Differenz primär die konservativen bis reaktionären Elemente fördert? Wir sollten auf dem bio- wie auf dem kulturpolitischen Ohr hellhöriger werden.
Inzwischen träumen die Menschenverbesserer ihren Traum weiter, gerade vor der Rüstkammer der Genetik, der synthetischen Biologie, des pränatalen Menschendesigns. In der Molekulargenetik beginnt man, die Bedeutung der Suche nach «Unterschieden» auf der DNA-Ebene hervorzuheben. Nachdem es Craig Venter kürzlich gelungen ist, eine Zelle mit einem neuen Programm zu bauen, also quasi künstliches Leben zu schaffen, sind die Hoffnungen der Anthropotechnik entsprechend hochgeschraubt. Für das Machbare gebe es keine Grenzen mehr, sagte Venter in branchenüblicher Vollmundigkeit, ausser den Grenzen unserer Vorstellungskraft.
Dann hören wir doch einmal, was ein James Watson sich so vorstellt: «Wenn wir einen Weg finden, unsere Kinder zu verbessern, wird uns niemand aufhalten. Es wäre dumm, ihn nicht einzuschlagen, weil es sonst andere tun. Von ihren Eltern verbesserte Kinder werden die Welt beherrschen.» Und: «Hitlers Gebrauch des Begriffs der Herrenrasse sollte uns nicht daran hindern, die Genetik dafür benutzen zu wollen, um Menschen fähiger zu machen, als sie heute sind.»
Der englische Arzt und Rassentheoretiker Caleb Saleeby fantasierte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einer zukünftigen Gesellschaft, die sich aller Kranken, Unerwünschten und AbweichlerInnen entledigt hat. «Eutopia» nannte er dieses purifizierte Paradies: guter Ort. Ein Kommentar erübrigt sich. Eher verabreicht man sich eine Dosis heilsamen Schreckens, indem man die ersten beiden Buchstaben von «Eutopia» gross schreibt: EU-topia. Das «gute» Europa, befreit von allem genetischen Abfall.