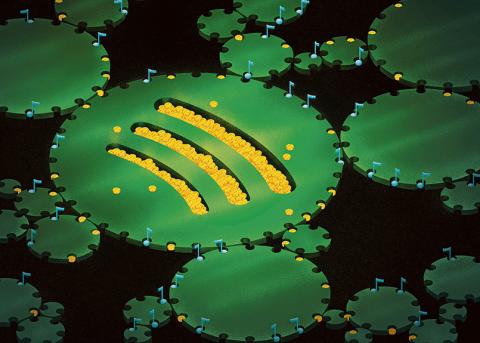Streaming – Spotify & Co.: Permanent unter der Käseglocke
Plattformen wie Youtube oder Spotify lassen uns via Streaming die globalen Bestände der Musik anzapfen. Zumindest theoretisch. Denn die Algorithmen der Streamingdienste gehorchen Interessen, die an kultureller Vielfalt keinen Gefallen finden.

Streaming ist in aller Munde, doch wie so oft wissen im Zeitalter der technologischen Entmündigung nur die wenigsten, was es bedeutet und wie es genau funktioniert. Rein technisch gesehen bezeichnet Streaming zunächst einmal den Vorgang der Übertragung von aus einem Rechnernetz empfangenen und gleichzeitig wiedergegebenen Audio- und/oder Videodaten: Musik, Hörspiele, Filme und so weiter.
Das ist nicht einfach digitales Radio oder Fernsehen. Ein Radio- oder Fernsehsender kann von unzähligen EmpfängerInnen gleichzeitig genutzt werden – was in vielen Ländern sogar gesetzlich vorgeschrieben ist: Der Service public gehört in der Schweiz zum Leistungsauftrag der SRG. Streaming hingegen ist eine für NutzerInnen individualisierte und erst auf deren Anforderung hin realisierte Verbindung zwischen einem Medienserver und dem Endgerät der NutzerInnen.
Der weltweit mit Abstand erfolgreichste Streamingkanal, der jedoch in den seltensten Fällen als solcher bezeichnet wird, ist Youtube. In den USA ist Youtube längst das Tool, mit dem Teenager am häufigsten Musik konsumieren. Bislang war Youtube gratis, doch seit Mitte 2013 sind einige Youtube-Kanäle in den USA kostenpflichtig, und im Dezember schreckte Youtube die Öffentlichkeit mit der Meldung auf, dass man einen «Premiumservice» einführen wolle, der gegen eine monatliche Gebühr von rund dreizehn Franken abonniert werden kann.
Wer die Musik tatsächlich besitzt
Kommerzielle Streamingdienste wie Spotify stellen bestimmte Inhalte zur Verfügung und lassen sich deren Übertragung von den einzelnen NutzerInnen bezahlen: entweder direkt, etwa durch eine monatliche Gebühr, oder indirekt über die im Stream enthaltene Werbung. Oder noch indirekter, indem die Streamingfirmen die Daten der VerbraucherInnen erhalten und auswerten können – Big Data lässt grüssen. Die Geschäftsmodelle der meisten Streamingfirmen gleichen jenem von Youtube. Für die jeweilige Premiumvariante, also eine werbefreie Nutzung auf einer Vielzahl von Geräten von Laptop bis Smartphone, scheint sich überall wie bei Youtube ein monatlicher Preis von um die dreizehn Franken zu etablieren; die eingeschränkteren Nutzungsmöglichkeiten kosten entsprechend weniger, und die kostenlosen Varianten sind extrem werbungsaffin, man wird dort mit kommerziellen Angeboten zugeballert.
Nun bündeln sich wie bei jeder neuen Technologie die verschiedensten Interessen im Streaming: Derjenige, der ein Medienangebot zur Verfügung stellt, hat naturgemäss ein anderes Interesse als diejenige, die Medienangebote nutzen möchte. Und es wäre naiv zu glauben, dass die multinationalen Konzerne der Bewusstseinsindustrie, die ständig auf der Suche nach neuen Vertriebswegen für ihre Inhalte sind, nicht massiv versuchen würden, die neuen Vertriebswege zu entern, zu manipulieren und zu dominieren.
Was zur Frage führt: Wem gehören die wichtigsten Streamingdienste? Youtube, das wissen fast alle, gehört Google. Google hat natürlich ein starkes Interesse, seine Youtube-Inhalte zusätzlich zu monetarisieren. Neu auf vielen europäischen Märkten ist der Videodienst Vevo, an dem Google ebenfalls zu rund achtzehn Prozent beteiligt ist. Vevo bietet seinen NutzerInnen Zugriff auf rund 75 000 Videoclips, die über die Website abrufbar sind – mittels Apps auf Smartphones und Tablets, ja sogar über die Spielkonsole Xbox. Die Plattform gehört Universal Music und Sony, also den zwei grössten Musikkonzernen der Welt, die zusammen über etwa 62 Prozent der Weltmarktanteile im Tonträgergeschäft verfügen.
Der Eigner von Warner Music, dem drittgrössten Musikkonzern der Welt, hat Anteile am französischen Streamingdienst Deezer übernommen. Die drei Majors, die knapp achtzig Prozent des weltweiten Tonträgermarkts unter sich aufteilen, sind – nebst Coca-Cola und anderen – auch an Spotify beteiligt, dem globalen Marktführer unter den neuen Streamingdiensten. Sie haben ihre achtzehn Prozent Beteiligung an Spotify vom jungen Unternehmen gewissermassen erpresst – so behauptet zumindest der ehemalige Universal-Manager Tim Renner: Wenn Spotify die Beteiligung nicht herausgerückt hätte, hätten die Rechteinhaber, also die multinationalen Plattenkonzerne, die Rechte an den Musikstücken nicht zur Verfügung gestellt und damit das Streaminggeschäftsmodell verunmöglicht.
Was bedeutet es aber, dass die Majors an Streamingdiensten wie Spotify oder Vevo beteiligt sind? Zunächst einmal geht es diesen Firmen darum, die Vertriebswege zurückzuerobern, die sie durch die von ihnen verschlafene Digitalisierung in den letzten zehn Jahren verloren haben. Denn was Major-Labels immer ausgemacht hat, ist die Kontrolle über die Vertriebskanäle. Ausserdem bevorzugten Plattenfirmen Tonträger, weil sie damit viel mehr Geld verdienen konnten. Doch die MusikhörerInnen bevorzugen mittlerweile die neuen Systeme, mit denen man Musik geniessen kann, ohne sie besitzen zu müssen.
Streaming hat viele Vorteile
In der modernen Gesellschaft zahlt man für Nutzung, nicht für Besitz – im Grunde eine sympathische Idee. Die Vorstellung, dass eine Unmenge von Musikstücken nur einen Mausklick entfernt ist, ist durchaus positiv. Es entsteht eine fast unendliche Musikbibliothek, auf die NutzerInnen eines Streamingdienstes jederzeit und fast überall Zugriff haben – Spotify etwa bietet 25 Millionen Stücke im Stream an.
Musik wird nicht mehr nur für heute produziert, muss nicht mehr rasch verkauft werden. Musik kann für heute und morgen produziert werden, sie bleibt verfügbar. Es zählt nicht mehr der sofortige, meist von MarketingstrategInnen der Musikindustrie entworfene (und mit hohen Marketingausgaben verbundene) schnelle Erfolg, sondern es geht um die langfristige Karriere eines Musikstücks. Womit sich das Augenmerk wieder auf die Qualität der Musik richten kann.
Viele anspruchsvolle Alben sind «slow burners» und finden erst spät ihre Fans. Alte Alben aber sind oft vergriffen und in keinem Geschäft mehr aufzutreiben – beim Streamingdienst indes kostet es nichts, sie vorrätig zu halten. Was für ein Gewinn für die Musikgeschichte!
Kommt hinzu: Insbesondere Musikstücke aus weit entfernten Welten haben kaum eine Chance, den Weg zu den hiesigen HörerInnen zu finden. Der grossartige Track «Niebla Morada» etwa, eine durchgeknallte «Purple Haze»-Version der kolumbianischen Meridian Brothers, ist selbst im Netz nur schwierig und teuer als Vinylsingle aufzutreiben. Bei Spotify hingegen steht er sofort zur Verfügung.
Nur – wie findet man «Niebla Morada»? Hat Spotify überhaupt ein Interesse daran, dass wir diesen Track hören? Wohl kaum. Auf der Berliner Musikfachmesse «re:publica» im Frühling erklärte Marie Heimer, die für den deutschsprachigen Raum zuständige PR-Managerin der Spotify-Labels: «Wir wollen alle erreichen – wir wollen den Mainstream erreichen.» Die Algorithmen der Streamingdienste sind so programmiert, dass wir immer innerhalb unserer kleinen, von ihnen und den beteiligten Konzernen der Kulturindustrie eingezäunten «gated communities» bleiben. «Du hast Lady Gaga gehört. Wir haben einen Song für dich, der dich interessieren könnte», flötet das Programm des Streamingdienstes – und bietet uns immer ein ähnliches Musikstück an.
Es geht nicht um kulturelle Vielfalt, es geht um Kontrolle. Streamingdienste gleichen «Kontrollgesellschaften», wie sie der französische Philosoph Gilles Deleuze beschrieben hat: «ultraschnelle Kontrollformen mit freiheitlichem Aussehen, die die alten – noch innerhalb der Dauer eines geschlossenen Systems operierenden – Disziplinierungen ersetzen». Die Narration lautet: Du geniesst totale Freiheit! Aber in Wirklichkeit hast du immer eine Art Käseglocke über dir, und die bewegt sich mit. Du bleibst unter Kontrolle. In diesem Fall: unter der Kontrolle des Monsters Spotify. Theoretisch bietet Spotify uns 25 Millionen Musikstücke an, und wir könnten daraus wählen, was immer wir möchten. Aber eigentlich will uns Spotify nur Mainstreamware verkaufen, stromlinienförmige Produkte der Kulturindustrie.
Drohende Entmündigung
Und so wird ein eigentlich wunderbares System, die Möglichkeit eines «unendlichen Programms», die theoretische Verfügungsgewalt über 25 Millionen Songs, pervertiert durch ihr Gegenteil: Spotify will nicht, dass wir eines dieser 25 Millionen Musikstücke entdecken, sondern Spotify und die Musikkonzerne wollen, dass wir ihre 2500 Mainstreamtitel, mit denen sie ihren Profit erwirtschaften, immer wieder hören, dass wir dank der Algorithmen innerhalb der Kontrollgesellschaft bleiben, die die Bewusstseinsindustrie für uns konzipiert hat.
Das, was Musikhören eigentlich ausmacht, das Faszinierende an Musik, das Entdecken neuer Klänge, das Erobern neuer Territorien, Musik, die uns neugierig macht oder ins Mark trifft und uns gewissermassen auffordert, unser Leben zu ändern – das stellen uns die Streamingdienste nur in der Theorie zur Verfügung. In der Praxis sind Streamingdienste kommerzielle Bewusstseinsmaschinen, die unser Musikhören kontrollieren, analysieren und steuern. Also ein weiteres Tool des Kapitalismus zur technologischen Entmündigung, das uns zu kommerziellen Objekten macht, ein Instrument, das die Ökonomisierung unseres Geistes, unseres Fühlens, unseres Musikgeschmacks perfektioniert. Vorsicht ist geboten.
Aktuell ist Berthold Seliger mit seinem Buch «Das Geschäft mit der Musik. Ein Insiderbericht» auf Lesetour in der Schweiz: Kaserne Basel, 17. Januar 2014; El Lokal in Zürich, 19. Januar 2014; Palace St. Gallen, 21. Januar 2014; Cardinal Schaffhausen, 22. Januar 2014. www.bseliger.de