Essay: Ich bin nicht Florescu
«Wo kommen Sie schon wieder her?» «Vom Limmatplatz.» Eine Polemik gegen nationale Kernidentität und das voreilig verhängte Label «Migrationsliteratur».
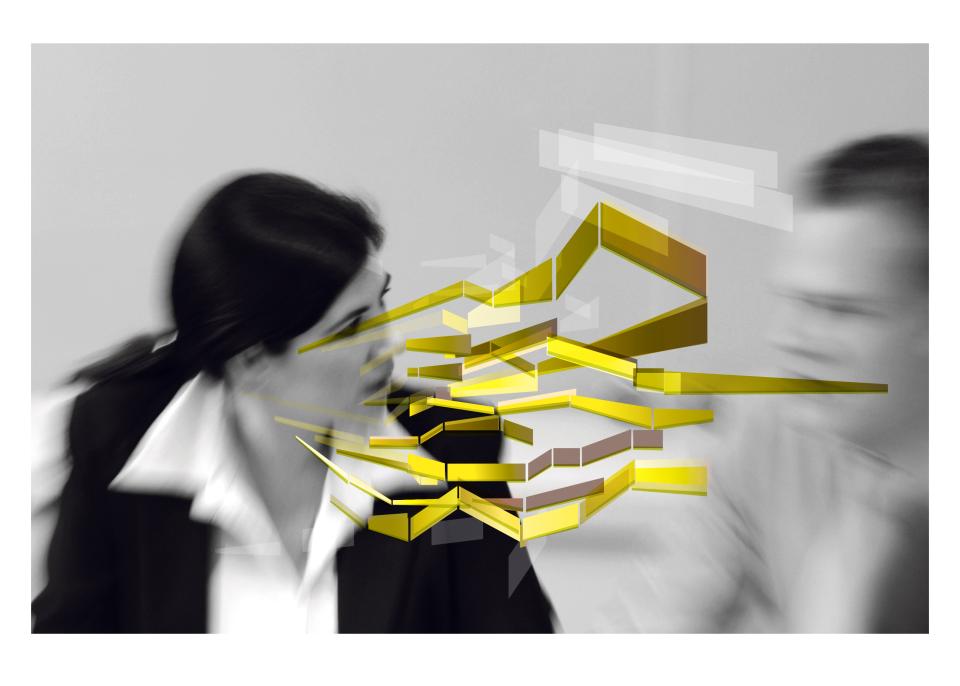
Ich bin nicht Florescu. Jedes Mal, wenn Sie mich darauf festnageln wollen, werde ich Ihnen entgleiten. Jedes Mal, wenn Sie mich ins Gefängnis Ihrer Etiketten einsperren wollen, werde ich ausbrechen. Ich werde ein kleines Loch graben, dann einen langen Tunnel, und am Schluss werde ich von der Insel entkommen, auf die Sie mich lebenslänglich verbannen wollen. Der Graf von Monte Christo würde es nicht besser tun. Denn ich hatte Zeit zu üben.
32 Jahre Lebenszeit in meinem Schweizer Zuhause, und immer wieder die Frage beantworten müssen: Wo kommen Sie schon wieder her? Im Präsens, als ob ich gerade gelandet wäre. Ich komme vom Limmatplatz, Kreis 5 in Zürich. Ich kam einmal vom Osten her, folgte der Völkerwanderung, den Hunnen, Goten und Vandalen. Aber jetzt, JETZT, komme ich vom Limmatplatz, vom Eingang der Langstrasse, keine noble Adresse, aber eine, die für mich stimmt. Der liebenswürdigen Dame, die mir vor kurzem sagte: «Ich freue mich, dass es Ihnen so gut in der Schweiz gefällt», antworte ich: «Ich bin hier nicht auf Urlaub, meine Dame. Ich bin hier, um zu bleiben. Ich bleibe schon seit 32 Jahren hier.»
Was ich bin? Es gibt Wichtigeres!
Also halten Sie mich nicht auf mit Ihren Mutmassungen darüber, was ich bin und nicht bin, denn ich habe Wichtigeres vor. Ich will die Welt retten mit einer Hand voller Wörter, die ich zwischen die Gräber von Srebrenica streue. Ich will meine besten, treffsichersten Wörter in den Schlund der Diktatoren, der Kriegstreiber, der Menschenverächter und rechten Scharfmacher stopfen, auf dass sie daran ersticken. Ich will Wörter säen auf den kargen Böden eines entfesselten, gefrässigen Kapitalismus, auf dass ich übermorgen eine starke Literatur ernte, die ebendiesem das Fürchten lehrt.
Ich habe einiges vor, stellen Sie sich mir nicht in den Weg, aber gehen Sie neben mir her. Ich lasse mich nicht an den Rand drängen als Migrantenliterat. Von Format zwar, aber randständig. Unsere Welt ist komplexer, vielschichtiger geworden und so auch die Literatur. Vielleicht kann man bald «Literatur» nur noch in der Mehrzahl denken: «Literaturen». Es gibt sie nicht mehr, die eine, homogene Literatur, diese Vorstellung sollten wir hinter uns lassen. Vorausgesetzt, Sie machen mit. Denn das rüttelt am Selbstverständnis der Mehrheit.
Es gibt sie noch, jene Säulenheiligen, solide, identifikationsstiftende Schweizer AutorInnen. Aber gleich dahinter kommen wir, die wir nicht in ebenso solide Schweizer Verhältnisse hineingeboren wurden, sondern sie uns erst erarbeiten mussten. Wir waren nicht von Anfang an dabei, aber wir sind es jetzt umso gründlicher. Ich würde es Ihnen zu leicht machen, wenn ich etwas anderes behauptete. Sie könnten sich nämlich herausnehmen und mich aus der Ferne bestaunen. Sie wären mit meiner Literatur nicht mitgemeint. Zwischen Ihnen als LeserIn und mir läge ein Graben, den man mit aller Schweizer Rösti nicht auffüllen könnte.
Ich bin auch Bichsel und Frisch
Wenn es um Literatur geht, sitzen wir im gleichen Boot. Gute Literatur erzählt immer vom Menschen in seiner Zeit, von seiner Humanität und seiner Niedertracht, von seinem Streben nach Glück und Würde. Sie tut nur so, als ob es ihr um einzelne Figuren ginge, eigentlich meint sie alle Menschen und zu allen Zeiten. Wir sind immer mitgemeint.
Ich werde erst stiller werden, wenn ich nicht mehr dauernd Florescu sein muss. Denn ich bin auch Bichsel, Frisch, Dürrenmatt, Walser und alle anderen Schweizer AutorInnen mit oder ohne fremde Herkunft. Und sie sind ich. Wir alle schreiben oder schrieben Literatur in der Schweiz. Wird die Frage der Herkunft des Autors zu einer Kategorie der Rezeption, so entsteht leicht der Verdacht, dass hier eine Art nationaler Schutzmantel konstruiert wird, um sich die «Fremden» doch noch vom Leib zu halten. Indirekt will man sagen, dass es einen nationalen Kern gibt und nebenbei, an der literarischen Peripherie, noch die anderen. Was aber wirklich wichtig ist, worauf wir zählen sollten, ist der literarische Text allein.
Der Geist der Literatur ist synthetisch, nicht analytisch. Jene, die sich einen Beruf und eine Berufung daraus gemacht haben, die Literatur in Kategorien und Schubladen einzuteilen, treffen diesen Geist nicht. Er nährt sich davon, dass einE AutorIn viele Aspekte einer Epoche zu einer einzigartigen Vision zusammenfügt. Die Etikettierung dient am meisten der Buchindustrie, damit sich ihre Ware verkauft. Fantasy, Krimi, Romanze sind die drei Genres, die man dem spannungsarmen Menschen der Spätmoderne am besten unterjubeln kann. Gewiss gibt es auch da hervorragende Werke. Es geht um das Übermass des Phänomens, das alles Stillere erdrückt und verdrängt.
Lesen wir doch wieder Gedichte!
Es dient also niemandem, Literatur schon bei ihrem Erscheinen zu etikettieren. Man zieht ihr die Zähne, macht sie handzahm. Man liefert sie ihren Feinden aus: der bequemen Lektüre, dem Denken, das nicht erschüttert werden will, sondern nur unterhalten. Ich aber habe angefangen zu schreiben, weil Literatur ein Strom ist, ein Fluidum, ein Puls aus Sprache, der durch uns alle hindurchgeht. In diesem Sprachfluss treffen Leser und Autorin aufeinander. Sie sind in der gleichen Welt.
Es darf nie vergessen gehen: Literatur ist nicht in erster Linie Plot, sondern Sprache. Die Buchindustrie, das Marketing, die Medien lieben den Plot. Am liebsten einen Plot, der einer Redaktion schnell, griffig und spannend vermittelt werden kann. Dann hat man gute Chancen auf ein mediales Echo. Das aber ist vollkommen gegen die Natur literarischer Texte. Wie soll man vielschichtige, genau beobachtete und erzählte Geschichten in wenige Sätze zwängen? Wenn ich gefragt werde, zu welcher Sparte meine Literatur gehört, antworte ich: «Haben Sie genug Zeit, damit ich es Ihnen erzähle?»
Ist es eine verkehrte Welt, in der sich mediokre und schlechte Literatur exorbitant ausbreitet und alles andere, Literarischere ums Überleben kämpfen muss? Leider nicht, sondern nur die Logik einer geschwätzigen, hysterischen Zeit. Die dichte, persönliche, genaue, poetische Sprache wird nur noch wenigen überlassen. Je weniger wir erleben, je satter wir sind, desto mehr flüchten wir uns in ein Mitteilungsbedürfnis, das die Ratlosigkeit überdecken soll.
Wir leben im Zeitalter der Verpackung, des Designs, des Marketings, des Plots, nicht der Poesie. Die Lyrik hat es wieder einmal am schwersten, weil sie sich am konsequentesten dem einfachen Plot verweigert. Denn Lyrik ist Sprache. Lesen Sie wieder Gedichte! Lesen Sie Octavio Paz, Pablo Neruda, Fernando Pessoa. Sie werden sehen, was Literatur vermag.
Auch uns deutschsprachigen AutorInnen mit fremden Wurzeln ist nicht gedient, wenn man uns – meinetwegen wohlwollend – aus der Ganzheit der Literatur herausschneidet, isoliert anschaut und bestaunt. Zwar sind wir ein Wirtschaftsfaktor geworden. Kein Verlag, der sich nicht wünschte, solche AutorInnen zu haben. Viele deutsche und Schweizer Buchpreise gingen an uns. Wir beschäftigen scharenweise Germanistinnen und Journalisten, die über uns schreiben. Man attestiert uns, relevante Themen zu bearbeiten und eine starke Sprache. Eine Selbstverständlichkeit in der Literatur, sollte man meinen.
Ich bin Sie. Sie sind ich.
Es gibt aber zu denken, wenn man das so herausstreichen muss: Was ist los mit der Kultur der Mehrheit? Wo sind hier die relevanten Themen und die einzigartige Sprache? Trotz dieser Vorteile, dieser uns geschenkten Aufmerksamkeit will ich auf die hiesige Literaturlandschaft nicht als Exot einwirken, sondern durch meine Sprache, mein literarisches Gestaltungsvermögen, durch die Art und Weise, wie ich Sprache zum Leben erwecke. Ich will Spuren hinterlassen, aber nicht als Irrläufer. Deshalb sage ich: Wir haben wichtigere Dinge zu erledigen, als einen Keil zwischen die Literaturen zu treiben. Wir müssen auf das schauen, was uns eint, und nicht auf das, was uns trennt. Denn ich bin Sie. Sie sind ich.
Ob ein Autor schon immer hier war oder nicht, ob er ganz dazugehört oder nur zur Hälfte, sind aus der Perspektive einer dynamischen, vitalen, unteilbaren Literatur nicht die ergiebigsten Fragen. Ausser für diejenigen, die dauernd in Kategorien denken.Für alle anderen gilt: Wir haben gemeinsam etwas zu bewegen, wenn wir wollen, dass die Kultur – in diesem Fall die Literatur – nicht noch hoffnungsloser in den Hintergrund gerät. Dass ihr das – schon heute ergraute – Publikum nicht ganz abhandenkommt.
Es braucht reife, integrierte und integre, abgrenzungsfähige, neugierige, empathische, mutige Individuen, die eine eigene Sprache und Rückgrat haben. Menschen, die Schönheit und Tiefe erkennen und suchen. All das, was der nüchterne, die Fantasie disziplinierende Zeitgeist – der auf Funktionalität, Optimierbarkeit und Messbarkeit setzt – nicht ist.
Lassen Sie uns neugierig sein
Martin Buber schrieb in seinem berühmten Buch «Ich und Du»: «Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du. Das andere Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es. Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Das Grundwort Ich-Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.»
Der beziehungsfähige Mensch ist dieses Individuum, das mit dem ganzen Wesen sprechen kann. Es ist nicht sicher, ob er Literatur lesen und Kultur als einen notwendigen Bestandteil seines Lebens erkennen wird, aber die Chance ist gross. Seine Neugierde, sein Interesse, seine Werte, sein Vibrieren mit der Welt werden ihn zu ihr führen.
Von einer Ich-Es-Beziehung spricht Martin Buber, wenn der Mensch sich selbst und andere zum Objekt, zur Ware macht. Unser Zeitalter, finde ich, beherrscht perfekt die Kunst, alles in eine Ware zu verwandeln. Aber auch wenn der Kampf gegen die Entmenschlichung aussichtslos erscheint, müssen wir ihn wagen. Es wäre die grösste Niederlage des Menschen, wenn er sich in dieses mickrige, lächerliche Schicksal fügen würde und sich mit immer weiteren Varianten von Smartphones und Flachbildschirmen abspeisen lassen würde.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, emanzipierte BürgerInnen heranzuziehen. BürgerInnen, die sich nicht mit der billigsten, dünnsten Sprache zufriedengeben, sondern sich in ihrer Sprache zu erkennen geben. BürgerInnen, die kompliziertere Zusammenhänge verstehen können und wollen und die sich nicht hinter die Mauern des Apolitischen und Gleichgültigen zurückziehen. Es gilt, Menschen zu fördern, die unterscheiden können zwischen essenziell und banal, Oberfläche und Tiefe. Die nicht AnalphabetInnen des Informationszeitalters sind, sondern mündig.
Ich kann nur hoffen, dass diese in der Kultur nicht mehr nur ein Mittel der Zerstreuung und Betäubung sehen werden. Dass sich die Säle der falschen literarischen Propheten, der Banalisiererinnen, leeren und sich mit PoetInnen füllen werden. Es ist eine Sisyphusarbeit, aber es lohnt sich, den Stein bis zur Spitze zu rollen. Nur diesmal gemeinsam.
Catalin Dorian Florescu
Der Schriftsteller Catalin Dorian Florescu (46) lebt nach einer mäandernden Reise, die ihn von Rumänien nach Italien und in die New Yorker Bronx führte, seit 1982 in Zürich, wo er Psychologie und Psychopathologie studierte und als Gestalttherapeut tätig war. Als Schriftsteller debütierte er 2001 mit dem Roman «Wunderzeit». 2011 erschien «Jacob beschliesst zu lieben» (C. H. Beck). Im Sommer 2014 hat er das Berlinstipendium des Kantons Zürich inne.
GrenzgängerInnen
«Globale Wanderer» nennt die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Löffler die SchriftstellerInnen, die eine neue, weltumpannende Literatur prägen. Ihre Kennzeichen seien die nicht nationale Verwurzelung und der Sprachwechsel: Sie schrieben in aller Regel nicht in ihrer Muttersprache, und das fundamentale Thema sei die Mehrfachidentität, der «Transit» zwischen den Zugehörigkeiten. In ihrem Buch «Die neue Weltliteratur und ihre grossen Erzähler» (C. H. Beck, 2014) stellt Löffler fünfzig dieser GrenzgängerInnen vor.
Kürzlich hat der Schriftsteller Maxim Biller in einer Polemik gegen die deutschsprachige Literatur seine KollegInnen nicht deutscher Herkunft aufgefordert, auf die «Onkel-Tom-Literatur» schreibender GastarbeiterInnen zu verzichten und eine literarische Bewegung in Gang zu setzen, die die «Freiheit unserer Multilingualität und Fremdperspektive nutzt» und sich dem Anpassungsdruck der «Autochthonen» entzieht. Das hat zumindest in Deutschland eine kleine feuilletonistische Erregungswelle ausgelöst.
Über das «Schreiben mit zwei Zungen» diskutieren in Solothurn am Samstag, 31. Mai 2014, um 16 Uhr auch die aus Kiew stammende Autorin Katja Petrowskaja und ihr tschechischer Kollege Jaroslav Rudiš (vgl. «Wünschelrute auf der Suche nach den Meinigen» und «Soljanka mit viel Luftzug» ).
Ulrike Baureithel